Книга: Der Taubentunnel
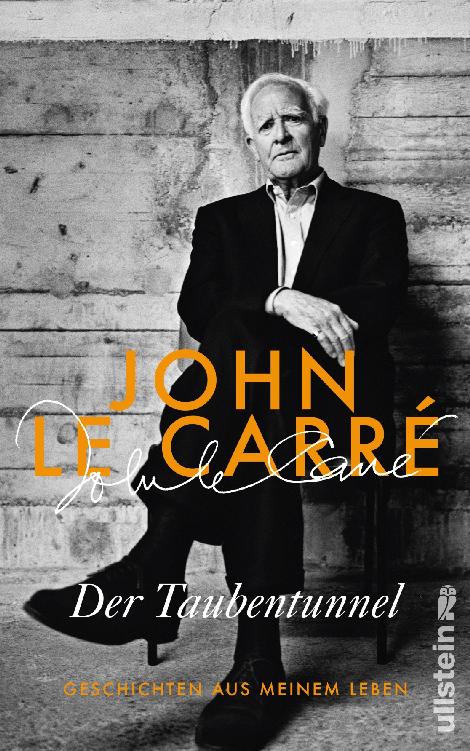
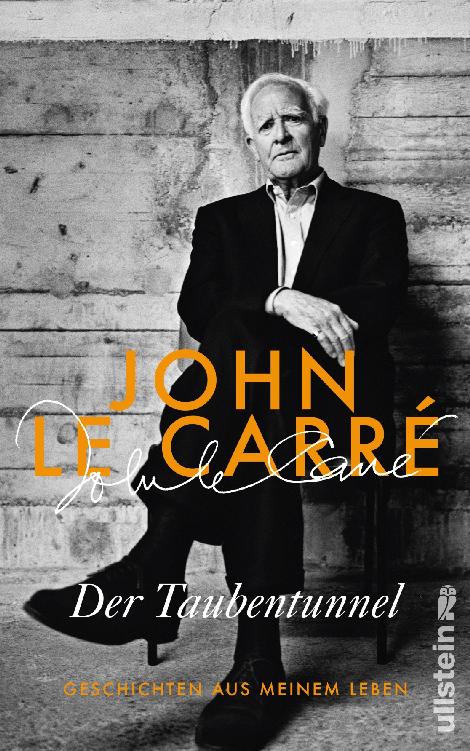
Das Buch
Was macht das Leben eines Schriftstellers aus? Mit dem Welterfolg Der Spion, der aus der Kälte kam gab es für John le Carré keinen Weg zurück. Er kündigte seine Stelle im diplomatischen Dienst, reiste zu Recherchezwecken um den halben Erdball – Afrika, Russland, Israel, USA, Deutschland –, traf die Mächtigen aus Politik- und Zeitgeschehen und ihre heimlichen Handlanger. John le Carré ist bis heute ein exzellenter und unabhängiger Beobachter, mit untrüglichem Gespür für Macht und Verrat. Aber auch für die komischen Seiten des weltpolitischen Spiels. In seinen Memoiren blickt er zurück auf sein Leben und sein Schreiben.
Der Autor
John le Carré, 1931 geboren, studierte in Bern und Oxford. Er war Lehrer in Eton und arbeitete während des Kalten Kriegs kurze Zeit für den britischen Geheimdienst. Seit nunmehr fünfzig Jahren ist das Schreiben sein Beruf. Er lebt in London und Cornwall.
JOHN LE CARRÉ
Der Taubentunnel
GESCHICHTEN AUS MEINEM LEBEN
Aus dem Englischen
von Peter Torberg

ULLSTEIN
Die Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel The Pigeon Tunnel
bei Viking, einem Imprint
von Penguin Random House UK, London
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1342-9
© 2016 by David Cornwell
© der deutschsprachigen Ausgabe
2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Umschlagfoto: Anton Corbijn
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Vorwort
Fast allen meinen Büchern habe ich irgendwann einmal den Arbeitstitel Der Taubentunnel gegeben. Wie es dazu kam, ist schnell erklärt. Ich war noch ein halbes Kind, als mein Vater beschloss, mich auf einen seiner Ausflüge nach Monte Carlo mitzunehmen, wo er seiner Spielleidenschaft frönte. In der Nähe des alten Casinos lag der Sportclub, und auf dessen Gelände gab es eine Schießanlage, die aufs Meer hinausging. Unter einer der Grünflächen waren parallel zueinander Rohre verlegt worden, die zur See hin an die Oberfläche führten. In diese Tunnel wurden nun Tauben geschickt, die auf dem Dach des Casinos ausgebrütet und dort in einem Schlag gehalten worden waren. Sie mussten durch den stockfinsteren Tunnel flattern, bis sie in den mediterranen Himmel aufstiegen, als Ziel für die Gentlemen, die zuvor gut gegessen hatten und nun stehend oder liegend mit ihren Schrotflinten warteten. Die Tauben, die nicht oder nur leicht getroffen waren, taten das, was Tauben im Allgemeinen tun. Sie kehrten in den Schlag auf dem Casinodach zurück, wo sie geschlüpft waren, und alles begann von neuem.
Warum dieses Bild mir nun schon so lange nachgeht, können Sie als Leser womöglich besser beurteilen, als ich es kann.
John le Carré,
Januar 2016
Einleitung
Ich sitze an meinem Schreibtisch im Souterrain des kleinen Chalets, das ich mir mit den Erlösen aus meinem Buch Der Spion, der aus der Kälte kam in einem Bergdorf in der Schweiz gebaut habe. Es liegt neunzig Zugminuten entfernt von Bern, jener Stadt, in die ich mit sechzehn aus meiner englischen Privatschule floh und wo ich mich an der Universität einschrieb. An den Wochenenden strömten wir jungen Männer und Frauen ins Oberland hinauf, um in Berghütten zu kampieren und bis zum Umfallen Ski zu fahren. Soweit ich mich erinnere, waren wir die Bravheit in Person, die Studenten schliefen auf der einen Seite, die Studentinnen auf der anderen, und niemals kamen wir miteinander in Berührung. Falls doch, ich war jedenfalls nicht dabei.
Das Chalet befindet sich hoch über dem Dorf. Wenn ich den Kopf in den Nacken lege, sehe ich durch das Fenster die Berggipfel von Eiger, Mönch und Jungfrau weit über mir; am schönsten aber ist der Blick auf das Silberhorn und das Kleine Silberhorn in halber Höhe: zwei sich malerisch zuspitzende Eiskegel, die in regelmäßigen Abständen unter dem Föhnwind ergrauen, nur um Tage später wieder ihre hochzeitlich weiße Pracht anzulegen.
Zu unseren örtlichen Schutzpatronen zählen wir den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, dem man auf Schritt und Tritt begegnet – ja, es gibt auch einen Mendelssohn-Wanderweg –, Johann Wolfgang Goethe, auch wenn er es wohl nur bis zu den Wasserfällen im Lauterbrunnental geschafft haben dürfte, und Lord George Byron. Letzterer drang bis zur Wengernalp vor, die er furchtbar fand, und wetterte, der Anblick der von Stürmen verwüsteten Wälder »erinnerte mich an mich selbst und meine Familie«.
Besonders verehrt wird aber zweifellos Ernst Gertsch, der dem Dorf Ruhm und Reichtum brachte, als er 1930 das erste Lauberhornrennen veranstaltete und dort selbst den Slalom gewann. Ich war mal verrückt genug, an einem solchen Rennen teilzunehmen, und erlitt, wie nicht anders zu erwarten, aus Unvermögen und purer Angst eine Schlappe. Meinen Nachforschungen zufolge beließ es Gertsch nicht bei der Rolle als Vater dieses Skirennens, sondern erfand später die Stahlkanten an den Skiern und die Plattenbindung, wofür wir ihm alle dankbar sein sollten.
Es ist Mai, wir haben also in einer Woche das Wetter eines ganzen Jahres: gestern einen halben Meter Neuschnee, doch gab es nicht einen einzigen Skifahrer, der ihn hätte genießen können; heute klarer Himmel und eine sengende Sonne; der Schnee ist schon fast wieder geschmolzen, und die Frühlingsblumen melden sich zurück. Heute Abend wiederum marschierten paynesgraue Gewitterwolken das Lauterbrunnental hinauf wie einst Napoleons Grande Armée.
Ihnen wird sich wohl der Föhn anschließen, der uns in den letzten Tagen verschont hat, Himmel, Almen und Wälder werden alle Farbe verlieren, das Chalet knarzt und ruckelt, und der Qualm des Feuers zieht nicht ab, sondern quillt aus dem Kamin auf den Teppich, für den wir an einem regnerischen Nachmittag in Interlaken in jenem schneelosen Winter anno dazumal zu viel bezahlt haben; das Klappern und Hupen aus dem Tal hört sich an wie mürrische Protestrufe, und die Vögel können ihre Nester nicht verlassen, mit Ausnahme der Alpendohlen, die sich von nichts und niemandem etwas vorschreiben lassen. Fahren Sie bei Föhn nur ja nicht Auto, machen Sie niemals einen Heiratsantrag. Wenn Sie Kopfschmerzen haben oder gar den Drang verspüren, Ihren Nachbarn umzubringen, keine Sorge. Sie haben keinen üblen Kater, es liegt am Föhn.
Das kleine Chalet nimmt in meinem nun 84 Jahre währenden Leben einen Raum ein, der in keinem Verhältnis zu seiner realen Größe steht. In den Jahren vor seinem Bau kam ich als junger Mann in dieses Dorf, um im Winter auf Skiern aus Esche oder Hickory zu fahren, mit Seehundfellen unter den Brettern bergauf zu steigen und mit Lederbindungen wieder hinunterzugleiten, und um im Sommer mit Vivian Green, meinem weisen Ziehvater aus Oxford, durch die Berge zu wandern. Green, der spätere Rektor des Lincoln College, diente mir als Vorbild für das Seelenleben George Smileys.
Es ist also kein Zufall, dass Smiley seine Schweizer Alpen ebenso sehr liebte wie Vivian Green, dass er, wie Vivian, Trost in der Natur fand oder, wie ich, eine lebenslange, widersprüchliche Beziehung zur deutschen Muse hegte.
Vivian war es, der mein jugendliches Geschwafel über meinen unberechenbaren Vater Ronnie über sich ergehen ließ; und wenn mein Vater mal wieder eine seiner größeren Pleiten hinlegte, war er es, der das nötige Geld auftrieb und mich drängte, auf jeden Fall zu Ende zu studieren.
In Bern lernte ich den Nachkommen der ältesten Hoteliersfamilie im Oberland kennen. Ohne seinen Einfluss hätte ich später niemals die Erlaubnis erhalten, das Chalet überhaupt zu bauen, denn damals wie heute ist es Ausländern untersagt, auch nur das kleinste Fleckchen Land in meinem Dorf zu besitzen.
Meine allerersten Schritte im britischen Geheimdienst unternahm ich ebenfalls in Bern und überbrachte ich weiß nicht was ich weiß nicht wem. Heute frage ich mich manchmal, was wohl aus mir geworden wäre, wenn ich nicht aus der Privatschule weggelaufen wäre oder eine andere Himmelsrichtung eingeschlagen hätte. Heute kommt es mir so vor, als sei alles, was mir später im Leben widerfahren ist, aus dieser einen im jugendlichen Überschwang getroffenen Entscheidung erwachsen, England auf dem kürzesten Weg zu verlassen und die deutsche Muse als Ersatzmutter anzunehmen.
Ich war kein Schulversager, ganz im Gegenteil: Anführer in vielem, mit Schulpreisen ausgezeichnet, hatte ich das Zeug zum Vorzeigeschüler. Und der Ausstieg ging sehr diskret vonstatten. Ich tobte nicht, ich brüllte nicht herum. Ich sagte nur: »Vater, du kannst machen, was du willst, aber ich gehe nicht zurück.« Sehr wahrscheinlich gab ich der Schule – und England gleich dazu – die Schuld an meinem Kummer, dabei war mein eigentliches Motiv wohl, mich um jeden Preis dem Einfluss meines Vaters zu entziehen, aber das konnte ich ihm nicht ins Gesicht sagen. Seither habe ich die gleiche Erfahrung mit meinen eigenen Kindern gemacht, wenn sie auch sehr viel eleganter vorgingen und erheblich weniger Wirbel verursachten.
Das alles beantwortet aber noch lange nicht die zentrale Frage, welchen Verlauf mein Leben sonst genommen hätte. Wäre ich an einem anderen Ort als Bern jemals vom britischen Geheimdienst angeworben worden, um als Botenjunge das zu tun, was man in der Branche ›alles Mögliche‹ nennt? Ich hatte Somerset Maughams Ashenden damals noch nicht gelesen, aber ganz sicher Rudyard Kiplings Kim und jede Menge chauvinistischer Abenteuergeschichten von G. A. Henty und seinesgleichen. Dornford Yates, John Buchan und Rider Haggard waren über jeden Zweifel erhaben.
Natürlich war ich gerade mal vier Jahre nach Kriegsende der größte britische Patriot, den man sich nur vorstellen kann. In meiner Schulzeit hatten wir Jungen uns einen Sport daraus gemacht, in unseren Reihen deutsche Spione zu entdecken, und ich galt als guter Agent der Spionageabwehr. In der Privatschule dann blieb unser patriotischer Eifer ungebrochen. Zwei Mal in der Woche hatten wir »Corps«-Militärtraining in voller Montur. Unsere jungen Lehrer waren gebräunt aus dem Krieg heimgekehrt und trugen an den »Corps«-Tagen ihre Ordensbänder. Mein damaliger Deutschlehrer berichtete aus einem wunderbar geheimnisvollen Krieg. Unsere Berufsberater bereiteten uns auf den lebenslangen Einsatz auf weit entfernten Außenposten des britischen Königreichs vor. Die Abtei im Zentrum unserer Kleinstadt hing voller Regimentsfahnen, die in den Kolonialkriegen in Indien, Südafrika und dem Sudan zu Fetzen zerschossen und dann von liebevoller, weiblicher Hand zu altem Glanz zurückgeführt worden waren.
Es ist also nicht weiter überraschend, dass der siebzehnjährige englische Student, der an einer ausländischen Universität eine Gewichtsklasse über der eigenen boxte, strammstand und »Zu Ihren Diensten, Ma’am!« sagte, als ihn der Ruf in Gestalt einer eher mütterlichen Dreißigjährigen namens Wendy aus der Visaabteilung der britischen Botschaft in Bern ereilte.
Weniger einfach zu erklären ist meine völlige Hingabe an die deutsche Literatur, und das zu einer Zeit, als für viele Menschen schon allein das Wort Deutsch ein Synonym für das Böse an sich war. Doch wie schon die Flucht nach Bern, bestimmte auch diese Hingabe meinen weiteren Lebensweg. Ohne sie hätte ich Deutschland 1949 nicht auf Drängen meines geflohenen jüdischen Deutschlehrers besucht, nicht die dem Erdboden gleichgemachten Städte an der Ruhr gesehen oder hundeelend auf einer alten Wehrmachtsmatratze in einem deutschen Notlazarett in einem Berliner U-Bahnhof gelegen; ich hätte auch nicht die Konzentrationslager in Dachau und Bergen-Belsen aufgesucht, in denen der Gestank noch immer in den Baracken stand, um dann in die gelassene Beschaulichkeit Berns zurückzukehren, zurück zu meinem Thomas Mann und meinem Hermann Hesse. Ganz sicher hätte ich für meinen nationalen Sicherheitsdienst keine Spionageaufgaben im besetzten Österreich übernommen, weder hätte ich deutsche Literatur und Sprache in Oxford studiert und beides später in Eton unterrichtet, noch wäre ich unter dem Deckmantel eines angehenden Diplomaten an die britische Botschaft in Bonn versetzt worden, und ich hätte wohl auch keine Romane mit deutschen Themen geschrieben.
Die Früchte dieses frühen Versenkens in alles Deutsche habe ich nun klar vor Augen. So hatte ich mein ureigenes vielschichtiges Terrain zu beackern; es befeuerte meine unheilbar romantische Ader und meine Liebe zur Lyrik; es weckte in mir die Vorstellung, dass die Reise des Menschen von der Wiege bis zur Bahre die einer nicht endenden Wissensaneignung ist – nicht sonderlich originell und möglicherweise auch fragwürdig, aber so war es nun mal. Als ich dann die Dramen von Goethe, Lenz, Schiller, Kleist und Büchner studierte, fiel mir auf, dass ich ihre klassische Strenge und den neurotischen Überschwang ebenfalls sehr gut nachvollziehen konnte. Der Trick, so schien es mir, bestand darin, das eine hinter dem anderen zu verbergen.
Das Chalet ist nun bald fünfzig Jahre alt. Jeden Winter kamen die Kinder, als sie heranwuchsen, zum Skifahren her, und hier erlebten wir gemeinsam die schönsten Zeiten. Manchmal blieben wir bis in den Frühling. Hier war ich auch im Winter 1967, wenn ich mich recht erinnere, für vier höchst amüsante Wochen in Klausur mit Sydney Pollack (dem Regisseur von Tootsie, Jenseits von Afrika und – mein Lieblingsfilm von ihm – Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss), in denen wir ein Drehbuch nach meinem Roman Eine kleine Stadt in Deutschland zusammenzuzimmern versuchten.
In jenem Winter war der Schnee einfach perfekt. Sydney war noch nie Ski gefahren und noch nie in der Schweiz gewesen. Der Anblick der fröhlichen Skifahrer, die ganz lässig an unserem Balkon vorbeisausten, war unwiderstehlich. Er musste es selbst versuchen, und zwar auf der Stelle. Er wollte, dass ich es ihm beibrachte, doch Gott sei Dank rief ich stattdessen Martin Epp an: Skilehrer, legendärer Bergführer, einer der wenigen, die die Eiger-Nordwand allein bezwungen haben.
Der berühmte Filmregisseur aus Southbend, Indiana, und der berühmte Bergsteiger aus Arosa verstanden sich auf Anhieb. Sydney tat nichts halbherzig. Nach wenigen Tagen war er bereits ein ordentlicher Skifahrer. Schnell erwachte in ihm auch der Wunsch, einen Film über Martin Epp zu drehen, was seine ursprüngliche Idee, Eine kleine Stadt in Deutschland zu verfilmen, bald überlagerte. Der Eiger selbst sollte Schicksal spielen. Ich sollte das Drehbuch schreiben, Martin würde sich selbst spielen, und Sydney würde ihn, auf halber Höhe des Eiger abgeseilt, selbst filmen. Er rief seinen Agenten an und erzählte ihm von Epp. Er rief seinen Analysten an und erzählte ihm von Epp. Die Schneeverhältnisse blieben weiter so perfekt, und Sydney verausgabte sich beim Skifahren. Wir entschieden, die beste Zeit zum Schreiben sei abends nach einem Bad. Ob das nun stimmte, sei dahingestellt, jedenfalls wurde keiner der beiden Filme jemals gedreht.
Später überließ Sydney für mich etwas überraschend das Chalet Robert Redford, der Erkundungen für seinen Film Schussfahrt anstellen wollte. Leider lernte ich ihn nie kennen, doch eilte mir einige Jahre lang bei jedem Besuch im Dorf der Ruf voraus, mit Robert Redford befreundet zu sein.
Ich werde Ihnen in diesem Buch wahre Geschichten nach meiner Erinnerung erzählen, so wie diese – Sie können also mit Fug und Recht fragen, was ist für einen Schriftsteller an seinem Lebensabend, um es taktvoll auszudrücken, denn Wahrheit, was Erinnerung? Für den Juristen besteht die Wahrheit aus ungeschminkten Tatsachen. Ob sich solche Tatsachen jemals finden lassen, ist eine andere Frage. Für den Schriftsteller sind Fakten das Rohmaterial, nicht sein Lehrmeister, sondern sein Instrument, und seine Aufgabe besteht darin, dieses Instrument zum Klingen zu bringen. Die eigentliche Wahrheit ist, wenn überhaupt, nicht schwarz oder weiß, sondern verbirgt sich in den Nuancen.
Hat es jemals so etwas wie ein absolutes Gedächtnis gegeben? Ich bezweifle es. Selbst wenn wir uns einreden, wir seien unvoreingenommen und würden uns nur an die nackten Tatsachen halten, ohne diese zum eigenen Vorteil zu schönen oder etwas auszulassen, ist so etwas wie das absolute Gedächtnis so schlecht zu packen wie ein Stück nasser Seife. Zumindest gilt das für mich, schließlich habe ich mein ganzes Leben damit verbracht, Erfahrungen mit Erfundenem zu mischen.
Hier und da, wo es mir sinnvoll erschien, habe ich Gesprächsfetzen oder Auszüge aus Zeitungsartikeln übernommen, die ich vor langer Zeit geschrieben habe, weil ihre Frische mir gefällt und mir das Gedächtnis nichts Vergleichbares liefern konnte; wie zum Beispiel meine Beschreibung von Wadim Bakatin, dem ehemaligen Chef des KGB. In anderen Fällen habe ich einen Artikel fast so belassen, wie ich ihn damals geschrieben habe, ihn nur hier und da überarbeitet und ab und zu eine Bemerkung angefügt, um mich klarer auszudrücken oder etwas auf den neuesten Stand zu bringen.
Ich setze bei meinem Leser keine große Kenntnis meiner Romane voraus – eigentlich gar keine, um ehrlich zu sein, deshalb findet sich unterwegs der eine oder andere erklärende Abschnitt. Doch auf eines können Sie sich verlassen: An keiner Stelle habe ich bewusst ein Ereignis oder eine Geschichte verfälscht. Verschleiert, wenn nötig. Verfälscht, auf gar keinen Fall. Und wo immer meine Erinnerung mich trügen könnte, räume ich dies auch ein. Eine vor kurzem veröffentlichte Biographie über mich widmet sich kurz ein, zwei der Geschichten, die auch in diesem Buch vorkommen. Es war mir, ehrlich gesagt, ein Vergnügen, sie selbst zu erzählen und sie, so gut ich kann, mit meinen eigenen Empfindungen auszustatten.
Manche Geschichten haben mit den Jahren eine Bedeutung bekommen, die mir in ihrer Zeit nicht bewusst war, zum Beispiel durch den Tod eines der Beteiligten. Mein ganzes langes Leben lang habe ich kein Tagebuch geführt, sondern mir nur hier und da Reisenotizen gemacht oder unwiederbringliche Zeilen aus Gesprächen notiert, wie zum Beispiel in meinen Tagen mit Jassir Arafat, dem Vorsitzenden der PLO, vor seiner Ausweisung aus dem Libanon; später dann auch von meinem ergebnislosen Besuch in seinem weißen Hotel in Tunis. Mehrere Mitglieder seines Oberkommandos, die ein paar Meilen entfernt von ihm in dieser Stadt einquartiert waren, wurden ein paar Wochen nach meiner Abreise von einem israelischen Kommando ermordet.
Einflussreiche Männer und Frauen haben mich angezogen, weil ich wissen wollte, wie sie tickten. In ihrer Gegenwart jedoch scheine ich, im Nachhinein betrachtet, nur weise genickt, den Kopf an den richtigen Stellen geschüttelt und ein, zwei witzige Bemerkungen gemacht zu haben, um die Atmosphäre aufzulockern. Erst hinterher, wieder zurück in meinem Hotelzimmer, habe ich meinen übel zugerichteten Notizblock hervorgeholt und versucht zu verstehen, was ich gehört und gesehen hatte.
Alles andere hastig Hingeschriebene, das von meinen Reisen übriggeblieben ist, stammt größtenteils nicht von mir, sondern von meinen Romanfiguren, die ich zum Schutz mitgenommen hatte, als ich mich in die Welt hinauswagte. Diese Notizen erzählen ihre Sicht der Dinge, nicht meine, in ihren Worten. Als ich mich in einem Unterstand am Mekong zusammenkauerte und zum ersten Mal hörte, wie die Kugeln in das schlammige Ufer über mir einschlugen, da war es nicht meine zitternde Hand, die meine Entrüstung darüber einem zerschlissenen Notizbuch anvertraute, sondern die Hand meines mutigen fiktiven Helden, des Sportberichterstatters Jerry Westerby, für den es zum Alltag gehörte, beschossen zu werden. Ich dachte erst, ich sei da anders als andere, bis ich einen gefeierten Kriegsfotografen kennenlernte, der mir gestand, dass seine Riesenangst erst dann verschwand, wenn er durch den Sucher seiner Kamera schaute.
Ich persönlich wurde meine Riesenangst nie los. Aber ich weiß, was er meinte.
Falls Sie jemals das Glück haben, recht früh in Ihrer Karriere als Schriftsteller einen Erfolg zu landen, wie mir das mit Der Spion, der aus der Kälte kam gelang, dann wird es für den Rest Ihres Lebens ein Vorher und ein Nachher geben. Schauen Sie auf die Bücher zurück, die Sie geschrieben haben, bevor die Suchscheinwerfer Sie erfasst haben, dann lesen sie sich wie Bücher aus den Tagen der Unschuld, die Bücher danach jedoch wie die Bemühungen eines Mannes im Rampenlicht. »Allzu bemüht«, schreien die Kritiker dann. Ich fand nie, dass ich mich allzu sehr bemüht hätte. Ich dachte, ich sei es meinem Erfolg schuldig, das Beste zu geben, und im Großen und Ganzen tat ich das auch, ganz gleich, wie gut oder schlecht das Beste nun war.
Und ich liebe das Schreiben. Ich liebe zu tun, was ich gerade tue: wie jemand, der untergetaucht ist, früh an einem wolkenverhangenen Maimorgen an einem winzigen Schreibtisch zu sitzen und vor mich hin zu kritzeln, während der Bergregen am Fenster hinunterströmt und es keinen Grund gibt, mit dem Regenschirm zur Bahnstation hinunterzustapfen, denn die International New York Times trifft erst gegen Mittag ein.
Ich liebe es, unterwegs in Notizbücher zu schreiben, beim Wandern, in Eisenbahnen und Cafés, um dann nach Hause zu eilen und meine Beute durchzusehen. Bin ich in Hampstead Heath, dann ist mir eine bestimmte Bank unter einem ausladenden Baum auf der Heide die liebste, abseits der anderen Bäume, und dort schreibe ich auch wirklich gern. Und immer mit der Hand. Es mag etwas arrogant wirken, aber ich ziehe es vor, der jahrhundertealten Tradition des Schreibens mit Stift und Papier treu zu bleiben. Der verkümmerte grafische Künstler in mir hat sein Vergnügen daran, die Wörter zu zeichnen.
Am Schreiben liebe ich es vor allem, ungestört zu sein, deshalb trete ich nicht auf Literaturfestivals auf und halte mich so weit wie möglich von Interviews fern, auch wenn es anders scheinen mag. Es gibt Augenblicke, meist in der Nacht, da wünschte ich mir, ich hätte nie ein Interview gegeben. Erst erfindet man sich selbst, dann glaubt man an die eigene Erfindung. Dieser Vorgang ist mit Selbsterkenntnis nicht vereinbar.
Dass ich im richtigen Leben einen anderen Namen trage, schützt mich ein wenig bei meinen Recherchen. Ich kann ein Hotelzimmer buchen, ohne mir Sorgen darum machen zu müssen, ob jemand meinen Namen kennt. Und wenn nicht, muss ich mich auch nicht darum sorgen, warum nicht. Wenn ich jedoch gezwungen bin, mich denjenigen gegenüber zu offenbaren, an deren Erfahrungen ich teilhaben möchte, fallen die Reaktionen ganz unterschiedlich aus. Der eine traut mir nicht mehr über den Weg, der Nächste befördert mich zum Geheimdienstchef, und wenn ich beteuere, dass ich niemals über die niedrigste Lebensform in der Welt der Spionage hinausgekommen bin, erwidert er, dass ich ja wohl nichts anderes sagen könne, nicht wahr? Nur um mir gleich darauf Vertraulichkeiten aufzunötigen, an denen mir nicht gelegen ist, die ich nicht brauchen und auch nicht behalten kann, und das nur aufgrund der falschen Annahme, dass ich diese Vertraulichkeiten an, na, Sie wissen schon wen, weitergeben werde. Ich habe mich auch an anderer Stelle über dieses halb ernste, halb komische Dilemma ausgelassen.
Die Mehrheit jener armen Seelen aber, die ich im Laufe der letzten fünfzig Jahre mit meinen Fragen bombardiert habe – von Führungskräften der pharmazeutischen Industrie auf mittlerer Ebene bis hin zu Bankern, Söldnern und mancherlei Arten von Spionen –, waren nachsichtig mit mir und haben Großmut bewiesen. Die Großmütigsten unter ihnen waren die Kriegsberichterstatter und Auslandskorrespondenten, die den von ihnen profitierenden Schriftsteller unter ihre Fittiche nahmen, die ihn für mutig hielten, obwohl er es nicht war, und ihm erlaubten, sich ihnen anzuschließen.
Undenkbar, dass meine Streifzüge durch Südostasien und den Nahen Osten jemals ohne den Rat und die Gesellschaft von David Greenway möglich gewesen wären, dem hochdekorierten Südostasienkorrespondenten von Time Magazine, Washington Post und Boston Globe. Für einen schüchternen Anfänger hätte es keinen besseren Leitstern geben können. An einem verschneiten Vormittag im Jahr 1975 saß Greenway an unserem Frühstückstisch hier im Chalet und gönnte sich eine kurze Atempause von der Front, als sein Büro in Washington anrief und ihm mitteilte, dass das belagerte Phnom Penh bald den Roten Khmer in die Hände fallen würde. Von unserem Dorf aus führt keine Straße ins Tal, nur eine kleine Eisenbahn, die einen zu einer größeren Eisenbahn bringt, die einen zu einer noch größeren bringt, und so zum Flughafen Zürich. Im Handumdrehen hatte Greenway seine alpine Bekleidung aus- und den schäbigen Drillich des Kriegsberichterstatters angezogen und war in alte Wildlederschuhe geschlüpft; seiner Frau und seinen Töchtern gab er einen Abschiedskuss und stürmte den Hügel hinunter zur Bahnstation. Ich stürmte mit seinem Reisepass hinterher.
Wie allgemein bekannt, gehörte Greenway zu den letzten amerikanischen Journalisten, die vom Dach der belagerten US-Botschaft in Phnom Penh ausgeflogen wurden. Als ich 1981 an der Allenby-Brücke, die die West Bank mit Jordanien verbindet, an Ruhr erkrankte, schleppte mich Greenway durch die Masse der ungeduldigen Reisenden, die darauf warteten, abgefertigt zu werden, redete uns mit schierer Willenskraft durch die Kontrollen und brachte mich über die Brücke.
Jetzt, da ich einige der Episoden erneut durchlese, fällt mir auf, dass ich entweder aus Egoismus oder um einer pointierteren Story willen nicht erwähnt habe, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt noch im Raum befand.
Ich denke da an meine Unterhaltung mit dem russischen Physiker und politischen Gefangenen Andrei Sacharow und seiner Frau Jelena Bonner, die in einem Restaurant im damals noch so genannten Leningrad unter der Schirmherrschaft von Human Rights Watch stattfand; drei Mitglieder dieser Organisation saßen mit uns am Tisch und litten wie wir unter den kindischen Aufdringlichkeiten der Horde falscher KGB-Fotografen, die uns umringten und ihre altmodischen Kameras mit ihren Blitzlichtern auf uns richteten. Ich hoffe nur, dass auch andere Teilnehmer dieser Gesellschaft ihre eigenen Darstellungen jenes historischen Tags verfasst haben.
Ich denke an Nicholas Elliott, den langjährigen Freund und Kollegen des Doppelagenten Kim Philby. Mit einem Glas Brandy in der Hand stapfte Elliott durch das Wohnzimmer unseres Londoner Hauses, und mir fällt zu spät ein, dass meine Frau ebenfalls anwesend war, mir in einem Sessel gegenübersaß und ebenso fasziniert war wie ich.
Und während ich dies schreibe, fällt mir auch jener Nachmittag wieder ein, als Elliott mit seiner Frau Elizabeth zum Diner kam und wir einen gerngesehenen iranischen Gast hatten, der ein makelloses Englisch mit einem winzigen, ja eher vorteilhaften Sprachfehler sprach. Als unser iranischer Gast sich verabschiedete, drehte sich Elizabeth mit strahlenden Augen zu Nicholas um und sagte aufgeregt: »Hast du sein Stottern bemerkt, Liebling? Genau wie Kim!«
Das lange Kapitel über meinen Vater Ronnie kommt ans Ende des Buchs, nicht an den Anfang, denn sosehr er sich das auch wünschen würde, möchte ich doch nicht, dass er zu einer der Hauptattraktionen wird. Trotz der vielen Stunden, die ich mich in Gedanken mit ihm abgequält habe, bleibt er mir immer noch genauso ein Rätsel wie meine Mutter. Alle Geschichten sind nagelneu, mit wenigen Ausnahmen, auf die ich hinweise. Falls ich es notwendig fand, habe ich einen Namen geändert. Der Hauptakteur mag zwar schon verstorben sein, doch verstehen seine Erben und Rechtsnachfolger vielleicht die Pointe nicht. Ich habe versucht, einen ordentlichen Pfad durch mein Leben zu schlagen, wenn schon nicht chronologisch, dann zumindest thematisch, doch wie das Leben so spielt, verzweigte sich der Pfad in alle möglichen unvorhergesehenen Richtungen, so dass einzelne Geschichten zu dem wurden, was sie für mich immer waren: eigenständige Episoden, die sich selbst genug sind und in keinerlei mir erkennbare Richtung weisen; ich erzähle sie wegen der Bedeutung, die sie für mich gewonnen haben, weil sie mich erschrecken oder ängstigen, mich anrühren oder mitten in der Nacht wecken und zum Lachen bringen.
Mit fortschreitender Zeit haben einige der Begegnungen, die ich beschreibe, den Status von winzigen, in flagranti eingefangenen historischen Momenten angenommen, wie das wohl bei allen älteren Menschen der Fall sein dürfte. Wenn ich von den Begegnungen so als Ganzes lese, wie sie von Posse zu Tragödie wechseln und zurück, fällt mir auf, dass ich sie etwas zu unbekümmert finde, bin mir aber nicht sicher, warum. Vielleicht ist es mein Leben, das ich zu unbekümmert finde. Doch es ist zu spät, um daran noch etwas zu ändern.
So wie bei jedem anderen Menschen auch, gibt es viele Dinge im Leben, über die ich niemals schreiben werde. Ich hatte zwei ungeheuer loyale und hingebungsvolle Ehefrauen, beiden gebührt unendlicher Dank und so manche Entschuldigung. Ich war weder ein Mustergatte noch ein Traumvater, und ich bin auch nicht daran interessiert, mich als solche auszugeben. Die Liebe kam, nach vielen Fehltritten, erst spät zu mir. Meine moralische Erziehung verdanke ich meinen vier Söhnen. Über meine Arbeit beim britischen Geheimdienst, die ich zumeist in Deutschland geleistet habe, möchte ich dem, was andere ungenau an anderer Stelle berichtet haben, nichts hinzufügen. Ich bin durch Reste altmodischer Loyalität meinen früheren Diensten gegenüber ebenso gebunden wie durch Vereinbarungen, getroffen mit den Männern und Frauen, die mit mir zusammengearbeitet haben. Unsere Übereinkunft lautete, dass die Verschwiegenheit zeitlich unbegrenzt ist und auch unsere Kinder überdauern sollte. Die Arbeit, die wir leisteten, war weder gefährlich noch dramatisch, verlangte aber von uns, die sich dazu verpflichteten, schmerzhafte Gewissenserforschung. Ganz gleich, ob diese Personen heute noch leben oder nicht, die Vertraulichkeit gilt nach wie vor.
Spionieren wurde mir von Geburt an wohl auf ähnliche Weise aufgezwungen, nehme ich an, wie C. S. Forester das Meer oder Paul Scott Indien. Ich habe versucht, die geheime Welt, die ich einmal kannte, zur Bühne für die größere Welt zu machen, die uns allen vertraut ist. Erst stelle ich mir etwas vor, dann suche ich nach der darin enthaltenen Wirklichkeit. Dann geht es wieder zurück zur Vorstellungskraft und an den Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze.
1
Seien Sie nett zu Ihrem Geheimdienst
»Ich weiß, was Sie sind«, ruft Denis Healey. Mit ausgestreckter Hand kommt der ehemalige Verteidigungsminister der Labour Party bei einer privaten Gesellschaft auf mich zu. »Sie sind ein kommunistischer Spion, ja, das sind Sie, geben Sie’s zu.«
Also gebe ich es zu, ganz der nette Kerl, der in solchen Situationen alles zugeben würde. Alle lachen, mein leicht pikierter Gastgeber ebenfalls. Ich lache mit, denn ich bin ein netter Kerl und kann einstecken wie jeder andere auch, und Denis Healey ist vielleicht ein großes Tier in der Labour Party und ein ziemlicher Streithammel, wenn es um Politik geht, aber er ist außerdem ein bedeutender Gelehrter und Humanist, ich bewundere ihn, und er ist mir ein paar Drinks voraus.
»Cornwell, Sie Mistkerl«, brüllt ein MI6-Agent, ein ehemaliger Kollege von mir, quer durch den Raum, in dem sich eine ganze Gruppe von Washingtoner Insidern zu einem diplomatischen Empfang des britischen Botschafters versammelt. »Sie verfluchter Mistkerl.« Er hat nicht damit gerechnet, mir zu begegnen, doch nun nutzt er diese Gelegenheit, um mir zu sagen, was er davon hält, dass ich die Ehre des Dienstes – unseres verfluchten Geheimdienstes, verflucht noch mal! – beleidigt und Männer und Frauen zu Narren gemacht habe, die ihr Land lieben und sich nicht wehren können. Er steht vor mir in der gebeugten Haltung eines Mannes, der gleich zuschlagen wird, und wenn ihn diplomatische Hände nicht sanft gebremst hätten, dann wäre die Szene ein gefundenes Fressen für die Morgenzeitungen geworden.
Das Cocktailgeplauder nimmt langsam wieder Fahrt auf. Inzwischen habe ich allerdings noch herausgefunden, dass es sich bei dem Buch, das meinem ehemaligen Kollegen so unter die Haut ging, nicht um Der Spion, der aus der Kälte kam handelte, sondern um das nachfolgende Krieg im Spiegel, eine trostlose Geschichte über einen britisch-polnischen Agenten, der auf eine Mission nach Ostdeutschland geschickt und dort seinem Schicksal überlassen wird. Unglücklicherweise gehörte Ostdeutschland in den Tagen, als mein aufgebrachter Bekannter und ich zusammengearbeitet haben, zu seinem Gebiet. Ich würde ihm gerne erzählen, dass Allen Dulles, bis vor kurzem noch Direktor der CIA, erklärt hat, das Buch käme der Wirklichkeit erheblich näher als das vorangegangene, doch fürchte ich, dass es ihn nicht unbedingt beruhigen würde.
»Was, herzlos sind wir? Herzlos und inkompetent? Na, vielen Dank!«
Mein zorniger Exkollege befindet sich mit seiner Kritik in bester Gesellschaft. In den letzten fünfzig Jahren habe ich mir denselben Vorwurf immer wieder anhören müssen, wenn auch in weniger heftigen Worten, nicht bösartig gemeint und schon gar nicht als Teil einer Strategie, sondern eher im wiederkehrenden Tonfall verletzter Männer und Frauen, die von der Notwendigkeit ihrer Arbeit überzeugt sind.
»Warum hacken Sie auf uns herum? Sie wissen doch, wie wir in Wirklichkeit sind.« Oder auch gehässiger: »Jetzt, wo Sie einen Haufen Geld mit uns gemacht haben, könnten Sie uns ja mal eine Weile in Ruhe lassen.«
Und selten fehlte der mit Armesündermiene vorgebrachte Hinweis, dass der Geheimdienst ja nicht darauf reagieren und sich gegen Verleumdungen wehren könne; dass für seine Erfolge keine Lobeshymnen zu erwarten seien, dass nur seine Misserfolge ans Licht kämen.
»Wir sind ganz gewiss nicht so, wie unser Gastgeber hier uns beschreibt«, wendet sich Sir Maurice Oldfield beim Lunch mit aller Entschiedenheit an Sir Alec Guinness.
Oldfield ist ein ehemaliger Generaldirektor des Secret Service, der später von Margaret Thatcher fallengelassen wurde; zum Zeitpunkt unserer Begegnung ist er allerdings nichts weiter als ein Spion im Ruhestand.
»Ich wollte Sir Alec schon immer mal kennenlernen«, erklärte er mir in seinem einnehmenden nordenglischen Akzent, als ich ihn einlud. »Wir saßen uns einmal im Zug von Winchester gegenüber. Ich habe nicht den Mut aufgebracht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.«
Guinness wird meinen Geheimagenten George Smiley in der BBC-Fernsehbearbeitung von Dame, König, As, Spion spielen und möchte gerne einmal einen echten alten Spion treffen. Leider verläuft der Lunch nicht so glatt, wie ich gehofft hatte. Bei den Hors d’œuvres rühmt Oldfield den Ehrenkodex seines alten Geheimdienstes und deutet auf die denkbar freundlichste Weise an, dass der »junge Mann hier« dessen guten Namen besudelt hat. Guinness, ehemaliger Marineoffizier, der sich vom ersten Augenblick dieses Treffens mit Oldfield eher den oberen Rängen des Secret Service verpflichtet fühlt, kann nur weise den Kopf schütteln und ihm beipflichten. Bei der Seezunge geht Oldfield noch einen Schritt weiter:
»Der junge Mann hier und seinesgleichen«, verkündet er Guinness quer über den Tisch, während er mich wie Luft behandelt, »sie sind es, die es dem Service so schwer machen, Quellen anzuzapfen und anständige Leute zu rekrutieren. Die lesen seine Bücher und sind abgeschreckt. Kann man ja verstehen.« Woraufhin Guinness den Blick senkt und wieder missbilligend den Kopf schüttelt, indessen begleiche ich schon mal die Rechnung.
»Sie sollten dem Athenaeum Club beitreten, David«, sagt Oldfield freundlich und will wohl andeuten, dass der Athenaeum Club mich irgendwie zu einem besseren Menschen machen könnte. »Ich werde Sie vorschlagen. Also gut. Das würde Ihnen doch sicher gefallen?« Und zu Guinness gewandt, als wir drei im Eingang des Restaurants stehen: »Es war mir ein Vergnügen, Alec. Eine Ehre, wirklich. Wir hören voneinander, schon bald, da bin ich mir sicher.«
»Ganz sicher«, erwidert Guinness ergebenst, und die beiden alten Spione schütteln sich die Hand.
Guinness hat offenbar noch nicht genug von unserem entschwindenden Gast und sieht Oldfield liebevoll hinterher, wie er über den Bürgersteig davonstapft: ein kleiner, energischer Mann voller Entschiedenheit, der mit nach vorn gerecktem Regenschirm ausschreitet und in der Menge verschwindet.
»Wie wär’s noch mit einem letzten Cognac?«, schlägt Guinness vor; wir haben kaum unsere Plätze wieder eingenommen, als das Verhör schon beginnt: »Diese äußerst vulgären Manschettenknöpfe. Tragen alle unsere Spione so etwas?«
Nein, Alec, ich nehme an, Maurice mag einfach vulgäre Manschettenknöpfe.
»Und diese schrillen orangefarbenen Wildlederschuhe mit den Kreppsohlen. Zur Tarnung?«
Ich schätze, die trägt er nur, weil sie bequem sind, Alec. Kreppsohlen quietschen.
»Dann verraten Sie mir doch eins.« Guinness nimmt sich ein leeres Whiskeyglas. Er kippt es ein wenig und tippt mit seiner breiten Fingerspitze dagegen. »Ich habe schon Leute gesehen, die so machen« – er schaut versunken ins Glas und tippt weiter dagegen – »und so« – jetzt streicht er mit ungebrochener Hingabe mit dem Finger um den Glasrand herum. »Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so etwas tut« – er steckt den Finger ins Glas und fährt an der Innenseite entlang. »Glauben Sie, dass er nach Spuren von Gift sucht?«
Meint Sir Alec das ernst? Aber ja, das Kind im Mann meint es todernst. Nun, wenn er nach Giftspuren suchte, dann hat er das Gift allerdings schon vorher getrunken, deute ich an. Doch darauf geht Guinness gar nicht erst ein.
Es gehört zum Anekdotenschatz der Unterhaltungsbranche, dass Oldfields Wildlederschuhe, ob nun mit Kreppsohle oder ohne, und sein zusammengefalteter, nach vorn gereckter Regenschirm, mit dem er sich seinen Weg bahnt, wesentliche Elemente der Ausstattung von Guinness wurden, als er George Smiley darstellte, den alten Spion, der es eilig hat. Die Manschettenknöpfe habe ich nicht kontrolliert, aber wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dann fand unser Regisseur sie ein wenig zu protzig und überredete Guinness dazu, sie gegen etwas weniger Auffälliges einzutauschen.
Ein anderes Ergebnis unserer Mahlzeit war weniger erfreulich, wenn auch künstlerisch ergiebiger. Oldfields Abneigung gegen meine Arbeit – und wie ich fürchte, auch mich persönlich – grub sich tief in Guinness’ Schauspielerseele ein, und er war sich nicht zu schade, mich, wann immer ihm danach war, daran zu erinnern, indem er mir George Smileys persönliche Schuldgefühle vorhielt; er sah in ihnen wohl, wie er gern andeutete, meine eigenen.
* Mein Dank gilt hier Christopher Andrews ›Secret Service‹, William Heinemann, 1985.
In den letzten hundert und mehr Jahren haben unsere britischen Spione eine verzweifelte und manchmal urkomische Hassliebe zu ihren aufsässigen Romanautoren gehegt. Genau wie die Autoren hüten sie ihr Image und wünschen sich Ruhm, aber wehe, jemand mutet ihnen zu, Spott oder negative Kritik zu ertragen. In den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts schürten Spionageschriftsteller wie Erskine Childers, William Le Queux und E. Phillips Oppenheim einen derart antideutschen Hass, dass sie wohl durchaus zu Recht für sich beanspruchen können, bei der Geburt eines etablierten Geheimdienstes geholfen zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt lasen Gentlemen angeblich nicht die Post anderer Gentlemen; in Wirklichkeit taten genau das aber viele Gentlemen. Während des Ersten Weltkriegs tauchte der Schriftsteller Somerset Maugham als britischer Geheimagent auf, wenn er auch den meisten Darstellungen zufolge kein sehr guter war. Als Winston Churchill klagte, dass Maughams Agent Ashenden gegen den Official Secrets Act* verstoßen würde, verbrannte Maugham, über dem zudem noch das Damoklesschwert eines Skandals wegen seiner Homosexualität schwebte, vierzehn unveröffentlichte Kurzgeschichten und hielt die Veröffentlichung aller anderen bis 1928 zurück.
Compton Mackenzie, Schriftsteller, Biograph und schottischer Nationalist, war nicht so leicht einzuschüchtern. Nachdem er wegen einer Kriegsverletzung im Ersten Weltkrieg ausgemustert worden war, wechselte er zum MI6 und wurde zum fähigen Leiter der britischen Gegenspionage im neutralen Griechenland. Allerdings fand er seine Befehle und Vorgesetzten allzu oft absurd und nutzte sie, sich einen Spaß mit ihnen zu machen, wie Schriftsteller das nun mal gerne tun. 1932 wurde er nach dem Official Secrets Act für seine autobiographischen Greek Memories zu einer Geldstrafe von hundert Pfund verurteilt; in der Tat war das Buch gespickt mit ungeheuerlichen Indiskretionen. Statt etwas daraus zu lernen, nahm er ein Jahr später mit dem satirischen Roman Water on the Brain Rache. Ich habe mir erzählen lassen, dass es in Mackenzies Akte beim MI5 einen in riesigen Buchstaben getippten Brief gibt, der an den Director General adressiert und mit der traditionellen grünen Tinte des Geheimdienstchefs unterzeichnet ist:
* Diese Korrespondenzen begannen üblicherweise mit einem dreistelligen Zahlencode für die jeweilige MI6-Station, gefolgt von einer Zahl für den betreffenden Dienstangehörigen.
»Am schlimmsten aber ist«, schreibt der Chef an seine Waffenbrüder auf der anderen Seite des St. James’ Parks, »dass Mackenzie doch tatsächlich jene Symbole verraten hat, die in der Korrespondenz des Geheimdienstes* angewendet werden und zum Teil noch immer in Gebrauch sind.« Mackenzies Geist wird sich die Hände vor diebischer Freude reiben.
Der eindrucksvollste aller literarischen Überläufer des MI6 ist aber sicherlich Graham Greene, auch wenn ich bezweifle, ob er wirklich wusste, dass er fast wie Mackenzie vor Gericht gelandet wäre. Eine meiner schönsten Erinnerungen an die späten 50er Jahre dreht sich darum, wie ich einen Kaffee mit dem Anwalt des MI5 in der ausgezeichneten Kantine des Security Service trinke. Der Mann war ein gutmütiger Pfeifenraucher, mehr Familienanwalt denn Bürokrat, doch an jenem Vormittag wirkte er äußerst aufgewühlt. Ein Vorabexemplar von Unser Mann in Havanna war auf seinem Schreibtisch gelandet, und er hatte es schon zur Hälfte gelesen. Ich meinte, ich würde ihn darum beneiden, doch er seufzte nur und schüttelte den Kopf. Man werde diesen Greene, behauptete er, strafrechtlich verfolgen müssen. Er habe Informationen, die er als Beamter des MI6 während des Krieges erhalten habe, dazu verwendet, die Beziehungen zwischen einem Geheimdienstchef an einer britischen Botschaft und einem Außenagenten darzustellen. Dafür werde er ins Gefängnis wandern.
»Dabei ist es ein gutes Buch«, klagte er. »Ein verflixt gutes Buch. Das ist ja das Problem.«
Ich durchforstete die Zeitungen nach Meldungen von Greenes Verhaftung, doch er blieb auf freiem Fuß. Vielleicht hatten die Granden des MI5 beschlossen, dass es besser sei zu lachen, statt zu weinen. Für diese Nachsicht belohnte Greene sie zwanzig Jahre später mit Der menschliche Faktor, da werden sie einmal nicht als Trottel dargestellt, sondern als Mörder. Doch der MI6 muss ihm einen Schuss vor den Bug verpasst haben. Im Vorwort zu Der menschliche Faktor versichert Greene ausdrücklich, dass er nicht gegen den Official Secrets Act verstoßen habe. Wenn Sie eine neuere Ausgabe von Unser Mann in Havanna aufschlagen, finden Sie dort eine ähnliche Erklärung.
Doch die Geschichte legt nahe, dass uns unsere Sünden eines Tages vergeben werden. Mackenzie wurde am Ende zum Ritter geschlagen, Greene erhielt den Order of Merit.
»In Ihrem neuen Roman, Sir«, fragte mich ein eifriger amerikanischer Journalist, »taucht ein Mann auf, der über Ihre Hauptfigur sagt, er wäre kein Verräter geworden, hätte er schreiben können. Würden Sie mir bitte verraten, was aus Ihnen geworden wäre, hätten Sie nicht schreiben können?«
Während ich nach einer unverfänglichen Antwort auf diese gefährliche Frage suche, überlege ich, ob unsere Geheimdienste nicht eigentlich froh über ihre literarischen Deserteure sein sollten. Im Vergleich zu dem Radau, den wir vielleicht mit anderen Mitteln geschlagen hätten, ist die Schriftstellerei doch so harmlos, als würden wir mit Bauklötzen spielen. Wie sehr sich unsere armen überlasteten Spione wohl wünschen, dass Edward Snowden es vorgezogen hätte, einen Roman zu schreiben.
Was hätte ich also bei der Diplomatenparty meinem wutentbrannten Exkollegen antworten sollen, als er mich anstarrte, als wolle er mich gleich zu Boden schlagen? Es hätte sicherlich nichts gebracht, ihn darauf hinzuweisen, dass ich in einigen Büchern den britischen Geheimdienst als deutlich kompetentere Organisation dargestellt habe, als ich sie im wahren Leben kennengelernt hatte. Und wohl auch nicht, dass einer seiner höchsten Beamten sagte, Der Spion, der aus der Kälte kam sei »der einzige Einsatz eines verfluchten Doppelagenten, der jemals funktioniert hat«. Und auch nicht, dass ich mit der Beschreibung der nostalgischen Kriegsspielchen einer isolierten britischen Abteilung in diesem Roman, der ihn so aufgebracht hatte, vielleicht etwas Ambitionierteres im Sinn hatte als nur einen plumpen Angriff auf seine Dienststelle. Der Himmel stehe mir bei, wenn ich behaupten würde, dass es für einen Schriftsteller, der sich darum bemüht, die Seele eines Landes zu erforschen, überhaupt keinen Sinn ergäbe, sich einmal den Geheimdienst vorzunehmen. Der Blitz würde mich treffen, bevor ich zu Ende sprechen könnte.
Und wenn es darum geht, dass sein Dienst sich nicht wehren könne, nun, ich nehme mal an, dass es keinen Geheimdienst in der westlichen Welt gibt, der von seinen Medien mehr umsorgt wird als der unsere. ›Embedded‹ trifft es nur unzureichend. Unsere Selbstzensur, ob nun aus eigenem Antrieb oder durch eine vage, drakonische Gesetzgebung angespornt, die Fertigkeit, raffiniert auf unsere Medien Einfluss zu nehmen, und die Tatsache, dass die britische Öffentlichkeit eine umfassende, auf zweifelhafter Legitimität fußende Überwachung einfach so hinnimmt, erfüllen jeden Spion in der freien und unfreien Welt mit blankem Neid.
Es würde wohl auch nichts nützen, wenn ich auf die vielen ›abgesegneten‹ Memoiren ehemaliger Angehöriger des Geheimdienstes verweise, die den Dienst in der Form präsentieren, in der er gern bewundert werden möchte, oder auf die ›offiziellen Darstellungen‹, die einen Schleier der Vergebung über seine besonders abscheulichen Verbrechen breiten. Und wohl auch nicht, wenn ich auf die zahllosen zusammengestoppelten Artikel in unseren überregionalen Zeitungen aufmerksam mache, die nach erheblich angenehmeren Zusammentreffen entstanden sind als jenem Mittagessen, das ich mit Maurice Oldfield erlebt habe.
Und wenn ich meinem wütenden Bekannten nun sagte, dass ein Schriftsteller der Gesellschaft einen kleinen Dienst erweist? Gerade weil er Berufsspione als fehlbare Menschen darstellt, die so sind wie wir anderen auch. Vielleicht erfüllt er sogar, Gott bewahre, einen demokratischen Auftrag, wo doch in Großbritannien die Spionagedienste noch immer, auf Gedeih und Verderb, geistige Heimat unserer politischen, gesellschaftlichen und industriellen Elite sind.
Denn weiter, werter ehemaliger Kollege, reicht meine Illoyalität nicht. Und weiter, werter verschiedener Lord Healey, reicht mein Kommunismus nicht, was man, wenn ich so darüber nachdenke, von Ihnen in Ihrer Jugend nicht sagen kann.
Es ist schwierig, ein halbes Jahrhundert später die Atmosphäre des Misstrauens zu vermitteln, die in den Fluren der geheimen Macht in Whitehall während der späten 50er und frühen 60er herrschte. Als ich 1956 formell als junger Beamter in den MI5 aufgenommen wurde, war ich fünfundzwanzig. Noch jünger, so sagte man mir, hätte ich nicht sein dürfen. Five, wie wir den Dienst nannten, bildete sich etwas auf seine Reife ein. Leider bot kein noch so hohes Maß an Reife Schutz davor, solche Koryphäen wie Guy Burgess, Anthony Blunt und all die anderen traurigen Verräter jener Zeit anzuheuern, deren Namen im kollektiven britischen Gedächtnis nachhallen wie die halbvergessener Fußballspieler.
Ich war mit großen Erwartungen in den Dienst eingetreten. Meine bisherigen geheimen Heldentaten, so belanglos sie auch gewesen sein mochten, hatten meinen Hunger nach mehr geweckt. Meine Führungsoffiziere waren durchwegs höflich, tüchtig und aufmerksam gewesen. Sie hatten mein Gefühl angesprochen, für diese Aufgabe bestimmt zu sein, und mein Pflichtbewusstsein als gescheiterter Privatschüler neu geweckt. Als Nachrichtenoffizier in Österreich wurde ich ganz ehrfürchtig bei den undurchsichtigen Zivilisten, die in regelmäßigen Abständen in unserem langweiligen Feldlager in Graz auftauchten und ihm einen geheimnisvollen Glanz verliehen, der ihm ansonsten vollkommen abging. Erst als ich in die Zentrale kam, landete ich hart auf dem Boden der Tatsachen.
Eine vor dem Zerfall stehende 25 000 Mitglieder starke britische kommunistische Partei auszuspionieren, die mühsam durch MI5-Spitzel zusammengehalten werden musste, entsprach so gar nicht meinen Vorstellungen. Ebenso wenig wie die Doppelmoral, mit der der Dienst seine eigenen Ansprüche nährte. MI5 war, im Guten wie im Bösen, der Sittenrichter über das Privatleben der Beamten und Wissenschaftler des Landes. Bei den damals erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen galten Homosexuelle und andere vermeintlich Perverse als erpressungsgefährdet, und deshalb schloss man sie von der Geheimdienstarbeit aus. Zugleich aber schien der Dienst kein Problem damit zu haben, die Augen vor den Homosexuellen in den eigenen Reihen zu verschließen, und der Generaldirektor lebte unter der Woche offen mit seinem Sekretär und an den Wochenenden mit seiner Frau zusammen; das Ganze ging sogar so weit, dass er den nachts Diensthabenden schriftlich dazu anwies, was er sagen sollte, falls die Gattin anrief und wissen wollte, wo ihr Mann war. Doch wehe der Schreibkraft in der Registratur, deren Rock man zu kurz oder zu eng fand, oder dem verheirateten Beamten, der ihr schöne Augen machte.
Während die oberen Ränge mit alternden Überlebenden der glorreichen Tage von 1939 bis 1945 besetzt waren, rekrutierten sich die mittleren Dienstgrade aus ehemaligen Polizisten und Verwaltungsbeamten aus dem schrumpfenden Kolonialreich. So erfahren diese auch sein mochten, wenn es darum ging, aufmüpfige Eingeborene zu bezwingen, die die Frechheit besaßen, ihr Land zurückzufordern, so wenig behagte es ihnen, das Mutterland zu beschützen, das sie kaum kannten. Die britische Arbeiterklasse kam ihnen so flatterhaft und unverständlich vor wie einst die aufständischen Derwische. Gewerkschaften waren in ihren Augen nichts weiter als kommunistische Tarnorganisationen.
Jungen Agentenjägern wie mir, die nach kräftigerer Kost verlangten, wurde befohlen, ihre Zeit nicht damit zu vergeuden, nach von Sowjets kontrollierten ›Illegalen‹ zu suchen, da es als unumstößliche Wahrheit galt, dass solche Spione nicht auf britischem Boden operierten. Wer das wusste und von wem, erfuhr ich nie. Vier Jahre waren genug. 1960 bat ich um meine Versetzung zum MI6, oder wie meine verärgerten Dienstherren sich ausdrückten, zu »diesen Arschlöchern auf der anderen Seite des Parks«.
Doch lassen sie mich zum Abschied vom MI5 einen Punkt ansprechen, für den ich dem Dienst nicht dankbar genug sein kann. Die strengste Anleitung zum Schreiben von Prosa, die ich je bekam, erteilte mir nicht irgendein Lehrer in der Schule oder Tutor an der Universität, schon gar nicht erhielt ich sie in den Schreibkursen. Die bekam ich bei den humanistisch gebildeten, diensthöheren Beamten im obersten Stock der Zentrale des MI5 in der Curzon Street in Mayfair. Sie schnappten sich meine Berichte mit hämischer Pedanterie, taten meine in der Luft hängenden Halbsätze und überflüssigen Adverbien verächtlich ab, und die Seitenränder meiner unsterblichen Prosa versahen sie mit Bemerkungen wie »redundant«, »weglassen«, »begründen«, »schlampig« oder »wollten Sie das wirklich sagen?«. Keiner der Lektoren, mit denen ich seitdem arbeitete, stellte jemals so hohe, so berechtigte Anforderungen.
Im Frühling 1961 beendete ich den Einführungskurs beim MI6, in dem ich Fertigkeiten erlernt habe, die ich niemals brauchte und schnell wieder vergaß. Bei der Abschlusszeremonie teilte uns der Ausbildungsleiter, ein kräftiger, in Tweed gekleideter Veteran mit rosigem Gesicht und Tränen in den Augen, mit, dass wir nach Hause gehen und auf weitere Befehle warten sollten. Es könne dauern. Der Grund war – und er hätte sich in seinen schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen können, das jemals sagen zu müssen –, ein langjähriger Beamter des Dienstes, der uneingeschränktes Vertrauen genossen hatte, war als sowjetischer Doppelagent enttarnt worden. Sein Name lautete George Blake.
Das Ausmaß von Blakes Verrat war gewaltig und ist es selbst nach heutigen Maßstäben: Er hatte buchstäblich Hunderte von britischen Agenten verraten – Blake selbst konnte nicht mehr überschlagen, wie viele; schon vor ihrem Beginn waren geheime Abhörmaßnahmen geplatzt, die für die nationale Sicherheit als wichtig erachtet wurden, wie der Spionagetunnel in Berlin, um nur ein Beispiel zu geben; dazu kam der komplette Ausfall des Einsatzpersonals des MI6, der sicheren Zufluchtsstätten, der Einsatzpläne und Außenstationen rund um den Globus. Blake, ein äußerst fähiger Agent auf beiden Seiten, war zudem auf Sinnsuche und hatte zum Zeitpunkt seiner Enttarnung (in dieser Reihenfolge) dem Christentum, dem Judentum und dem Kommunismus angehangen. Während seiner Haftzeit in Wormwood Scrubs, aus dem ihm später eine so spektakuläre Flucht gelang, erteilte er seinen Zellengenossen Einführungen in den Koran.
Zwei Jahre nach den verstörenden Nachrichten über George Blakes Verrat arbeitete ich als Zweiter Sekretär (Politik) an der britischen Botschaft in Bonn. Mein dortiger Standortleiter rief mich eines späten Abends in sein Büro und teilte mir mit, was jeder Engländer am folgenden Tag in der Zeitung lesen sollte: Kim Philby, der brillante ehemalige Kopf der Gegenspionage beim MI6, einst aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des Geheimdienstchefs, war ebenfalls russischer Spion, und zwar, wie wir erst nach und nach erfahren sollten, schon seit 1937.
An anderer Stelle in diesem Buch finden Sie einen Bericht von Nicholas Elliott, Philbys engem Freund, Vertrauten und Kollegen im Krieg wie im Frieden, über deren letzte Begegnung in Beirut, die schließlich zu einem Teilgeständnis Philbys führen sollte. Vielleicht fällt Ihnen dabei auf, dass Elliotts Bericht rätselhafterweise nicht die Spur von Zorn oder Entrüstung aufweist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Spione sind keine Polizisten, und sie sind auch nicht die moralischen Realisten, für die sie sich gern halten. Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, für die eigenen Ziele Verräter zu gewinnen, dann können Sie sich schlecht darüber beklagen, wenn sich bei einem der Ihren herausstellt, dass er von jemand anderem akquiriert wurde, selbst wenn Sie ihn wie einen Bruder geliebt oder als Kollegen geschätzt und sämtliche Seiten der Geheimarbeit mit ihm geteilt haben. Diese Lektion hatte ich mir zu Herzen genommen, als ich Der Spion, der aus der Kälte kam schrieb. Auch später bei Dame, König, As, Spion leuchtete mir Kim Philbys trübes Licht den Weg.
Spionagetätigkeit und Schriftstellerei sind wie füreinander geschaffen. Beide erfordern sie ein waches Auge für menschliche Verfehlungen und die vielen Wege hin zum Verrat. Jene unter uns, die irgendwann einmal zum inneren Kreis der Geheimniskrämerei gehört haben, werden ihn nie wieder verlassen. Wenn wir die dort herrschenden Gewohnheiten nicht schon teilten, bevor wir eintraten, gingen sie uns hier in Fleisch und Blut über. Zum Beweis dafür brauchen wir nur an Graham Greene und die Anekdoten rings um sein selbstverschuldetes Versteckspiel mit dem FBI zu denken. Vielleicht sind sie von einem seiner ungnädigeren Biographen festgehalten worden; danach zu suchen lohnt nicht die Mühe.
Sein ganzes späteres Leben lang war Greene, der Schriftsteller und ehemalige Agent, davon überzeugt, auf der Schwarzen Liste des FBI zu stehen. Für diese Annahme hatte er gute Gründe, angesichts seiner zahlreichen Besuche in der Sowjetunion, seiner fortgesetzten und unverblümten Loyalität gegenüber seinem Freund und Agentenkollegen Kim Philby und seiner vergeblichen Bemühungen, Katholizismus und Kommunismus unter einen Hut zu bringen. Als die Berliner Mauer errichtet wurde, ließ sich Greene auf der falschen Seite ablichten und verkündete der Welt, er sei lieber hier als dort. Tatsächlich erreichten Greenes Aversion gegen die Vereinigten Staaten und seine Furcht vor den Konsequenzen seiner radikalen Äußerungen ein derartiges Ausmaß, dass er darauf bestand, alle Treffen mit seinem amerikanischen Verleger auf die kanadische Seite der Grenze zu verlegen.
Doch irgendwann kam der Tag, als er endlich Einsicht in seine FBI-Akte verlangen konnte. Sie enthielt nur einen Eintrag: Er hatte der politisch sprunghaften britischen Ballerina Margot Fonteyn beigestanden, als sie den zum Scheitern verurteilten Kampf für ihren gelähmten und treulosen Mann Roberto Arias führte.
Nicht die Spionage lehrte mich Verschwiegenheit. Ausflüchte und Täuschungsmanöver waren die wichtigsten Waffen meiner Kindheit. In der Jugend sind wir alle irgendwie Spione, aber ich hatte schon Erfahrung. Als mich die Welt der Geheimnisse holte, kam das für mich einer Heimkehr gleich. Warum das so war, hat seinen richtigen Platz erst in dem späteren Kapitel »Der Sohn des Vaters des Autors«.
2
Globkes Gesetze
Blödes Bonn, so nannten wir jungen britischen Diplomaten den Ort Anfang der 60er, nicht aus Gründen einer speziellen Respektlosigkeit gegenüber dem verschlafenen Städtchen, einst Residenz des Kölner Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und Geburtsort Ludwig van Beethovens, sondern eher aus Skepsis gegenüber den absurden Träumen unserer Gastgeber, den Sitz der Hauptstadt Deutschlands irgendwann einmal nach Berlin zu verlegen, Träume, die wir ihnen im sicheren Bewusstsein, dass dies niemals eintreten würde, gern gönnten.
1961 hatte die britische Botschaft, ein stilloser Gebäudeblock einer Fabrik entlang der Bundesstraße zwischen Bonn und Bad Godesberg, dreihundert Mitarbeiter, von denen allerdings die meisten zu Hause arbeiteten, nicht vor Ort. Bis heute habe ich keine Ahnung, was die anderen von uns Jungdiplomaten in dieser stickigen rheinischen Atmosphäre so trieben. Doch kam es während dieser drei Jahre in Bonn für mich zu derart maßgeblichen Veränderungen in meinem Leben, dass ich heute den Eindruck habe, Bonn war der Ort, an dem meine Vergangenheit zu Ende ging und meine Karriere als Schriftsteller begann.
Zwar war zu diesem Zeitpunkt mein erster Roman bereits in London von einem Verlag angenommen worden, doch seinen bescheidenen Auftritt hatte das Buch erst, nachdem ich bereits ein paar Monate in Bonn verbracht hatte. Ich weiß noch, dass ich an einem diesigen Sonntagnachmittag zum Flughafen Köln/Bonn fuhr und mir die britischen Zeitungen kaufte, um dann den Wagen in Bonn abzustellen, mich auf eine geschützte Parkbank zu setzen und die Besprechungen für mich allein zu lesen. Die Rezensenten waren gnädig mit mir, wenn auch nicht so enthusiastisch, wie ich gehofft hatte. Sie waren einverstanden mit George Smiley. Das war dann plötzlich auch schon alles.
Wahrscheinlich kommen alle Schriftsteller irgendwann im Laufe ihres Lebens an diesen Punkt: all die Wochen und Monate voller Verzweiflung und falscher Ansätze; das kostbare fertige Manuskript; der schon rituelle Enthusiasmus von Agent und Verleger; das Lektorat; die hohen Erwartungen; die Angst vor dem großen Tag; die Besprechungen, und plötzlich ist alles vorüber. Du hast das Buch vor einem Jahr geschrieben, warum also sitzt du jetzt hier herum, statt ein neues Buch zu schreiben?
Ehrlich gesagt, genau das tat ich.
Ich hatte einen Roman begonnen, der in einer Privatschule spielt. Als Hintergrund dienten mir Sherborne, wo ich Schüler, und Eton, wo ich Lehrer gewesen war. Es gibt einen Hinweis, dass ich die Arbeit an diesem Roman bereits aufgenommen hatte, als ich noch in Eton unterrichtete, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Da ich für gewöhnlich zu einer unchristlichen Zeit aufstand, bevor ich mich auf den Weg in die Botschaft machte, wurde ich binnen kurzem mit dem Text fertig und reichte ihn ein. Wieder eine Arbeit geschafft – aber beim nächsten Mal, hatte ich beschlossen, würde ich etwas mutiger werden. Ich wollte über die Welt vor meiner Haustür schreiben.
Nach einem Jahr en poste umfasste mein Aufgabenbereich ganz Westdeutschland, und ich hatte völlige Bewegungsfreiheit und überall ungehinderten Zugang. Als einer der Wanderprediger der Botschaft für Großbritanniens Eintritt in den Gemeinsamen Markt konnte ich mich selbst in die Rathäuser, zu den politischen Gesellschaften und in die Vorzimmer der Bürgermeister im ganzen Land einladen. Angesichts der Entschlossenheit des jungen Westdeutschlands, sich als offene, demokratische Gesellschaft zu zeigen, standen dem neugierigen, jungen Diplomaten alle Türen offen. Ich konnte den ganzen Tag auf der Diplomatengalerie des Bundestags sitzen und mit den Parlamentsreportern und -beratern zu Mittag essen. Ich konnte an die Türen der Ministerien klopfen, an Protestkundgebungen ebenso teilnehmen wie an abgehobenen Wochenendseminaren über Kultur und deutsche Seele; die ganze Zeit über versuchte ich, auszuloten, wo das alte Deutschland endete und das neue begann. 1961 war das nicht ganz einfach. Zumindest nicht für mich.
Ein Zitat des Bundeskanzlers Konrad Adenauer, gern als ›der Alte‹ apostrophiert, der das Amt von der Gründung der Bundesrepublik 1949 bis zum Jahr 1963 bekleidete, fasste mein Problem wunderbar zusammen: »Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat.« Es wird allgemein angenommen, dass der Satz sich indirekt auf Dr. Hans Josef Maria Globke bezieht, seine graue Eminenz in Fragen der nationalen Sicherheit – und nicht nur in dem Zusammenhang. Selbst nach Nazi-Maßstäben war Globkes Bilanz beeindruckend. Noch vor Hitlers Machtergreifung hatte er sich dadurch hervorgetan, dass er antisemitische Gesetze für das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern entwarf.
Zwei Jahre später war er unter seinem neuen Führer an der Formulierung der Nürnberger Gesetze beteiligt, die allen Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzog und sie aus Gründen der Identifikation zwang, die zusätzlichen Namen Sara oder Israel zu tragen. Nichtjuden, die mit Juden verheiratet waren, wurde befohlen, sich von ihren Partnern zu trennen. Während Globke unter Adolf Eichmann im Referat für Judenangelegenheiten arbeitete, saß er an der Ausarbeitung eines neuen Gesetzes »zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«, dem Startsignal für den Holocaust.
Gleichzeitig schaffte Globke es, aufgrund seines strengen Katholizismus, nehme ich an, sich die Rückendeckung rechtsgerichteter Widerstandsgruppen zu sichern; das ging so weit, dass er für höchste Ämter vorgesehen war, falls die Verschwörer Hitler erfolgreich losgeworden wären. Vielleicht konnte er deshalb nach Kriegsende den halbherzigen Versuchen der Alliierten entkommen, ihn vor Gericht zu stellen. Adenauer wollte Globke an seiner Seite haben. Die Briten traten Globke nicht in den Weg.
So kam es, dass 1951, gerade einmal sechs Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, Dr. Hans Globke eine Gesetzesinitiative zugunsten seiner früheren und gegenwärtigen Nazi-Kollegen durchbrachte, die heute unbegreiflich ist. Durch Globkes Neues Gesetz, wie ich es nennen möchte, erhielten Beamte des Hitlerregimes, deren Laufbahnen aufgrund von Umständen unterbrochen worden waren, die sich ihrer Kontrolle entzogen, die völlige Restitution von Gehalt, Gehaltsnachzahlung und Pensionsansprüchen, die sie genossen hätten, wenn der Zweite Weltkrieg entweder nicht stattgefunden oder Deutschland ihn gewonnen hätte. Kurz gesagt, sie hatten Anrecht auf jede Beförderung, die sie hätten erwarten können, wäre ihre Beamtenlaufbahn weitergegangen und nicht durch einen Sieg der Alliierten beeinträchtigt worden.
Die Wirkung zeigte sich unmittelbar. Die alte Nazi-Garde klammerte sich an die besten Posten. Die jüngere, weniger bescholtene Generation wurde zu einem Leben auf den unteren Sprossen der Leiter verdonnert.
Auftritt Dr. Johannes Ullrich, Gelehrter, Archivar, Liebhaber von Bach, gutem roten Burgunder und preußischer Militärgeschichte. Im April 1945, ein paar Tage bevor Berlins letzter Stadtkommandant sich den Russen bedingungslos ergab, tat Ullrich, was er in den zehn Jahren davor auch schon getan hatte: Er verfolgte fieberhaft seine Arbeit als Kurator und Archivar im Politischen Archiv im Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße. Da das Kaiserreich 1918 untergegangen war, war kein Dokument, das durch seine Hände ging, jünger als siebenundzwanzig Jahre.
Ich kenne kein Foto von Ullrich aus seiner Jugend, doch stelle ich ihn mir als recht athletischen Burschen vor, streng gekleidet in den Anzügen und mit den steifen Kragen jener lang vergangenen Zeit, die seine geistige Heimat bildete. Seit Hitlers Machtergreifung war er dreimal gedrängt worden, in die Partei einzutreten, und hatte sich dreimal geweigert. Er blieb also, was er war, Archivar, bis General Schukows Rote Armee im Frühling 1945 zur Wilhelmstraße vordrang. Die sowjetischen Truppen, die Berlin eroberten, waren nicht daran interessiert, Gefangene zu machen, aber das Auswärtige Amt lockte mit hochrangigen Personen ebenso wie mit belastenden Dokumenten.
Was Johannes tat, als die Russen vor seiner Tür standen, ist heute Legende. Er wickelte wichtige Archivalien des Auswärtigen Amtes in Ölzeug ein, packte sie auf einen Handkarren und schob ihn, ohne auf den Geschosshagel von Handfeuerwaffen, Mörsern und Granaten zu achten, zu einem Stück offenen Geländes mit weichem Untergrund, vergrub die Unterlagen dort und kehrte auf seinen Posten zurück, um sich vom Fleck weg gefangennehmen zu lassen.
Der Vorwurf der Anklage gegen ihn war nach Maßstäben der sowjetischen Militärjustiz unwiderlegbar. Als Hüter von Nazi-Akten war er per Definition ein Handlanger der faschistischen Aggression. Von den darauf folgenden zehn Jahren in Sibirien verbrachte er sechs in Einzelhaft und den Rest in einer Gemeinschaftszelle mit kriminellen Irren, deren Verhaltensauffälligkeiten er nachahmte, um zu überleben.
1955 kam er im Rahmen der Rückführung der ›Heimkehrer‹ frei. Kaum war er in Berlin eingetroffen, leitete er einen Suchtrupp an die Stelle, wo er das Archiv vergraben hatte, und beaufsichtigte dessen Ausgrabung. Danach zog er sich zur Erholung zurück.
Zurück zu Globkes Neuem Gesetz.
Welche Ansprüche konnte denn Ullrich, dieser treue Staatsdiener aus der Nazizeit, dieses Opfer bolschewistischer Brutalität geltend machen? Lassen wir einmal die Tatsache außer Acht, dass er sich dreimal geweigert hat, in die Partei einzutreten. Vergessen wir, dass seine Abscheu vor allem Nazitum ihn immer tiefer in die preußische Vergangenheit getrieben hatte. Fragen Sie sich lieber, welche Höhen ein junger Archivar mit glänzenden akademischen Zeugnissen noch hätte erreichen können, wenn das Dritte Reich fortbestanden hätte.
Johannes Ullrich, der zehn Jahre lang nichts anderes von der Welt gesehen hatte als die Wände seiner sibirischen Zelle, wurde eingestuft, als hätte er seine gesamte Zeit im Kerker als aufstrebender Diplomat verbracht. Er hatte also Anspruch auf die Gehaltserhöhungen, die er mit den Beförderungen bekommen hätte, dazu die Nachzahlungen, Zuschüsse, Pensionsansprüche und – der größte Anreiz in jeder Beamtenlaufbahn – ein Büro, das seinem Status entsprach. Oh, und auf ein Jahr bezahlten Urlaub, mindestens.
Johannes erholt sich und liest sich tief in die preußische Geschichte ein. Er entdeckt seine Liebe zu rotem Burgunder wieder und heiratet eine entzückend humorvolle belgische Dolmetscherin, die ihn vergöttert. Doch schließlich kommt der Tag, an dem er nicht länger den Ruf der Pflicht, fester Bestandteil seiner preußischen Seele, überhören kann. Er zieht einen neuen Anzug an, seine Frau bindet ihm die Krawatte und fährt ihn zum Auswärtigen Amt, das nun nicht mehr in der Wilhelmstraße in Berlin liegt, sondern in Bonn. Ein Hausmeister führt ihn in sein Büro. Kein Büro, beteuert er, sondern hochoffizielle Räumlichkeiten, mit einem riesigen Schreibtisch, den, so schwört er, Albert Speer entworfen hat. Herr Dr. Johannes Ullrich ist von nun an, ob es ihm gefällt oder nicht, Leiter des politischen Archivs im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn Sie sich ein Bild von Johannes Ullrich in Aktion machen wollen (ich hatte das große Glück, ihn bei mehreren Gelegenheiten zu treffen), dann stellen Sie sich einen gebeugten, energischen Mann Mitte fünfzig vor, so ruhelos, dass man sich lebhaft vorstellen kann, wie er in seiner Zelle in Sibirien auf und ab tigert. Mal wirft er Ihnen einen fragenden Blick über die Schulter zu, der impliziert, ob er es nicht übertreibt. Dann rollt er entsetzt über sein eigenes Verhalten mit den Augen, lacht laut auf und dreht mit wedelnden Armen noch eine Runde durch den Raum. Nein, er ist nicht verrückt wie seine armen Mitgefangenen in Sibirien. Er ist unfassbar, unerträglich normal, wieder einmal ist nicht er verrückt, sondern seine Umgebung.
Als Erstes muss zum Vergnügen der gebannt lauschenden Gäste in meinem Diplomatenquartier in Königswinter am Rhein jede Einzelheit seiner hochoffiziellen Räumlichkeiten penibelst beschrieben werden: der Bundesadler, schwarz, mit zur Seite gedrehtem Kopf und roten Krallen, der von der Wand finster auf ihn herabschaut – er ahmt für uns den herablassenden Blick und die hochgezogenen Schultern nach –, die einem Botschafter würdige Schreibtischgarnitur mit silbernem Tintenfass und Federschale.
Dann öffnet er eine imaginäre Schublade am riesigen Albert-Speer-Schreibtisch, zieht für uns das interne Telefonverzeichnis des Auswärtigen Amtes hervor, in feinstes Kalbsleder gebunden, wie er sagt. Er hält es uns mit leeren Händen hin, senkt andächtig den Kopf, schnuppert daran und rollt bewundernd mit den Augen.
Jetzt schlägt er das Verzeichnis auf. Ganz langsam. Jede Wiederholung dieser Szene ist für ihn ein Exorzismus, eine choreographierte Säuberung von all den Dingen, die ihm durch den Kopf gingen, als er zum ersten Mal die Liste der Namen sah. Es sind dieselben aristokratischen Namen und deren Träger, die schon unter dem grotesken Joachim von Ribbentrop ihre Sporen verdienten, unter Hitlers Außenminister, der noch aus seiner Todeszelle in Nürnberg seine Loyalität gegenüber Hitler verkündete.
Vielleicht sind aus diesen noblen Namen in der Zwischenzeit bessere Diplomaten geworden. Vielleicht sind sie bekehrte Anhänger der Demokratie. Möglicherweise haben sie wie Globke eine Abmachung mit irgendeiner Widerstandsgruppe getroffen, falls Hitler eines Tages stürzt. Aber Johannes ist jetzt wirklich nicht in der Stimmung, seine Kollegen in solch vorteilhaftem Licht zu sehen. Unter den Blicken meiner Gäste sinkt er in einen Sessel und trinkt einen Schluck von dem guten roten Burgunder, den ich ihm zu Ehren in einem für Diplomaten reservierten Geschäft gekauft habe. Er führt uns vor, was genau er an jenem Vormittag in seinen hochoffiziellen Räumlichkeiten gemacht hat, nachdem er zum ersten Mal in das kalbsledergebundene, vertrauliche, interne Telefonverzeichnis des Auswärtigen Amtes geblickt hatte: Er ließ sich in einen tiefen Ledersessel gleiten, das Telefonbuch aufgeschlagen in der Hand, las stumm einen herrschaftlichen Namen nach dem anderen, von links nach rechts, ganz langsam, all diese Vons und Zus. Wir beobachten, wie er die Augen aufreißt und die Lippen bewegt. Er starrt die Wand an. So habe ich die Wand in meinen hochoffiziellen Räumlichkeiten angestarrt, will er uns damit sagen. So habe ich die Wand in meinem sibirischen Gefängnis angestarrt.
Er springt von meinem Sessel auf, genauer gesagt, dem Sessel in seinen hochoffiziellen Räumlichkeiten. Er steht wieder an dem riesigen Albert-Speer-Schreibtisch, auch wenn es sich jetzt nur um eine wacklige Mahagonianrichte neben der Glastür handelt, die zu meinem Garten führt. Er schlägt das Telefonbuch auf dem Schreibtisch auf. Auf meiner wackligen Anrichte steht kein Telefon, doch Ullrich hat sich einen imaginären Hörer geschnappt und liest, dem Zeigefinger der freien Hand folgend, die erste hausinterne Nummer im Telefonbuch ab. Wir hören das Tuten des Freizeichens. Johannes Ullrich tutet durch die Nase. Wir sehen, wie er den breiten Rücken reckt, strammsteht und die Hacken in preußischer Manier zusammenschlägt. So laut, dass meine schlafenden Kinder eine Etage über uns aufwachen, bellt er militärisch:
»Heil Hitler, Herr Baron! Hier Ullrich! Ich möchte mich zurückmelden!«
Ich will nicht den Eindruck erwecken, ich hätte meine drei Jahre als Diplomat in Westdeutschland damit zugebracht, über alte Nazis in hohen Ämtern zu wettern, während mein Dienst alle Kraft darauf verwendete, Großbritanniens Außenhandel zu fördern und den Kommunismus zu bekämpfen. Falls ich gegen die alten Nazis gewettert habe – die so alt gar nicht waren, denn Anfang der 60er trennte uns gerade einmal eine halbe Generation von Hitler –, dann nur, weil ich mich mit den Deutschen meines Alters identifizierte, denn sie mussten sich bei den Leuten, die am Untergang ihres Landes beteiligt gewesen waren, anbiedern, wenn sie es im Leben zu etwas bringen wollten.
So fragte ich mich, wie ein ehrgeiziger junger Politiker mit dem Wissen zurechtkam, dass die oberen Ränge seiner Partei mit solchen Koryphäen geschmückt waren wie zum Beispiel Ernst Achenbach, der während der Besatzung als höherer Beamter an der deutschen Botschaft in Paris persönlich die Massendeportation französischer Juden nach Auschwitz beaufsichtigt hatte. Die Franzosen und die Amerikaner hatten versucht, ihn vor Gericht zu bringen, doch Achenbach war von Beruf Anwalt und hatte sich irgendeine fragwürdige Form von Dispens verschafft. Statt also in Nürnberg den Prozess gemacht zu bekommen, eröffnete er seine eigene lukrative Anwaltskanzlei und verteidigte Personen, denen genau solche Verbrechen vorgeworfen wurden, wie er sie selbst begangen hatte. Wie reagierte ein mir bekannter, ehrgeiziger junger deutscher Politiker darauf, dass jemand wie Achenbach seine Karriere verfolgte, fragte ich mich. Schluckte er nur und lächelte?
Neben all dem anderen, womit ich mich in meiner Zeit in Bonn und später in Hamburg beschäftigte, ließ mich Deutschlands unbewältigte Vergangenheit nicht los. Insgeheim gab ich mich durchaus nicht dem politischen Komment jener Zeit hin, auch wenn ich mich öffentlich daran hielt. In gewisser Hinsicht verhielt ich mich wohl wie viele Deutsche in den Kriegsjahren von 1939 bis 1945.
Aber nachdem ich Deutschland verlassen hatte, ließ mir das Thema keine Ruhe. Obwohl ich Der Spion, der aus der Kälte kam schon lange hinter mir hatte, kehrte ich 1964 nach Hamburg zurück und stöberte einen Kinderarzt auf, der angeklagt war, an den Euthanasieprogrammen der Nationalsozialisten beteiligt gewesen zu sein; das Dritte Reich sollte auf diese Weise von nutzlosen Essern befreit werden. Wie sich herausstellte, war der Fall gegen ihn von einem eifersüchtigen Kollegen haltlos zusammengelogen worden, und für mich endete die Sache mit einer Blamage. Im selben Jahr fuhr ich nach Ludwigsburg, um mit Erwin Schüle zu sprechen, dem Leiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Ich suchte nach einer Geschichte, wie sie sich später dann zu Eine kleine Stadt in Deutschland entwickeln sollte, war aber bislang nicht auf die Idee gekommen, dass die britische Botschaft in Bonn die Kulisse bilden könnte. Noch war mir die Erfahrung dort zu nah.
Erwin Schüle war genau so, wie er mir beschrieben worden war: korrekt, offen, engagiert. Sein gesamter Stab aus etwa einem halben Dutzend blasser Jungjuristen war nicht anders. Jeder hockte in seinem eigenen Kabuff und verbrachte lange Tage damit, die entsetzlichen Hinweise zu überprüfen, die aus den Nazi-Akten und den dürftigen Zeugenaussagen zusammengetragen worden waren. Ihr Ziel war, Gräueltaten konkreten Personen zuzuordnen, die ja im Gegensatz zu militärischen Einheiten vor Gericht gebracht werden konnten. Sie knieten vor Sandkästen und stellten Spielzeugfiguren auf, die mit Nummern versehen waren. In der einen Reihe Spielzeugsoldaten in Uniform mit Gewehren. In der anderen Spielzeugmänner, -frauen und -kinder in Alltagskleidung. Zwischen den beiden Reihen im Sand ein schmaler Graben, das Massengrab, das sich bald füllen sollte.
Am Abend luden mich Schüle und seine Frau zum Essen auf dem Balkon ihres Hauses ein, das an einem bewaldeten Hügel lag. Schüle sprach leidenschaftlich von seiner Arbeit. Es sei eine Berufung, sagte er, eine historische Notwendigkeit. Wir beschlossen, uns bald wieder zu treffen, doch dazu kam es nicht. Im Februar des folgenden Jahres stieg Schüle in Warschau aus einem Flugzeug. Er war eingeladen worden, um sich ein paar jüngst entdeckte Akten der Nationalsozialisten anzuschauen. Stattdessen erwartete ihn dort eine Vergrößerung seines Parteiausweises. Gleichzeitig lancierte auch die sowjetische Regierung eine Reihe von Angriffen gegen ihn, darunter der Vorwurf, er habe als Soldat an der Ostfront mit seiner Dienstwaffe zwei russische Zivilisten erschossen und eine Russin vergewaltigt. Auch hier erwiesen sich die Anschuldigungen als haltlos.
Und die Lektion daraus? Je intensiver man nach absoluten Wahrheiten sucht, desto schwieriger wird es, sie zu finden. Ich glaube, dass Schüle zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, ein anständiger Mann war. Aber er musste mit seiner Vergangenheit leben und sich damit auseinandersetzen, was immer auch am Ende dabei herauskam. Wie die Deutschen seiner Generation dies angingen, hat mich immer interessiert. Ich für meinen Teil war jedenfalls nicht überrascht, als die Zeit der RAF in Deutschland anbrach. Für viele junge Deutsche war die Vergangenheit der Eltern nur begraben, geleugnet oder einfach aus der Gegenwart hinausgelogen worden. Eines Tages musste das ja überkochen, und so war es auch. Und das betraf keineswegs nur ein paar ›Chaoten‹. Es handelte sich um eine ganze wütende Generation von enttäuschten Söhnen und Töchtern aus der Mittelklasse, die sich ins Schlachtgetümmel vorwagten und die Terroristen an der vordersten Front logistisch und moralisch unterstützten.
Könnte sich so etwas jemals in Großbritannien ereignen? Wir haben es schon vor langem aufgegeben, uns mit Deutschland zu vergleichen. Der Aufstieg des modernen Deutschlands als selbstsichere, nichtaggressive demokratische Macht – ganz zu schweigen von dem humanitären Vorbild – ist eine für viele von uns Briten zu bittere Pille, als dass man sie einfach schlucken könnte. Eine traurige Tatsache, die ich schon viel zu lange bedauere.
3
Offizieller Besuch
Zu den angenehmeren Aufgaben während meiner Zeit an der britischen Botschaft Anfang der 60er gehörte, Delegationen von vielversprechenden jungen Deutschen nach Großbritannien zu begleiten und den Bärenführer für sie zu spielen, wie man auf Deutsch sagt. Sie sollten von uns demokratische Umgangsformen erlernen und – so die große Hoffnung – uns darin nacheifern. Es waren hauptsächlich junge Politiker oder aufstrebende politische Journalisten, manche äußerst intelligent und, wie mir jetzt erst aufgeht, alles Männer.
Im Durchschnitt dauerte eine solche Tour eine Woche: Abreise Flughafen Köln/Bonn mit der Sonntagabendmaschine der BEA, Willkommensansprache eines Vertreters vom British Council oder Außenministerium, Rückflug am folgenden Samstagmorgen. Fünf vollgepackte Tage lang besuchten die Gäste beide Häuser des Parlaments, nahmen an der Fragestunde im Unterhaus teil, kamen zum Hohen Gerichtshof und vielleicht zur BBC; sie wurden von Ministern und Oppositionsführern empfangen, deren Rang zum Teil der Bedeutung der Delegation entsprach, manchmal aber auch der Laune der Gastgeber, und sie bekamen etwas von der ländlichen Schönheit Englands zu sehen (Windsor Castle, Runnymede wegen der Magna Carta und Woodstock, Oxfordshire, Musterbeispiel einer englischen Kleinstadt).
Abends hatten die Gäste die Wahl zwischen einem Theaterbesuch oder ihren Privatinteressen. Damit war gemeint – siehe die Informationsbroschüren des British Council –, dass katholische oder protestantische Delegierte sich mit ihren Glaubensbrüdern trafen, Sozialisten mit ihren Labour-Genossen, und wer noch speziellere Privatinteressen hegte – zum Beispiel die erwachende Wirtschaft der Dritten Welt –, konnte sich mit seinen britischen Pendants zusammensetzen. Für weitere Informationen oder bei anderen Wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren Reiseleiter und Dolmetscher, also an mich.
Die Wünsche ließen nicht lange auf sich warten. Und so kam es, dass ich in einer lauschigen Sommernacht gegen dreiundzwanzig Uhr am Empfangstresen eines Hotels im West End stand, mit einem Zehn-Pfund-Schein in der Hand, hinter mir ein halbes Dutzend ausgeruhter junger deutscher Parlamentarier, die nach weiblicher Gesellschaft verlangten. Sie waren seit vier Stunden in England, die meisten von ihnen zum ersten Mal. Alles, was sie wussten, war, dass sie nun in Swinging London waren, und sie brannten darauf, mitzuswingen. Ein Sergeant von Scotland Yard, den ich zufällig kannte, hatte mir einen Nachtclub in der Bond Street empfohlen, wo »die Mädchen anständig sind und keinen übers Ohr hauen«. Zwei schwarze Taxis fuhren uns dorthin. Doch die Türen des Clubs waren verriegelt und verrammelt, und es brannte kein Licht. Der Sergeant hatte nicht daran gedacht, dass es in jenen lang vergangenen Zeiten ein sonntägliches Ladenschluss-Gesetz gab. Da sich die Hoffnungen der Gäste zerschlagen hatten, wandte ich mich an den Portier als letzten Ausweg, und für zehn Pfund enttäuschte er uns nicht:
»Auf halbem Weg die Curzon Street runter, Sir, auf der linken Seite, da ist eine blaue Lichtreklame im Fenster, ›Französischunterricht‹. Wenn das Licht nicht brennt, dann sind die Mädchen beschäftigt. Ist es an, dann haben sie auf. Aber bitte diskret.«
Begleite ich meine Schützlinge durch dick und dünn, oder überlasse ich sie ihrem Vergnügen? Ihr Blut war in Wallung. Sie sprachen nur wenig Englisch und Deutsch nicht gerade leise. Das blaue Licht brannte. Es leuchtete eigenartig anziehend, und es schien das einzige Licht in der Straße zu sein. Ein kurzer Gartenpfad führte zur Haustür. Auf dem beleuchteten Klingelknopf stand ›Drücken‹. Meine Gäste ignorierten den Rat des Portiers, sie verhielten sich nicht sehr diskret. Ich klingelte. Eine große Dame mittleren Alters in weißem Kaftan und mit um den Kopf geschlungenem Tuch öffnete.
»Ja, bitte?«, fragte sie entrüstet, als hätten wir sie aus dem Bett geholt.
Ich wollte mich schon entschuldigen, dass wir sie gestört hätten, doch der Abgeordnete eines Wahlkreises westlich von Frankfurt kam mir zuvor.
»Wir sind Deutsche und möchten Französisch lernen!«, brüllte er in seinem Englisch, und seine Kollegen stimmten lautstark zu.
Unsere Gastgeberin war unbeeindruckt.
»Fünf Pfund kurz, und immer nur einer«, verkündete sie streng wie die Hausmutter einer Privatschule.
Ich wollte gerade meine Gäste ihren speziellen Interessen überlassen, als ich zwei Streifenpolizisten bemerkte, einen alten, einen jungen, die auf uns zukamen. Ich trug meine Dienstkleidung, schwarzes Jackett und gestreifte Hose.
»Ich bin vom Außenministerium. Diese Herren sind meine offiziellen Gäste.«
»Nicht so laut«, sagte der Ältere, und die beiden gingen gemessenen Schrittes weiter.
4
Finger am Abzug
Der eindrucksvollste Politiker, den ich während meiner drei Jahre an der britischen Botschaft in Bonn nach Großbritannien begleitete, war Fritz Erler, der 1963 die führende Autorität der SPD in Fragen der Verteidigung und Außenpolitik war und als möglicher Kanzler der Bundesrepublik gehandelt wurde. Von den Debatten im Bundestag wusste ich, dass er zudem ein scharfer und gewitzter Kritiker von Kanzler Adenauer und dessen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß war. Und da ich insgeheim die beiden genauso wenig mochte wie wohl auch Erler, war ich hocherfreut, dass ich den Auftrag erhielt, ihn auf seinem Londonbesuch zu begleiten, wo er Gespräche mit führenden britischen Parlamentariern aller Richtungen führen sollte, unter anderem mit dem Vorsitzenden der Labour Party Harold Wilson und dem Premierminister Harold Macmillan.
Brisant war zu dem Zeitpunkt das Thema des ›deutschen Fingers am Abzug‹: Welches Mitspracherecht sollte die Bonner Regierung im Falle eines Atomkriegs bei der Entscheidung haben, amerikanische Raketen von westdeutschen Basen abzuschießen? Genau diese Frage hatte Erler kurz zuvor in Washington mit Präsident Kennedy und seinem Verteidigungsminister Robert McNamara besprochen. Von der Botschaft hatte ich die Anweisung, Fritz Erler während seines gesamten Aufenthalts zu begleiten und mich im Großen und Ganzen als sein Privatsekretär, Faktotum und Dolmetscher nützlich zu machen. Zwar sprach Erler, der ja kein Dummkopf war, besser Englisch, als er zu erkennen gab, doch er nutzte gern die Extrazeit, die ich ihm durch mein Dolmetschen verschaffte, zum Nachdenken, und es störte ihn nicht weiter, als ich ihm sagte, dass ich kein diplomierter Dolmetscher sei. Die Reise sollte zehn Tage dauern; der Terminplan war eng. Das Außenministerium hatte ihm eine Suite im Savoy Hotel in The Strand gebucht und mich in einem Zimmer ein paar Türen weiter untergebracht.
Jeden Morgen gegen fünf holte ich die Zeitungen von einem Kiosk, und unter dem Dröhnen des Staubsaugers saß ich in der Hotelhalle und kreuzte alle Meldungen oder Kommentare an, die Erler meines Erachtens noch vor den Terminen des Tages kennen sollte. Dann legte ich ihm die Zeitungen vor die Tür, kehrte auf mein Zimmer zurück und wartete auf das Zeichen zu unserem morgendlichen Spaziergang pünktlich um sieben Uhr.
Erler, Regenmantel und schwarze Baskenmütze, schritt neben mir aus; er wirkte streng und recht humorlos, doch ich wusste, beides traf nicht zu. Wir gingen zehn Minuten lang in eine Richtung, jeden Morgen eine andere Strecke. Dann blieb er stehen, machte auf dem Absatz kehrt, schritt mit gesenktem Kopf und den Händen hinter dem Rücken zurück, den Blick stur auf den Boden gerichtet, und zählte die Namen auf, die an Läden und auf Messingtafeln standen, an denen wir vorbeigekommen waren, und ich überprüfte, ob es stimmte. Die Gedächtnisübung habe er sich im Konzentrationslager Dachau angewöhnt, erklärte er mir nach einigen dieser Wanderungen. Kurz vor Ausbruch des Krieges war er wegen Vorbereitung des Hochverrats zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. 1945 gelang es ihm, auf einem der berüchtigten Todesmärsche aus Dachau zu fliehen und sich bis zur Niederlage der Deutschen in Bayern zu verstecken.
Die Gedächtnisübung hatte offenkundig gefruchtet, denn ich erinnere mich nicht, dass er auch nur ein einziges Mal bei einem Namen an Laden oder Tafel gepatzt hat.
Unsere Treffen in diesen zehn Tagen waren geradezu eine Bildungsreise zu den Großen, Guten und nicht so Guten von Westminster. Ich sehe noch die Gesichter auf der anderen Seite des Tischs vor mir und habe so manche Stimme im Ohr. Harold Wilsons Stimme fand ich besonders verwirrend. Da mir der Abstand des professionellen Dolmetschers fehlte, interessierte ich mich viel zu sehr für die stimmlichen und körperlichen Eigenheiten der Anwesenden. Ich erinnere mich vor allem an Harold Wilsons kalte Pfeife und wie theatralisch er sie als Requisit einsetzte. Absolut keine Erinnerung habe ich daran, worum es bei unseren angeblich hochrangigen Begegnungen ging. Unsere Gesprächspartner hatten offenkundig so wenig Ahnung von Verteidigungsdingen wie ich, was mein Glück war, denn obwohl ich eine Liste von Fachausdrücken des grauenhaften Atompatt-Vokabulars gebüffelt hatte, blieben die Ausdrücke mir auf Englisch ebenso unverständlich wie auf Deutsch. Ich glaube, ich habe die Vokabeln nie gebraucht, und ich bezweifle, dass ich sie heute wiedererkennen würde.
Eine Zusammenkunft allerdings ist mir unvergesslich, in Bild, Ton und Bedeutung, und das war der große Höhepunkt unserer zehntägigen Tour: Der mögliche nächste deutsche Bundeskanzler Fritz Erler trifft auf den amtierenden britischen Premierminister Harold Macmillan in dessen Amtssitz in 10 Downing Street.
Mitte September 1963. Im März hatte Heeresminister John Profumo eine persönliche Erklärung vor dem Unterhaus abgegeben und jedwede anstößige Verbindung zu einer gewissen Christine Keeler geleugnet. Die englische Nachtclubtänzerin stand unter dem Schutz von Stephen Ward, einem angesagten Londoner Osteopathen. Dass ein verheirateter Heeresminister sich eine Maitresse hielt, war zwar anrüchig, aber nicht beispiellos. Dass er sie sich, wie Keeler behauptete, mit dem Marineattaché der sowjetischen Botschaft in London teilte, war allerdings zu viel. Sündenbock war der glücklose Stephen Ward, der nach einer überzogenen Anklage Selbstmord beging, ohne das Urteil abzuwarten. Im Juni war Profumo vom Amt zurückgetreten und hatte sein Mandat niedergelegt. Im Oktober folgte ihm Macmillan, der gesundheitliche Gründe vorbrachte. Erlers Treffen mit ihm fand im September statt, nur wenige Wochen bevor Macmillan das Handtuch warf.
Wir sollten zu spät beim Premierminister ankommen, was schon kein guter Anfang war. Denn der Regierungswagen, der uns abholen sollte, tauchte nie auf, und ich hatte mich in meinem schwarzen Jackett und der gestreiften Hose mitten auf die Straße stellen müssen, hielt ein vorbeifahrendes Auto an und bat den Fahrer, uns so schnell wie möglich zur 10 Downing Street zu bringen. Natürlich dachte der Fahrer, ein junger Mann in weiblicher Begleitung, ich sei völlig verrückt. Doch seine Beifahrerin schnauzte ihn an: »Na los, mach schon. Sie kommen sonst noch zu spät«, der junge Mann biss sich auf die Unterlippe und tat wie geheißen. Wir stiegen also hinten ein, Erler reichte seine Karte nach vorne und sagte, wann immer sie nach Bonn kämen, sollten die beiden bei ihm vorbeischauen. Dennoch waren wir zehn Minuten zu spät.
Wir wurden in Macmillans Büro geführt, entschuldigten uns und nahmen Platz. Macmillan saß regungslos hinter seinem Schreibtisch, die leberfleckigen Hände vor sich. Sein Privatsekretär, Philip de Zulueta von der Welsh Guard und schon bald Ritter des Bathordens, saß neben ihm. Erler bedauerte unser Zuspätkommen auf Deutsch. Ich kam ihm auf Englisch zu Hilfe. Die Hände des Premierministers lagen auf einer Glasplatte, unter der sich ein getippter Premierminister-Spickzettel befand, Erlers Lebenslauf, der so groß geschrieben war, dass er auch auf dem Kopf gelesen werden konnte. Das Wort Dachau war besonders groß geschrieben. Beim Sprechen fuhr Macmillan mit den Händen über das Glas, als würde er Blindenschrift lesen. Seine adlig verschliffene Aussprache, perfekt eingefangen von Alan Bennett in der satirischen Bühnenshow Beyond the Fringe, klang wie eine alte Schallplatte bei sehr langsamer Geschwindigkeit. Ein Tränenrinnsal floss unaufhaltsam aus dem rechten Augenwinkel eine Falte hinunter in seinen Hemdkragen.
Erst ein paar höfliche Worte des Willkommens, mit verhalten edwardianischem Charme vorgebracht – Sind Sie ordentlich untergebracht? Kümmert man sich um Sie? Treffen Sie die richtigen Leute? Mit offensichtlicher Neugierde fragte Macmillan Erler, worüber er mit ihm sprechen wolle; eine Frage, die Erler gelinde gesagt überraschte.
»Verteidigung«, antwortete er.
Ich übersetzte.
Nach dieser Information warf Macmillan einen Blick auf den Spickzettel, und ich kann nur annehmen, dass er wie ich wieder das Wort Dachau sah, denn er blickte lebhaft auf.
»Nun, Herr Erler«, verkündete er überraschend. »Sie haben im Zweiten Weltkrieg gelitten, ich habe im Ersten Weltkrieg gelitten.«
Ich übersetzte wieder.
Ein weiterer Austausch von Höflichkeiten. Hat Erler Familie? Ja, sagt Erler, er habe Familie. Ich übersetze. Auf Macmillans Wunsch hin zählt er seine Kinder auf und fügt hinzu, dass seine Frau ebenfalls politisch tätig sei.
Ich übersetze.
»Und Sie haben, wie ich höre, mit den amerikanischen Verteidigungsexperten gesprochen«, fährt Macmillan nach einem weiteren Blick auf das Großgedruckte unter der Glasplatte im Ton heiterer Überraschung fort.
»Ja.«
Ich übersetze.
»Und haben Sie in Ihrer Partei auch Verteidigungsexperten?«, fragt Macmillan, wie ein überlasteter Staatsmann einen anderen wohl mitleidig fragen würde.
»Ja«, erwidert Erler schärfer, als es mir lieb war.
Unterbrechung. Ich werfe de Zulueta einen Blick zu und versuche, seine Unterstützung zu gewinnen. Doch da ist nichts zu gewinnen. Nach einer Woche Seite an Seite mit Erler bin ich nur zu vertraut mit seiner Ungeduld, wenn ein Gespräch sich nicht erwartungsgemäß entwickelt. Ich weiß, dass er sich nicht scheut, seine Enttäuschung zu zeigen. Ich weiß, wie gründlich er sich vor allem auf dieses Treffen vorbereitet hat.
»Sie kommen zu mir, wissen Sie«, klagt Macmillan wehmütig. »Diese Verteidigungsexperten. Sie kommen wohl auch zu Ihnen, nehme ich an. Und sie erklären mir, die Bomben fallen hier, und die Bomben fallen da« – die Hände des Premierministers verteilen die Bomben auf der Glasplatte –, »aber Sie haben im Zweiten Weltkrieg gelitten, und ich habe im Ersten Weltkrieg gelitten!« – wieder diese überraschende Erkenntnis –, »Und Sie und ich wissen, dass die Bomben fallen, wo sie eben fallen!«
Und wieder übersetze ich, irgendwie. Selbst auf Deutsch wird es nur halb so lang, wie Macmillan gebraucht hat, klingt aber doppelt so lächerlich. Als ich fertig bin, grübelt Erler einen Augenblick. Wenn er grübelt, dann heben und senken sich die Muskeln in seinem hageren Gesicht unabhängig voneinander. Plötzlich steht er auf, greift sich seine Baskenmütze und dankt Macmillan für die Begegnung. Er wartet, bis ich ebenfalls aufstehe. Macmillan, der so überrascht ist wie wir alle, erhebt sich halb, gibt Erler die Hand und lässt sich wieder zurücksinken. Auf dem Weg zur Tür wendet sich Erler an mich und macht seinem Ärger Luft:
»Dieser Mann ist nicht mehr regierungsfähig.«
Eine Formulierung, die im Deutschen etwas seltsam klingt. Vielleicht handelt es sich um ein Zitat, das Erler kürzlich gelesen oder gehört hat. Wie dem auch sei, de Zulueta hat es ebenfalls gehört und, was noch schlimmer ist, er kann Deutsch. Ein zorniges: »Das habe ich gehört«, das er mir im Vorbeigehen zuzischt, bestätigt das.
Diesmal wartete der Regierungswagen auf uns. Erler zog es allerdings vor, zu Fuß zu gehen, mit gesenktem Kopf, Hände hinter dem Rücken, Blick auf den Boden gerichtet. Als ich wieder in Bonn war, schickte ich ihm ein Exemplar meines gerade erschienenen Der Spion, der aus der Kälte kam und teilte ihm mit, dass ich der Autor sei. Um Weihnachten herum schrieb er wohlwollend in einer deutschen Zeitung über mein Buch. Im Dezember wurde er offiziell zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion und somit zum Oppositionsführer gewählt. Drei Jahre später starb er an Krebs.
5
Wen auch immer es betrifft
Alle über fünfzig erinnern sich daran, wo sie an jenem Tag waren, doch kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, mit wem ich zusammen war. Falls Sie also der prominente deutsche Gast waren, der am Abend des 22. November 1963 im Rathaus von St. Pancras links neben mir saß, dann seien Sie doch so freundlich und melden sich bei mir. Prominent waren Sie gewiss, denn warum hätte die britische Regierung Sie sonst eingeladen? Ich erinnere mich auch, dass unser Besuch im Rathaus von St. Pancras Ihrer Entspannung am Ende eines anstrengenden Tages dienen sollte, als Gelegenheit, sich zurückzulehnen und der britischen Basisdemokratie bei der Arbeit zuzuschauen.
Hier waren wir wirklich an der Basis. Der Versammlungssaal war gerappelt voll mit wütenden Menschen. Das Gebrüll war so laut, dass ich kaum die Beleidigungen verstand, die auf der Bühne gewechselt wurden, geschweige denn, dass ich sie Ihnen übersetzen konnte. Grimmig dreinblickende Ordner standen mit verschränkten Armen an den Wänden, und wenn jemand handgreiflich geworden wäre, dann hätte das Ganze wohl in einer Massenschlägerei geendet. Ich glaube, man hatte uns besonderen Polizeischutz angeboten, doch den hatten Sie abgelehnt. Ich erinnere mich noch, dass mir wohler gewesen wäre, wenn ich Ihnen widersprochen hätte. Wir steckten mitten im Tumult fest, und der Weg zum nächsten Ausgang war weit.
Der Anlass des Volkszorns stand auf der Bühne und zahlte mit gleicher Münze zurück. Quintin Hogg, vormals Viscount Hailsham, hatte seine Peerswürde aufgegeben, um für die Tories den Parlamentssitz St. Marylebone zu erobern. Er wollte den Kampf, und er bekam ihn. Einen Monat zuvor war Harold Macmillan zurückgetreten. Neuwahlen standen bevor. Auch wenn der Name heutzutage nicht mehr allzu vielen geläufig sein dürfte, schon gar nicht außerhalb der Insel, so war Quintin Hogg, alias Lord Hailsham, 1963 das Urbild des streitsüchtigen Briten längst vergangener Tage. Er war Eton-Schüler mit humanistischer Bildung, Kriegsteilnehmer, Rechtsanwalt, Bergsteiger, Schwulenhasser und lautstarker Konservativer christlicher Prägung, doch vor allem war er ein politischer Agitator und berühmt für seine Großmäuligkeit und Streitsucht. In den 30ern hatte er, ganz im Einklang mit vielen seiner Parteigänger, eher zum Appeasement geneigt, bevor er sich ganz auf Churchills Seite schlug. Nach dem Krieg wurde er zum Urbild des politischen Hansdampfs in allen Gassen, ständig rechnete man ihm Chancen auf hohe Ämter aus, stets landete er im Wartesaal – doch an diesem Abend war er das, was er bis zum Ende seines langen Lebens bleiben sollte, der adlige Streithammel, wie ihn die Wählerschaft aus tiefstem Herzen hasste.
Ich weiß nicht mehr, welche Argumente Hogg vorbrachte, falls ich bei dem Tumult überhaupt etwas davon hören konnte. Ich erinnere mich allerdings, wie wohl jeder andere damals Anwesende auch, an sein brutales rotes Gesicht, seine Hochwasserhosen und schwarzen Schnürschuhe, als er breitbeinig wie ein Ringer dastand, an seine aufgedunsene Bauernvisage und die geballten Fäuste; nicht zu vergessen an sein dröhnendes Oberschichtgebrüll, das den Lärm der Menge übertönte und das ich meinem Begleiter, wer immer es war, zu übersetzen versuchte.
Auftritt von links, ein Bote wie bei Shakespeare. Ich sehe noch den kleinen grauen Mann auf Zehenspitzen vor mir. Er schleicht zu Hogg und flüstert ihm etwas ins rechte Ohr. Hoggs Arme, mit denen er bis dahin anklagend oder verächtlich herumgerudert hat, fallen herunter. Er schließt die Augen, schlägt sie wieder auf. Er neigt den merkwürdig langgestreckten Kopf zur Seite, um sich die Worte noch einmal zuflüstern zu lassen. Der churchillhaft finstere Blick wird nun ungläubig, Hogg sieht völlig niedergeschlagen aus. Mit leiser Stimme entschuldigt er sich und geht aufrecht wie ein Mann auf dem Weg zum Schafott ab, gefolgt von dem Boten.
Ein paar wenige hoffen, Hogg könne aufgegeben haben, und schleudern ihm noch ein paar Schimpfwörter hinterher. Langsam macht sich peinliche Stille im Saal breit. Hogg kehrt mit aschgrauem Gesicht zurück, seine Bewegungen wirken steif und unbeholfen. Kein Muckser ist zu hören. Noch immer steht er mit gesenktem Kopf da, wartet und sammelt sich. Er hebt den Kopf, und wir sehen, wie ihm Tränen über die Wangen laufen.
Endlich spricht er. Für jetzt und für alle Zeit. Er sagt etwas so Unumstößliches, so Unbestreitbares, nicht zu Leugnendes, das anders ist als alles, was er bisher an diesem Abend von sich gegeben hat.
»Ich bin gerade darüber informiert worden, dass Präsident Kennedy ermordet worden ist. Die Versammlung ist beendet.«
Zehn Jahre später. Ein Freund vom Auswärtigen Dienst lädt mich zu einem Galadiner im All Souls College in Oxford ein, das zu Ehren eines verstorbenen Wohltäters gegeben wird. Nur Männer sind anwesend, wie es damals wohl üblich war, nehme ich an. Niemand ist jung. Das Essen ist ausgezeichnet, die Konversation, soweit ich es mitbekomme, kultiviert. Zwischen den einzelnen Gängen ziehen wir von einem von Kerzen erhellten Speisesaal in den nächsten, einer schöner als der andere, jeder wartet mit einer langen Tafel auf, die gedeckt ist mit zeitlosem Collegesilber. Bei jedem Saalwechsel wechselt auch die Sitzordnung, und so lande ich nach dem zweiten – oder dem dritten? – Umzug neben ebenjenem Quintin Hogg, oder wie sein Namensschild verkündet, dem kürzlich erhobenen Baron Hailsham of St. Marylebone. Nachdem er seinen früheren Titel abgelegt hatte, um ins Unterhaus einziehen zu können, hat sich der ehemalige Mr Hogg nun selbst mit einem neuen Titel versorgt, der ihm die Rückkehr ins Oberhaus ermöglicht.
Ich bin schon zu meinen besten Zeiten nicht sonderlich gut in Small Talk, schon gar nicht, wenn ich neben einem streitsüchtigen adligen Tory gelandet bin, dessen politische Ansichten den meinen, falls ich denn welche habe, total konträr sind. Der greise Gelehrte zu meiner Linken lässt sich ausgiebig zu einem Thema aus, über das ich nichts weiß. Der greise Gelehrte mir gegenüber erörtert eine Stelle aus der griechischen Mythologie. In griechischer Mythologie bin ich nicht firm. Baron Hailsham zu meiner Rechten allerdings hat einen Blick auf mein Tischkärtchen geworfen und ist in derart missbilligendes, missmutiges, undurchdringliches Schweigen verfallen, dass ich mich bei aller Höflichkeit gezwungen sehe, es zu beenden. Heute weiß ich nicht mehr, welche Eigenheit des gesellschaftlichen Umgangs mir nicht erlaubte, den Augenblick zu erwähnen, als ihm die Nachricht von Kennedys Ermordung im Rathaus von St. Pancras überbracht wurde. Vielleicht nahm ich an, dass er nicht gern an einen derart emotionalen Ausbruch in der Öffentlichkeit erinnert werden wollte.
Weil mir nichts Besseres einfällt, spreche ich über mich selbst. Ich erkläre ihm, dass ich Schriftsteller bin, und nenne ihm mein Pseudonym, was ihn nicht sonderlich beeindruckt. Vielleicht kennt er es ja auch schon und ist deshalb so mürrisch. Ich sage ihm, ich hätte das Glück, ein Haus in Hampstead zu besitzen, würde aber meist in West Cornwall leben. Ich preise die Schönheit der Landschaft dort. Ich frage ihn, ob er ebenfalls auf dem Land einen Wohnsitz habe, um dort an den Wochenenden auszuspannen. Endlich muss er eine Antwort geben. Er hat tatsächlich einen Landsitz, und er nennt ihn gereizt mit drei Worten:
»Hailsham, Sie Holzkopf.«
6
Die Mühlen der britischen Justiz
Im Sommer 1963 äußerte ein bedeutender westdeutscher Abgeordneter, der als offizieller Gast der Regierung Ihrer Majestät in London in meiner Obhut war, den Wunsch, die Mühlen der britischen Justiz bei der Arbeit zu sehen, dies ließ er mich bei einem Treffen mit keinem Geringeren als dem Lordkanzler selbst wissen, Lord Dilhorne, vormals Manningham-Buller – oder »Bullying Manner«, wie seine Richterkollegen ihn wegen seines schikanösen Benehmens nannten.
Der Lordkanzler ist jenes Kabinettsmitglied, das für die Verwaltung der Gerichte des Landes zuständig ist. Falls also, was Gott verhüten möge, bei einem bestimmten Prozess politisch Einfluss genommen werden soll, dann ist zumeist der Lordkanzler derjenige, der diesen Job übernimmt. Thema unseres Treffens, für das Dilhorne nicht das leiseste Interesse aufbrachte, war die Einstellung und Ausbildung junger deutscher Richter. Für meinen bedeutenden deutschen Gast war dies allerdings eine wichtige Angelegenheit, die die Zukunft der deutschen Rechtsprechung nach 1945 unmittelbar betraf. Lord Dilhorne betrachtete die Zusammenkunft als nutzlose Verschwendung seiner kostbaren Zeit, was er uns auch deutlich spüren ließ.
Als wir uns erhoben und gerade verabschieden wollten, brachte er es schließlich doch noch über sich, unseren Gast beiläufig zu fragen, ob es etwas gäbe, womit er ihm seinen Aufenthalt in Großbritannien angenehmer machen könne. Worauf der Gast beherzt, wie ich erfreut sagen muss, erwiderte, ja, da gäbe es tatsächlich etwas. Er käme gern einmal zum Strafprozess gegen Stephen Ward, dem zur Last gelegt wurde, Nutznießer der schmutzigen Einkünfte Christine Keelers gewesen zu sein; ihre Rolle im Profumo-Skandal habe ich in einem früheren Kapitel bereits beschrieben. Dilhorne, der wesentlich daran beteiligt gewesen war, den skandalösen Fall gegen Ward auszuhecken, wurde rot und sagte dann zwischen zusammengepressten Zähnen: »Aber natürlich.«
Und so kam es, dass mein deutscher Gast und ich ein paar Tage später nebeneinander im Gerichtssaal Nr. 1 im Old Bailey saßen, direkt hinter dem angeklagten Stephen Ward. Sein Anwalt gab eine Art abschließender Erklärung zur Verteidigung ab, und der Richter, dessen Feindseligkeit gegenüber Ward der des Anklagevertreters in nichts nachstand, machte ihm seine Arbeit so schwer, wie er nur konnte. Ich glaube, bin mir aber längst nicht mehr sicher, dass Mandy Rice-Davies irgendwo auf der Zuschauergalerie saß, sie war allerdings derart im Fokus der Öffentlichkeit, dass meine Phantasie sie womöglich dort hingesetzt hat. Mandy Rice-Davies war, für jene, die zu jung sind und deshalb ihre erfrischenden Beiträge im Prozess nicht genießen konnten, Model, Tänzerin, Revuegirl und Christine Keelers Mitbewohnerin gewesen.
Ich erinnere mich allerdings noch genau, wie erschöpft Ward aussah, als er sich umdrehte und uns grüßte, weil er wohl ahnte, dass wir eine Art VIPs sein könnten. Das angespannte Profil mit der scharfen Nase, die straff gespannte Haut, das steife Lächeln und die hervortretenden Augen, die vor Müdigkeit rot und umschattet waren; dazu die raue Raucherstimme, die Nonchalance vorspielte, fragte er uns beide plötzlich: »Na, wie schlage ich mich, was denken Sie?«
Man rechnet ja im Allgemeinen nicht damit, dass sich die Schauspieler auf der Bühne umdrehen und mitten im Drama beiläufig mit einem reden. Ich antwortete für uns beide und versicherte ihm, dass er sich ganz gut schlagen würde, nahm mir das allerdings selbst nicht ab.
Ein paar Tage später brachte Ward sich um, ohne das Urteil abzuwarten. Lord Dilhorne und seine Mitverschwörer hatten ihre Beute erlegt.
7
Der Überläufer
Anfang der 60er, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, wurden junge britische Diplomaten nicht gerade ermutigt, mit ihren sowjetischen Pendants zu fraternisieren. Jeder Kontakt, ob nun zufällig, in gesellschaftlichem oder offiziellem Rahmen, musste sofort den Vorgesetzten gemeldet werden, möglichst noch vor dem Treffen. Es sorgte daher im offiziellen Taubenschlag für ziemliche Aufregung, als ich meiner Abteilung in London mitteilen musste, dass ich seit einigen Wochen täglich Kontakt zu einem höheren Beamten der sowjetischen Botschaft in Bonn pflegte, und das ohne Zeugen.
Wie es dazu gekommen war, das fand ich ebenso überraschend wie meine Vorgesetzten. Die westdeutsche innenpolitische Szene, über die ich zu berichten hatte, erlebte gerade eine ihrer wiederkehrenden Erschütterungen. Rudolf Augstein, Herausgeber des Spiegel, war wegen angeblichen Landesverrats inhaftiert worden, und Franz Josef Strauß, der aus Bayern stammende Verteidigungsminister, der ihn ins Gefängnis gebracht hatte, sah sich Anschuldigungen gegenüber, bei der Beschaffung von Starfightern in unsaubere Geschäfte verwickelt zu sein. Tag für Tag gab es neue aufregende Einzelheiten aus dem bayerischen Milieu, in den Hauptrollen Luden, leichte Mädchen und zwielichtige Mittelsmänner.
Es war also nur natürlich, dass ich mich wie immer in Zeiten politischer Unruhe verhielt: Ich eilte in den Bundestag, setzte mich auf die Diplomatengalerie und verschwand bei jeder möglichen Gelegenheit nach unten, um bei meinen parlamentarischen Kontakten den Stand zu sondieren. Bei meiner Rückkehr von einem dieser Ausflüge stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass inzwischen ein fülliger, freundlicher Herr von Mitte fünfzig auf meinem Platz saß. Er hatte buschige Augenbrauen, trug eine randlose Brille und einen riesigen grauen Anzug, zu dem, bei dieser Jahreszeit ungewöhnlich, eine Weste gehörte, die ein paar Nummern zu klein war für seinen stattlichen Bauch.
Ich sage ›mein‹ Platz, weil die Galerie klein war und an der hinteren Wand des Bundestags wie eine Opernloge klebte. Dort herrschte immer unerklärliche Leere, abgesehen von einem CIA-Offizier, der sich wenig überzeugend Herr Schulz nannte. Nachdem er mich einmal gemustert und womöglich meinen verderblichen Einfluss erahnt hatte, hielt er sich so weit wie möglich von mir fern. Heute ist allerdings nur der füllige Herr anwesend. Ich lächle ihm zu. Er strahlt mich an. Ich setze mich ein paar Stühle entfernt von ihm hin. Die Debatte im Saal ist in vollem Gange. Wir hören gespannt zu und spüren, wie sich der jeweils andere konzentriert. Zur Mittagspause stehen wir auf, können uns erst nicht einigen, wer als Erster durch die Tür geht, und marschieren jeder für sich in die Bundestagskantine; von getrennten Tischen aus lächeln wir uns über unsere Tagessuppe hinweg höflich zu. Ein paar Parlamentsmitarbeiter setzen sich zu mir, doch mein Nachbar von der Diplomatengalerie bleibt allein. Nachdem wir unsere Suppe gelöffelt haben, kehren wir zu unseren Plätzen auf der Galerie zurück. Die Sitzung ist zu Ende, und wir gehen unserer Wege.
Am nächsten Morgen sitzt der Herr bereits auf meinem Platz und strahlt mir entgegen. Und mittags löffelt er wieder allein am Tisch seine Suppe, während ich mich mit ein paar Journalisten unterhalte. Soll ich ihn zu uns bitten? Schließlich ist er ein Diplomatenkollege. Soll ich hinübergehen und mich zu ihm setzen? Doch mein ach so großes Mitgefühl ist, wie so oft, gar nicht angezeigt: Der Mann liest völlig zufrieden seine Frankfurter Allgemeine. Am Nachmittag taucht er nicht auf, aber es ist auch Freitag, es ist Sommer, und im Bundestag klappt man schon die Fensterläden zu.
Kaum habe ich mich allerdings am folgenden Montag auf meinen Platz gesetzt, kommt der Herr herein, mit Rücksicht auf den Tumult unten im Saal einen Finger an den Lippen, und streckt mir seine weich gepolsterte Hand zum Gruß entgegen. Das Ganze aber mit einem solchen Anflug von Vertrautheit, dass es mir plötzlich peinlich ist: Er kennt mich, ich ihn aber nicht; wir waren uns bei einer der endlosen diplomatischen Cocktailpartys in Bonn begegnet; er erinnert sich an die Begebenheit, ich habe sie vergessen.
Was noch schlimmer ist: Nach Alter und Statur zu urteilen, könnte er auch einer der zahllosen Botschafter eines kleineren Landes sein. Und etwas mögen die Botschafter kleinerer Länder überhaupt nicht: wenn andere Diplomaten, vor allem die jüngeren, sie nicht wiedererkennen. Nach weiteren vier Tagen kommt endlich die Wahrheit ans Licht. Wir machen uns beide Notizen; er in ein billiges liniertes Notizbuch, das er nach jedem Eintrag wieder mit einem roten Gummiband umwickelt; ich auf einen einfachen Block in Taschenbuchformat, und zwischen meine hingeschmierten Mitschriften male ich heimlich kleine Karikaturen der Hauptakteure des Bundestags. Es ist also wohl unvermeidlich, dass sich mein Nachbar an einem langweiligen Nachmittag während einer Pause verschmitzt über den leeren Stuhl zwischen uns beugt und fragt, ob er mal gucken dürfe; kaum habe ich ja gesagt, da kneift er schon die Augen hinter der Brille zu Schlitzen zusammen und windet sich vor Heiterkeit. Mit der Handbewegung eines Zauberers zieht er eine eselsohrige Visitenkarte aus der Westentasche und beobachtet mich, als ich lese, erst auf Russisch, dann für die dieser Sprache Unkundigen, auf Englisch:
Mr Iwan Serow, Zweiter Sekretär, Botschaft der UdSSR, Bonn, Bundesrepublik Deutschland.
Darunter steht handgeschrieben in spinnenbeinigen schwarzen Großbuchstaben: KULTUR.
Noch heute höre ich aus der Ferne wie folgt unsere Unterhaltung:
»Sie möchten Drink bei Gelegenheit?«
Ein Drink wäre prima.
»Lieben Sie Musik?«
Sehr. Tatsächlich habe ich kein Ohr für Musik.
»Sie verheiratet?«
Bin ich, ja. Und Sie?
»Meine Frau Olga, sie liebt auch Musik. Sie haben Haus?«
In Königswinter. Wozu lügen? Meine Adresse findet sich in der Diplomatenliste, dort kann er sie jederzeit einsehen.
»Großes Haus?«
Vier Zimmer, antworte ich, ohne nachzuzählen.
»Sie haben Telefonnummer?«
Ich nenne sie ihm. Er schreibt sie auf und gibt mir seine. Ich reiche ihm meine Visitenkarte: Zweiter Sekretär (Politik).
»Sie spielen Musik? Klavier?«
Das würde ich gern, aber leider nein.
»Sie malen böse Bilder von Adenauer, okay?« – und damit klopft er mir kräftig auf die Schulter und brüllt vor Lachen. »Hören Sie. Ich habe kleine Wohnung. Wir machen Musik, alle beschweren. Sie rufen mich an einmal, okay? Laden Sie uns ein, wir spielen Ihnen gute Musik. Ich bin Iwan, okay?«
David.
Oberste Regel im Kalten Krieg: Nichts, absolut gar nichts ist so, wie es scheint. Für alles gibt es ein Motiv, ein zweites, vielleicht sogar ein drittes. Ein sowjetischer Beamter lädt sich und seine Frau einfach ins Haus eines westlichen Diplomaten ein, den er gar nicht kennt? Wer macht hier bei wem einen Annäherungsversuch? Anders ausgedrückt, was hatte ich gesagt oder getan, um ihn überhaupt auf einen derart unmöglichen Vorschlag zu bringen? David, gehen wir das Ganze noch einmal durch. Sie sagten, Sie sind ihm noch nie zuvor begegnet. Jetzt meinen Sie, vielleicht doch?
Eine Entscheidung wurde gefällt, von wem, das wagte ich nicht zu fragen. Ich sollte Serow zu mir einladen, genau wie vorgeschlagen. Per Telefon, nicht schriftlich. Ich sollte die Nummer wählen, die er mir gegeben hatte: die offizielle Nummer der sowjetischen Botschaft in Bad Godesberg. Ich sollte meinen Namen nennen und bitten, mit dem Kulturattaché Serow verbunden zu werden. Jeder einzelne dieser scheinbar ganz normalen Schritte wurde mir mit größter Präzision durchbuchstabiert. Wenn ich mit Serow verbunden wurde – falls ich mit ihm verbunden wurde –, sollte ich ihn beiläufig fragen, welcher Tag und welche Stunde ihm und seiner Gattin denn für die musikalische Veranstaltung genehm wären, von der wir gesprochen hätten. Ich sollte einen möglichst frühen Termin finden, da potentielle Überläufer zu impulsiven Handlungen neigten. Ich sollte darauf achten, seine Frau grüßen zu lassen, deren Einbeziehung – ja bloße Erwähnung – in solchen Fällen ungewöhnlich sei.
Am Telefon war Serow kurz angebunden. Er sprach so, als würde er sich nur vage an mich erinnern, sagte, er wolle in seinem Kalender nachschauen und mich zurückrufen. Auf Wiederhören. Meine Vorgesetzten prophezeiten, dass ich nie wieder von Serow hören würde. Doch am folgenden Tag rief er mich an, wohl von einem anderen Telefon aus, denn er klang wieder wie der fröhliche Serow.
Okay, acht Uhr Freitag, David?
Kommen Sie beide, Iwan?
Sicher. Serowa, sie kommt auch.
Toll, Iwan. Also bis acht. Und grüßen Sie Ihre Frau von mir.
Den ganzen Tag über spielten Tontechniker, die in Windeseile aus London herbeigeholt worden waren, mit der Verkabelung in unserem Wohnzimmer herum, und meine Frau machte sich schon Sorgen, sie könnten die Wände verkratzen. Zur vereinbarten Uhrzeit rollt eine riesige, von einem Chauffeur gelenkte ZIL-Limousine mit getönten Scheiben in unsere Einfahrt und kommt langsam zum Stehen. Eine der Hintertüren öffnet sich, Iwan steigt mit dem Rücken voran aus, wie Alfred Hitchcock in einem seiner Filme, und zieht ein mannshohes Cello hinter sich her. Dann nichts. Ist er doch allein gekommen? Nein, ist er nicht. Eine andere Hintertür öffnet sich, eine, die ich von meiner Position aus nicht einsehen kann. Ich stehe kurz davor, Serowa zum ersten Mal zu Gesicht zu bekommen. Aber nein, keine Serowa. Ein großer, sportlicher Mann in einem schicken schwarzen Einreiher.
»Sagen Sie hallo zu Dimitrij«, kräht Serow an der Tür. »Er kommt für meine Frau.«
Dimitrij erklärt, auch er liebe Musik.
Vor dem Essen trinkt Serow, mit Alkohol offenbar bestens vertraut, alles, was ihm angeboten wird. Er verputzt einen Teller Canapés und spielt uns anschließend eine Mozart-Ouvertüre auf seinem Cello vor; wir applaudieren, Dimitrij am lautesten. Während des Hauptgangs, einem Wildgericht, dem Serow ausgiebig zuspricht, klärt uns Dimitrij über die jüngsten sowjetischen Errungenschaften in den Künsten, der Weltraumfahrt und der Förderung des Weltfriedens auf. Nach dem Essen spielt Iwan uns eine schwierige Komposition von Strawinsky vor. Wir applaudieren, erneut übertroffen von Dimitrij. Gegen zehn Uhr gleitet die Limousine wieder in die Einfahrt, und Iwan bricht mit seinem Cello auf, Dimitrij an seiner Seite.
Ein paar Wochen später wurde Iwan nach Moskau zurückbeordert. Ich erfuhr nie, was in seiner Akte stand, ob er nun beim KGB gewesen war oder beim GRU und ob er tatsächlich Iwan Serow hieß, also kann ich mich an ihn erinnern, wie ich ihn erlebt habe: Kultur-Serow, wie ich ihn nannte, ein heiterer Kunstliebhaber, der ab und an wehmütig mit dem Gedanken spielte, in den Westen zu gehen. Vielleicht hatte er so etwas signalisiert, doch ohne die feste Absicht, es auch durchzuziehen. Und ziemlich sicher arbeitete er für den KGB oder die GRU, anders wäre seine große Bewegungsfreiheit nicht denkbar. Statt ›Kultur‹ lies also ›Spionage‹. Kurz gesagt: wieder einfach nur ein Russe, der hin- und hergerissen ist zwischen der Liebe zur Heimat und dem unerreichbaren Traum von einem freieren Leben.
Hat er in mir einen Spionagekollegen gesehen? Einen Schulz? Wenn der KGB seine Hausaufgaben gemacht hatte, dann dürfte er wohl kaum übersehen haben, was ich war. Ich hatte nie ein Auswahlverfahren des Diplomatischen Diensts durchlaufen, hatte nie an einem dieser rauschenden Landhausfeste teilgenommen, auf denen angeblich die gesellschaftlichen Umgangsformen zukünftiger Diplomaten getestet werden. Ich hatte nie eine Fortbildung des Foreign Office besucht oder auch nur das Foreign Office in Whitehall von innen gesehen. Ich war aus dem Nichts kommend in Bonn aufgetaucht und hatte unverschämt gut Deutsch gesprochen.
Und wenn das alles noch nicht reichte, um mich als Spion auszumachen, gab es da noch die adleräugigen Frauen der Beamten im Auswärtigen Dienst, die ebenso wachsam wie jeder Rechercheur beim KGB die Rivalen ihrer Gatten überwachten, wenn es um Beförderungen, Orden und möglichen Ritterschlag ging. Ein Blick auf meine Referenzen, und sie wussten, dass sie sich meinetwegen keine Sorgen zu machen brauchten. Ich gehörte nicht zur Familie. Ich war ein Freund, so nennen seriöse Briten im Auslandsdienst den Spion, den sie nur widerwillig als einen der Ihren akzeptieren wollen.
8
Das Erbe
Es ist 2003. Ein von einem Chauffeur gesteuerter, kugelsicherer Mercedes holt mich bei Tagesanbruch an meinem Münchener Hotel ab und fährt mich das Dutzend Kilometer in die liebenswürdige bayerische Gemeinde Pullach, Hauptgewerbe Brauereien, die es heute nicht mehr gibt, und Spionage, die es immer geben wird. Ich bin zu einem Arbeitsfrühstück mit Dr. August Hanning, zu diesem Zeitpunkt Präsident des Bundesnachrichtendienstes, und einer kleinen Gruppe seiner höheren Beamten verabredet. Hinter dem bewachten Tor passieren wir niedrige Gebäude, die halb hinter Bäumen verborgen und von Tarnnetzen überzogen sind, und gelangen an ein hübsches, weißgestrichenes Landhaus. Dr. Hanning wartet an der Tür auf mich. Wir haben noch etwas Zeit, sagt er. Ob ich mich mal umschauen wolle? Danke, Herr Doktor, sehr gern.
Während meiner Zeit in Bonn und Hamburg fünfundzwanzig Jahre zuvor hatte ich keinerlei Kontakt zum BND. Ich war niemals offiziell ›vorgestellt‹ worden, und die berühmte Zentrale hatte ich erst recht nicht betreten. Doch als die Mauer fiel – ein Ereignis, das keiner der Geheimdienste vorausgesagt hatte – und die britische Botschaft in Bonn sich zu ihrer Überraschung gezwungen sah, die Koffer zu packen und nach Berlin umzuziehen, hatte es sich unser damaliger Botschafter – ganz mutig – in den Kopf gesetzt, mich zur Feier dieses Umzugs nach Bonn einzuladen. Ich hatte in der Zwischenzeit einen Roman mit dem Titel Eine kleine Stadt in Deutschland geschrieben, der weder mit der britischen Botschaft noch mit der provisorischen Bonner Regierung zimperlich umging. Ich hatte – fälschlicherweise, wie sich herausstellte – einen Rechtsruck Westdeutschlands vorausgesagt und mir eine Verschwörung britischer Diplomaten und westdeutscher Staatsdiener ausgedacht. Diese führte dann zum Tod eines unschuldigen Botschaftsangestellten, der entschlossen war, eine unbequeme Wahrheit ans Licht zu bringen.
Ich war also nicht gerade die Idealbesetzung für den Part, den Vorhang vor der alten Botschaft fallen zu lassen oder ihn vor der neuen Botschaft zu lüften. Der britische Botschafter, ein sehr kultivierter Mann, sah das allerdings anders. Nein, er ließ mich nicht nur bei der Schlussfeier eine (wie ich hoffe) spritzige Rede halten, er lud in seine Residenz am Rhein auch alle echten Pendants zu den fiktiven deutschen Beamten ein, über die ich in meinem Roman hergezogen hatte. Als Gegenleistung für ein großartiges Diner erwartete er von jedem von ihnen, eine Rede in der Rolle der jeweiligen Figur des Romans zu halten.
Dr. August Hanning, der die abstoßendste Rolle in meinem fiktiven Ensemble zu übernehmen hatte, zeigte sich der Aufgabe sportlich und witzig gewachsen. Hut ab vor dem Mann.
Und nun sind wir also ein Vierteljahrhundert später in Pullach, Deutschland ist tatsächlich wiedervereinigt, und Hanning wartet an der Tür seines stattlichen weißen Hauses auf mich. Ich bin zwar noch nie hier gewesen, kenne aber, wie jeder andere auch, die grundlegenden Fakten der Geschichte des BND: wie General Reinhard Gehlen, Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost im Heeresnachrichtendienst, irgendwann gegen Ende des Krieges sein kostbares Archiv über die Sowjets nach Bayern schaffte und es dort vergrub. Mit dem amerikanischen OSS, dem Vorgänger der CIA, handelte er dann einen Deal aus: Er würde sein Archiv, seine Mitarbeiter und sich selbst ausliefern, wenn man ihn als Präsidenten eines antisowjetischen Nachrichtendienstes unter amerikanischem Kommando einsetzte. Der Dienst sollte Organisation Gehlen genannt werden, Org für Eingeweihte.
Es gibt natürlich mehrere Zwischenschritte, ja sogar eine Art Brautwerbung. Gehlen, eigentlich noch immer Gefangener der Amerikaner, wird nach Washington eingeflogen. Allen Dulles, Amerikas Topspion und Gründungsdirektor der CIA, mustert ihn eingehend und mag Gehlens Art. Gehlen wird hofiert und umschmeichelt, er besucht sogar ein Baseballmatch, aber er bewahrt sich jene wortkarge, distanzierte Haltung, die in der Welt der Spionage nur allzu schnell als Zeichen unergründlichen Tiefgangs gilt. Niemand scheint zu wissen oder sich dafür zu interessieren, dass Gehlen während seiner Spionagetätigkeit für den Führer in der Sowjetunion auf ein Täuschungsmanöver der Russen hereingefallen ist, das einen Großteil seines Archivs wertlos macht. Nun gibt es einen neuen Krieg, und Gehlen ist unser Mann. 1946 wird er, zu diesem Zeitpunkt wohl kein Gefangener mehr, als Chef des gerade erst gegründeten westdeutschen Nachrichtendienstes eingesetzt, der unter dem Schutz der CIA steht. Alte Kameraden aus Kriegstagen bilden den Kern von Gehlens Stab. Kontrollierte Amnesie macht aus Vergangenheit Geschichte.
Mit der willkürlichen Entscheidung, ehemalige und selbst gegenwärtige Nazis seien schon qua definitionem dem antikommunistischen Lager zuzurechnen, hatten sich Dulles und seine westlichen Alliierten auf höchstem Niveau etwas vorgemacht. Wie jedes Schulkind weiß, wird man mit einer dunklen Vergangenheit leicht Opfer von Erpressung. Kommen außerdem noch schwelender Unmut über die militärische Niederlage, Ehrverlust und unausgesprochener Zorn über die massiven Luftangriffe auf die geliebte Heimatstadt – Dresden, zum Beispiel – dazu, dann ergibt das eine wirkungsvolle Gemengelage für die Anheuerung von Agenten, wie sie sich KGB und Stasi nicht besser hätten wünschen können.
Der Fall Heinz Felfe steht für viele andere. Als er 1961 schließlich verhaftet wurde – ich war zu dem Zeitpunkt zufällig in Bonn –, hatte Felfe, ein Dresdener, für den SD des Reichsführers SS spioniert, für den MI6, die Stasi und den KGB, in dieser Reihenfolge – ach, und natürlich auch für den BND, wo er als hochgeschätzter Akteur im Katz-und-Maus-Spiel gegen die Geheimdienste der Sowjets galt. Und das mochte wohl so sein, denn seine sowjetischen und ostdeutschen Zahlmeister fütterten ihn mit allerlei überschüssigen Agenten in ihren Diensten, damit ihr bester Mann innerhalb der Org jemanden enttarnen und dafür den Ruhm einheimsen konnte.
Bis die Org 1956 in Bundesnachrichtendienst umbenannt wurde, hatten Felfe und ein Mitstreiter namens Clemens, ebenfalls Dresdener und ein maßgeblicher Akteur im BND, den Russen die gesamte Schlachtordnung des BND geliefert, darunter die Identität von siebenundneunzig Spionen, die sich im Ausland verborgen hielten. Ein Volltreffer. Doch Gehlen, der Effekthascher und Phantast, schaffte es, bis 1968 im Amt zu bleiben, und am Ende arbeiteten neunzig Prozent seiner Agenten im Osten Deutschlands für die Stasi, während daheim in Pullach sechzehn Angehörige seiner Großfamilie auf der Lohnliste des BND standen.
Niemand kann diskreter die innere Fäulnis einer Organisation in Gang setzen als ein Spion. Niemandem gelingt es besser, Aufträge zu verzögern. Niemand ist effektiver darin, ein Bild von geheimnisvoller Allwissenheit zu erzeugen und sich dahinter zu verstecken. Niemand kann besser vorgaukeln, mehr zu wissen als die Öffentlichkeit, die keine andere Wahl hat, als immense Summen in zweitklassige Spionagearbeit zu investieren, die durch Geheimniskrämerei bei der Beschaffung glänzt und nicht durch tatsächliche Erkenntnisse. Aber das gilt nicht nur für den BND.
Wir sind in Pullach, wir haben noch etwas Zeit, und Hanning führt mich durch sein prächtiges, dezent englisch wirkendes Landhaus. Ich bin beeindruckt, und das ist wohl auch so beabsichtigt, von dem imposanten Konferenzraum mit dem polierten langen Tisch, den Landschaftsgemälden aus dem 20. Jahrhundert und dem ansprechenden Ausblick auf einen Innenhof, in dem Skulpturen von KdF-Jungen und -Mädchen auf Podesten stehen und sich gegenseitig heroische Posen vorführen.
»Doktor Hanning, das ist wirklich bemerkenswert«, sage ich höflich.
Und dieser antwortet mit dem leichten Anflug eines Lächelns: »Ja. Martin Bormann hatte einen unheimlich guten Geschmack.«
Ich folge Hanning eine steile Steintreppe hinunter, bis wir in Martin Bormanns Version des Führerbunkers stehen, komplett ausgestattet mit Betten, Telefonen, Latrinen, Luftumwälzanlagen und was immer sonst dem Überleben von Hitlers liebstem Schergen dienen konnte. All dies, so versicherte mir Hanning mit seinem typischen ironischen Lächeln, steht nach bayerischem Gesetz auf der Denkmalliste.
Hier also haben sie Gehlen 1947 hingebracht, denke ich. In genau dieses Haus. Er bekam seine Lebensmittelrationen, sauberes Bettzeug, seine Akten und Karteien aus der Nazizeit und auch seinen Stab aus der Nazizeit. Zur gleichen Zeit suchten Teams von Nazijägern unkoordiniert nach Martin Bormann, und die Welt erfuhr von den unbeschreiblichen Gräueln von Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald und Auschwitz. Hier also kamen Reinhard Gehlen und seine ehemaligen Geheimpolizisten wieder ins Amt: auf Bormanns Landsitz, den er so bald nicht wieder brauchen wird. Eben war Hitlers doch nicht so guter Meisterspion noch auf der Flucht vor der russischen Rache, nun aber ist er der gehätschelte Günstling seiner neuen besten Freunde, der siegreichen Amerikaner.
Vielleicht hätte ich in meinem Alter nicht mehr so überrascht schauen sollen. Das zumindest verrät das ironische Lächeln meines Gastgebers. War ich denn nicht früher selbst einmal diesem Beruf nachgegangen? Hatte denn mein ehemaliger Dienst nicht bis 1939 fleißig Informationen mit der Gestapo ausgetauscht? Unterhielt er nicht freundschaftliche Kontakte zu Muammar Gaddafis Geheimdienstchef, und das bis in die letzten Tage von Gaddafis Herrschaft – Kontakte von derartiger Qualität, dass man seine politischen Gegner, auch Schwangere, schnappte und sie nach Tripolis schaffte, wo sie eingesperrt und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhört wurden?
Es wird Zeit für unser Arbeitsfrühstück, wir steigen die lange Steintreppe wieder hinauf. Als wir schnaufend oben ankommen – ich nehme an, dass wir in der Haupteingangshalle des Hauses sind, bin aber nicht sicher –, begrüßen mich von Pullachs Ruhmeswand zwei Gesichter aus der Vergangenheit: Admiral Wilhelm Canaris, Leiter der Abwehr, dem militärischen Geheimdienst, von 1935 bis 1944, und unser Freund General Reinhard Gehlen, der erste Präsident des BND. Canaris, ein in der Wolle gefärbter Nazi, aber kein Anhänger Hitlers, spielte nicht nur mit den rechtsgerichteten deutschen Widerstandsgruppen ein doppeltes Spiel, sondern auch mit dem britischen Geheimdienst, mit dem er während des Krieges immer mal wieder in Kontakt stand. Sein Doppelspiel holte ihn schließlich 1945 ein, er wurde ohne große Formalitäten verurteilt und von der SS grausam hingerichtet. Ein irgendwie tapferer und gescheiterter Held und sicherlich kein Antisemit – trotz allem aber ein Landesverräter. Was Gehlen betrifft, der ja im Krieg ebenfalls ein Verräter war, so ist im kalten Schein der Geschichte schwer zu erkennen, was denn Bewundernswertes von ihm bleibt, das über Skrupellosigkeit, seine überzeugende Art und die Fähigkeit des meisterlichen Schwindlers hinausgeht, der eigenen Lüge zu glauben.
Ist das aber schon alles, frage ich mich und betrachte diese beiden unangenehmen Gesichter. Sind diese Schurken die einzigen Vorbilder aus der Vergangenheit für die Berufseinsteiger des BND? Stellen Sie sich doch nur vor, was unsere britischen Berufsanfänger erwartet! Jeder Geheimdienst mythologisiert sich selbst, aber die Briten sind eine Klasse für sich. Lassen wir mal unseren erbärmlichen Auftritt im Kalten Krieg beiseite, als uns der KGB fast auf Schritt und Tritt austrickste und infiltrierte. Blicken wir doch lieber zurück auf den Zweiten Weltkrieg, denn dort finden wir, wenn wir unseren Fernsehsendern und Boulevardzeitungen Glauben schenken wollen, Grund für Nationalstolz. Schauen Sie sich unsere brillanten Code-Knacker in Bletchley Park an! Schauen Sie sich unser teuflisch einfallsreiches Double-Cross-System an und die großen Täuschungsmanöver bei der Landung am D-Day, oder unsere unerschrockenen Funker und Saboteure, die hinter den feindlichen Linien absprangen! Wenn solche Helden vor ihnen hermarschieren, wie sollten unsere neuen Rekruten von der Vergangenheit ihres Dienstes dann nicht inspiriert sein.
Und vor allem: Wir haben gewonnen, also schreiben wir die Geschichte.
Nur der arme alte BND kann seinem Nachwuchs keine so herzerwärmende Mythologie bieten. Er kann ja schlecht mit der Operation Nordpol von Canaris’ Abwehr angeben, auch als Das Englandspiel bekannt. Das war eine brillante Täuschung, die die SOE, die Special Operations Executive, drei Jahre lang dazu verleitete, über fünfzig mutige holländische Agenten dem sicheren Tod in den besetzten Niederlanden auszuliefern. Auch auf dem Gebiet der Entschlüsselung leisteten die Deutschen Beeindruckendes – aber was hat das gebracht? Der BND kann die erwiesenermaßen hohen Gegenspionagefähigkeiten eines Klaus Barbie nicht geltend machen. Barbie, ehemals Gestapo-Chef in Lyon, seit 1965 Informant beim BND, hatte, wie erst nach längerer Vertuschung durch die Alliierten herauskam, persönlich Dutzende von Mitgliedern der französischen Résistance gefoltert. Nachdem er zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, starb er in einem ebenjener Gefängnisse, in denen er einst selbst die schlimmsten Grausamkeiten begangen hatte. Im Vorfeld allerdings war er offenbar noch von der CIA angeheuert worden, um Che Guevara aufzuspüren.
Während ich dies schreibe, ist Dr. Hanning, der nun eine eigene Anwaltskanzlei hat, ins Kreuzfeuer eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses geraten, der die Einsätze ausländischer Geheimdienste in Deutschland und das mögliche Einverständnis oder die Mitarbeit deutscher Nachrichtendienste ermittelt. Wie bei allen Untersuchungen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, steht auch diese im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Anschuldigungen, Anspielungen und Medienberichte mit nicht namentlich genannten Quellen überschlagen sich. Der aufsehenerregendste Vorwurf ist allem Anschein nach kaum glaubhaft: Der BND soll mit seiner Signalaufklärung, absichtlich oder durch bürokratische Nachlässigkeit, seit 2002 der amerikanischen National Security Agency (NSA) geholfen haben, deutsche Staatsbürger und Institutionen auszuspionieren.
Nach der bisherigen Beweislage kann dies nicht stimmen. 2002 schlossen BND und NSA eine Übereinkunft, in der kategorisch festgehalten wurde, dass deutsche Ziele ausgeschlossen sind. Filtermechanismen wurden eingebaut, um diese Übereinkunft abzusichern. Haben die Filter versagt? Und wenn ja, war dies menschliches oder technisches Versagen – oder einfach nur das Ergebnis zunehmend laxer Kontrollen? Und hat die NSA womöglich beschlossen, die deutschen Verbündeten nicht damit zu behelligen, als sie den Fehler entdeckten?
Für die Beobachter im Bundestag, die sicher besser informiert sind als ich, ist eine denkbare Antwort, dass das Kanzleramt dabei versagte, seiner Aufsichtspflicht gegenüber dem BND nachzukommen, dass der BND dabei versagte, sich selbst zu überwachen, und dass es wohl Kooperation mit der NSA gab, aber keine geheimen Absprachen. Wahrscheinlich werden, wenn Sie dies lesen, bereits weitere Komplikationen ans Licht und neue Zweideutigkeiten aufgetaucht sein, und keinem wird die Schuld zugewiesen, außer der Geschichte.
Am Ende trägt die Geschichte womöglich tatsächlich die einzige Schuld. Als die amerikanische Signalaufklärung in den frühen Nachkriegsjahren zum ersten Mal ihre Netze über das junge Westdeutschland auswarf, tat Adenauers Regierung, was man ihr sagte, und man sagte ihr nicht viel. Im Laufe der Zeit mag sich dieses Verhältnis geändert haben, aber wohl nur auf kosmetischer Ebene. Die NSA spionierte weiter, ohne sich vom BND beaufsichtigen zu lassen, und man kann sich nur schwer vorstellen, dass dies nicht auch von Anfang an einschloss, alles auszuspionieren, was sich im Gastland bewegte. Spione spionieren, weil sie es können.
Der Gedanke, der BND habe irgendwann einmal tatsächlich Kontrolle über die NSA ausgeübt, scheint mir völlig aus der Luft gegriffen: erst recht wenn es um die Auswahl deutscher und europäischer Ziele durch die NSA ging. Heute ist die Botschaft der NSA klar und deutlich: Falls Sie wollen, dass wir Ihnen etwas über die Terrorbedrohung in Ihrem Land verraten, dann halten Sie besser den Mund und machen sich an die Arbeit.
Unmittelbar nach den Snowden-Enthüllungen gab es auch in Großbritannien vergleichbare Untersuchungen, die ähnlich getrickste Ergebnisse brachten. Auch dort ging es um so heikle Angelegenheiten wie die, bis zu welchem Ausmaß unsere Signalaufklärung etwas für Amerika tat, was Amerika nach eigenen Gesetzen verboten war. Bei all dem Aufsehen, das damit einherging, ist die britische Öffentlichkeit Verschwiegenheit nicht mehr gewöhnt, und Verstöße gegen die eigene Privatsphäre lässt man sich widerstandslos gefallen. Wurden Gesetze gebrochen, modelt man sie eilig um, mit dem Ziel, den Verstoß zu kaschieren. Wenn die Loyalität gegenüber den Vereinigten Staaten unterminiert ist, so das Argument, was wird dann aus uns?
Deutschland jedoch, das in einer einzigen Generation Faschismus und Kommunismus erlebt hat, nimmt es nicht einfach so hin, wenn staatliche Spione die Angelegenheiten der eigenen ehrlichen Bürger ausspionieren; schon gar nicht, wenn sie dies auf Geheiß und zum Wohl einer ausländischen Supermacht tun, mit der man ja angeblich verbündet ist. Was man in Großbritannien ›besondere Beziehungen‹ nennt, heißt in Deutschland ›Verrat‹. Ich gehe allerdings davon aus, dass in diesen turbulenten Zeiten kein klares Urteil ergehen wird, bevor dieses Buch gedruckt ist. Das deutsche Parlament wird zu Wort kommen, die größere Frage des Kampfes gegen den Terror wird heraufbeschworen und den besorgten Bürgern Deutschlands nahegelegt werden, nicht die Hand zu beißen, die sie beschützt, auch wenn diese Hand ab und zu mal grabscht.
Doch falls, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, der schlimmste anzunehmende Fall tatsächlich bewiesen werden kann, was könnte man dann noch zur Strafmilderung vorbringen? Vielleicht nur die Tatsache, dass der BND nicht genau weiß, was er sein will, aber das gilt ja für jeden anderen auch, der sich seiner Herkunft schämt. Gegenseitiger Informationsaustausch mit einem übermächtigen Nachrichtendienst ist schon in guten Zeiten kein Zuckerschlecken, vor allem dann nicht, wenn man es mit jenem Land zu tun hat, das einen zur Welt gebracht und die ersten Windeln gewechselt hat, einen mit Taschengeld versorgt und die Hausaufgaben kontrolliert hat. Noch härter wird es dann, wenn dieser Elternstaat große Teile seiner Außenpolitik den eigenen Spionen übertragen hat, wie es die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren nur allzu häufig praktiziert haben.
9
Murat Kurnaz ist unschuldig
Ich sitze in einem Zimmer in einem oberen Stockwerk eines Bremer Hotels und schaue auf die Sportanlage einer Schule. Murat Kurnaz, Deutsch-Türke, in Bremen geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen, ist gerade, 2006, nach fünf Jahren Haft in Guantánamo freigelassen worden. Er wurde in Pakistan verhaftet und für dreitausend Dollar an die Amerikaner verkauft, dann zwei Monate lang in einem amerikanischen Folterzentrum in Kandahar festgehalten; dort hat man ihn mit Stromschlägen traktiert, bewusstlos geprügelt, ›Waterboarding‹ unterzogen und so lange an einem Haken baumeln lassen, dass er, trotz all seiner physischen Robustheit, dem Tode nahe war. Nach einem Jahr Haft in Guantánamo stellten seine amerikanischen und deutschen Vernehmenden – zwei vom BND, einer vom Bundesamt für Verfassungsschutz – fest, dass er harmlos und naiv sei und keinerlei Risiko für deutsche, amerikanische oder israelische Interessen darstelle.
Nun gibt es hier ein Paradox, das ich nicht mal im Ansatz auflösen, erklären oder gar beurteilen kann. Als ich Murat Kurnaz kennenlernte, hatte ich noch keine Ahnung, dass Dr. Hanning irgendeine Rolle im Zusammenhang mit Kurnaz’ Schicksal gespielt hatte, geschweige denn eine entscheidende. Nun bekam ich zu hören, dass Hanning als Präsident des BND nur ein paar Wochen zuvor bei einem Treffen hoher Beamter und Leiter der Geheimdienste, trotz gegenteiliger Empfehlung von Angehörigen seines eigenen Dienstes, ausdrücklich gegen die Rückkehr von Kurnaz gestimmt hatte. Wenn Kurnaz aus Guantánamo entlassen werden solle, dann in die Türkei, wo er hingehöre. Man könne nicht sicher sein, dass Kurnaz in der Vergangenheit nicht doch Terrorist gewesen sei oder in Zukunft einer werden könnte, so offenbar Hannings verschrobene Begründung.
2004 hatten Polizei und Verfassungsschutz des Landes Bremen erklärt, Kurnaz habe seine abgelaufene Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert – ein lässliches Versehen, sollte man meinen, angesichts des Mangels an Stift, Tinte, Briefmarken und Schreibpapier in den Käfigen von Guantánamo –, deshalb müsse man ihn des Landes verweisen. Dieser Bremer Bescheid wurde umgehend von einem ordentlichen Gericht kassiert, doch Hanning hat seine Haltung bis heute nicht revidiert.
Wenn ich etwa sechzig Jahre zurückdenke, dann finde ich mich in derselben Zwickmühle wieder; während des Kalten Krieges hatte ich in erheblich bescheidenerer Position als Hanning ebenfalls die Pflicht, mein Urteil über Personen zu fällen, die wohl oder übel in gewisse Kategorien fielen – ehemalige kommunistische Sympathisanten, heimliche Parteimitglieder und so weiter. Oberflächlich betrachtet, erfüllte Kurnaz in jungen Jahren ziemlich viele Kriterien. In Bremen hat er regelmäßig eine Moschee besucht, in der radikale Ansichten gepredigt wurden. Bevor er nach Pakistan reiste, hat er sich einen Bart wachsen lassen und seine Eltern gedrängt, sich strenger an den Koran zu halten. Und als er schließlich ausreiste, tat er dies im Geheimen und ohne seinen Eltern Bescheid zu sagen, eine ganz schlechte Idee. Seine Mutter war darüber so beunruhigt, dass sie zur Polizei ging und dort angab, dass ihr Sohn in der Abu-Bakr-Moschee radikalisiert worden sei, dschihadistische Pamphlete lesen würde und beabsichtige, in Tschetschenien oder Pakistan am Dschihad teilzunehmen. Andere Türken in Bremen wussten, aus welchen Gründen auch immer, ganz ähnliche Geschichten zu erzählen. Aber wen wundert’s? Ihre Gemeinschaft wurde von Misstrauen, Verzweiflung und dem Akt gegenseitiger Schuldzuweisung erschüttert. War denn nicht der Plan, die Twin Towers in New York zu zerstören, nur wenige Kilometer entfernt in Hamburg von Glaubensbrüdern ausgeheckt worden? Kurnaz selbst hat immer wieder erklärt, dass der einzige Zweck seiner Reise nach Pakistan darin bestanden habe, sich islamisch weiterzubilden. Dass die Summe aller Kriterien keinen Terroristen ergab, ist historische Tatsache. Kurnaz hat keinerlei Verbrechen begangen und musste trotz seiner Unschuld ungeheuer leiden. Doch wenn ich an die lang vergangenen Tage denke, als ich mit denselben Kriterien innerhalb eines ähnlichen Klimas der Angst konfrontiert war, dann kann ich nicht einschätzen, ob ich mich damals zu Kurnaz’ Verteidigung erhoben hätte.
Nun sitzen wir gemütlich in dem Hotelzimmer in Bremen, trinken Kaffee, und ich frage Kurnaz, wie er es geschafft hat, sich mit seinen Mithäftlingen in den Nachbarzellen zu verständigen. Schließlich war doch jeder Kontakt untereinander unter Androhung von sofortiger Prügel und Einschränkungen verboten. Kurnaz muss unter der notgedrungen gekrümmten Haltung angesichts seiner schieren Körpergröße besonders gelitten haben – er passte wohl nur mit Mühe in einen Käfig, in dem er dreiundzwanzig Stunden weder sitzen noch stehen konnte. Nach einer seiner kurzen, nachdenklichen Pausen, an die ich mich langsam gewöhne, antwortet er: Wir mussten sehr vorsichtig sein. Nicht nur wegen der Wachen, sondern auch wegen anderer Gefangener. Keiner fragte, warum man dort war. Keiner fragte, ob man zu al-Qaida gehörte. Aber wenn man Tag und Nacht nur ein paar Schritte entfernt von einem anderen Gefangenen kauert, ist es nur natürlich, dass man früher oder später versucht, Kontakt aufzunehmen.
* Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es noch achtzig Gefangene in Guantánamo. Für sechsundzwanzig von ihnen war eine Ausreise bereits genehmigt.
Da war zunächst mal das winzige Handwaschbecken, aber das wurde eher zur allgemeinen Kontaktaufnahme benutzt. Zu einer vorher vereinbarten Stunde – wie sie vereinbart wurde, will Kurnaz nicht sagen, da viele seiner Mitstreiter noch immer eingesperrt sind* – benutzten sie die Waschbecken nicht mehr, sondern flüsterten durch den Abfluss. Sie konnten kein Wort verstehen, aber das allgemeine Gemurmel, das zu hören war, vermittelte ihnen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit.
Und da war noch der Suppenbecher aus Styropor, der in der Essensklappe stand, daneben ein harter Brotkanten. Sie tranken die Suppe aus, brachen ein daumennagelgroßes Stück aus dem Becherrand, während sie nur hoffen konnten, dass die Wachen nichts bemerkten. Dann drückten sie mit dem Fingernagel, den sie sich extra dafür hatten wachsen lassen, ein Koranzitat auf Arabisch in das Styroporstück. Sie legten ein Bröckchen Brot zurück, kauten es zu einem Kügelchen und ließen es trocknen. Einen Faden, den sie aus ihrem Overall zogen, banden sie mit einem Ende um die Brotkugel und mit dem anderen um das Styroporstück. Die Kugel diente als Gewicht; sie warfen sie durch die Gitterstäbe zum Nachbarn, der zog den Baumwollfaden und das Styroporstück in seinen Käfig.
Und nach einer Weile bekam man Antwort.
Es war nur recht und billig, dass ein unschuldiger Mann wie Kurnaz, der selbst nach den schwer nachvollziehbaren rechtlichen Maßstäben Guantánamos fünf Jahre lang zu Unrecht eingesperrt blieb und nun endlich nach Hause geschickt wurde, zu seiner Freilassung eine Sondermaschine von Guantánamo zum Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland nehmen durfte. Für den Flug bekam er frische Unterwäsche, eine Jeans und ein weißes T-Shirt. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählten zehn amerikanische Soldaten, die ihn während des Flugs bewachten, und als Kurnaz dem deutschen Empfangskomitee übergeben wurde, bot der amerikanische Offizier, der das Kommando führte, seinem deutschen Gegenüber ein leichteres, bequemeres Paar Handschellen an, worauf dieser folgende ehrenwerte Aussage traf:
»Er hat kein Verbrechen begangen. Hier in Deutschland ist er ein freier Mann.«
August Hanning ist da ganz anderer Ansicht.
2002 hatte Hanning noch erklärt, Kurnaz stelle eine Bedrohung der inneren Sicherheit des Landes dar. Soweit ich weiß, wurden seine Gründe, warum er die deutschen und amerikanischen Verhörer überstimmte, nie erläutert. Doch selbst noch fünf Jahre später bekräftigte Hanning, nun als Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für die Geheimdienste zuständig, seinen Widerstand gegen Kurnaz’ Verbleib in Deutschland – eine wichtige Streitfrage, da doch Kurnaz sich wieder auf deutschem Boden befand. Er kritisierte auch, dass die Mitarbeiter des BND, die das Verhör durchgeführt hatten, ihre Kompetenzen überschritten hätten; dabei standen sie direkt unter seinem Kommando, als sie Kurnaz für ungefährlich erklärten.
Und als ich selbst, wenn auch recht spät im Verlauf, als einer von Kurnaz’ Fürsprechern auftrat, machte mich Hanning, den ich noch immer sehr schätze, freundlich darauf aufmerksam, dass meine Sympathie unangebracht sei, ohne mir dafür irgendeinen Grund zu nennen. Und da ein solcher Grund nie an die Öffentlichkeit gedrungen oder Kurnaz’ hochangesehenem Anwalt zugekommen ist, konnte ich Hannings Hinweis nicht nachvollziehen. Gab es also einen schwerwiegenderen Grund? Man könnte es fast annehmen. War es politisch notwendig, Kurnaz zu dämonisieren? Stürzte sich Hanning, den ich als ehrenwerten Mann kenne, in sein eigenes Schwert?
* Auf Deutsch 2007 erschienen unter dem Titel Fünf Jahre meines Lebens, Rowohlt Berlin.
Vor kurzem war Kurnaz auf Lesereise in England, um für sein Buch* zu werben, in dem er seine Erfahrungen beschreibt. Es war in Deutschland gut angekommen und ist seither in eine ganze Reihe von Sprachen übersetzt worden. Ich hatte es überschwänglich besprochen. Vor Beginn seiner Rundreise verbrachte Kurnaz eine Weile bei uns in Hampstead, wo er auf Vorschlag des Menschenrechtsanwalts Philippe Sand, einem Kronanwalt, eingeladen worden war, ohne Vorankündigung den Studenten der University College School einen Vortrag zu halten. Kurnaz sagte zu und sprach wie immer: einfach und genau, in dem flüssigen Englisch, das er sich selbst in Guantánamo beigebracht hatte, nicht zuletzt dank seiner Untersuchungsbeamten. Vor einem vollen Auditorium von Studenten, Gläubigen wie Nichtgläubigen, beschrieb er, dass allein sein muslimischer Glaube ihn am Leben gehalten habe. Er weigerte sich, seinen Wachen oder Folterern irgendwelche Schuld zu geben. Wie üblich erwähnte er Hanning mit keinem Wort, auch keinen anderen deutschen Beamten oder Politiker, der sich gegen seine Rückkehr ausgesprochen hatte. Er sagte noch, dass er bei seiner Freilassung den Wärtern seine Heimatadresse in Deutschland gegeben habe, für den Fall, dass ihre Taten sie eines Tages zu sehr quälten. Erst als er seine Verpflichtung gegenüber den Mitgefangenen beschreibt, die zurückgeblieben sind, zeigt er Gefühle. Er wird nicht schweigen, sagt er, solange auch nur ein Mann noch in Guantánamo sitzt. Nach seiner Rede ist der Ansturm der Zuhörer, die ihm die Hand schütteln wollen, so groß, dass sie sich anstellen müssen.
In meinem Roman Marionetten tritt ein in Deutschland geborener Türke im Alter von Murat Kurnaz auf, er teilt dessen Glauben und Hintergrund. Meine Figur heißt Melik, und er zahlt einen ähnlichen Preis für Verbrechen, die er nicht begangen hat. In Haltung, Sprechweise und Benehmen ähneln die beiden sich sehr.
10
Feldforschung
Mein Schreibtisch in Cornwall steht in der Mansarde einer Scheune, die aus Granitblöcken am Rand einer Klippe gebaut ist. Schaue ich an einem sonnigen Julimorgen wie diesem hinaus, dann sehe ich nur den geradezu lächerlich mediterran wirkenden blauen Atlantik vor mir. Eine Reihe von schlanken, schnittigen Segelbooten legt sich in eine leichte Brise aus Ost. Freunde, die uns besuchen kommen, halten uns gerne, je nach Wetterlage, entweder für verrückt oder für gesegnet, und heute sind wir gesegnet. Auf dieser Landspitze kesselt uns das Wetter ein, wann immer ihm danach ist. Tagelange Sturmböen, dann Waffenstillstand und plötzliche Stille. Zu jeder beliebigen Jahreszeit kann sich eine dichte Nebelwand über unserer Halbinsel aufbauen, und kein noch so starker Regenschauer vermag sie aufzulösen.
Ein paar hundert Meter von meiner Scheune weiter landeinwärts lebt eine Familie von Schleiereulen in einer baufälligen alten Kate, sie gehört zu einem Bauernhof mit dem schönen Namen Boscawen Rose. Ich habe die Vögel nur ein einziges Mal zusammen gesehen: zwei Altvögel und vier Küken, die sich auf einem kaputten Fensterbrett für das Familienfoto nebeneinander aufgestellt haben. Leider hatte ich keine Gelegenheit, dieses Foto zu schießen. Seitdem habe ich nur mit einem der Altvögel Kontakt – zumindest glaube ich das, aber es könnte auch genauso gut irgendein anderer Vogel der erweiterten Familie sein, denn die Jungen sind schon lange groß. Vater Eule, denn als diesen sehe ich ihn, ist mein heimlicher Verbündeter, der mir auf mysteriöse Weise, schon lange bevor er an meinem Westfenster vorbeistreicht, sein Eintreffen ankündigt. Manchmal sitze ich hier, arbeite konzentriert und mit gesenktem Kopf vor mich hin; doch trotzdem bemerke ich seine goldweißen Umrisse, wenn er tief über dem Boden unter meinem Fenster vorbeihuscht. Soweit ich weiß, hat er keine Feinde. Weder die Raben von der Klippe noch die Wanderfalken legen sich mit ihm an.
Vater Eule spürt außerdem auf einer geradezu unheimlichen Ebene, die wir menschlichen Spione wohl für übersinnlich halten könnten, wenn er beobachtet wird. Draußen reicht eine abschüssige Weide bis an die Felskante. Vater Eule schwebt gerade einen knappen halben Meter über dem hohen Gras, um sich dann auf eine unvorsichtige Wühlmaus zu stürzen. Wenn ich aber auch nur daran denke, den Kopf zu heben, bricht er den Einsatz ab und verschwindet über die Klippe. Mit etwas Glück wird er mich bis zum Abend vergessen haben, dann aber wird er wieder auftauchen, und ich werde die milch- und honigfarbenen Spitzen seiner Flügel zittern sehen. Und dann, so habe ich mir geschworen, hebe ich den Kopf nicht.
An einem sonnigen Frühlingstag im Jahre 1974 landete ich in Hongkong und stellte fest, dass jemand zwischen Hong Kong Island und der Festlandsseite Kowloon unter dem Meer einen Tunnel gegraben hatte, ohne dass ich etwas davon mitbekommen hatte. Ich hatte gerade die Korrekturen zu meinem Roman Dame, König, As, Spion abgeliefert. Jeden Augenblick sollten die fertigen Exemplare die Druckmaschinen verlassen. Zu den angelegten Höhepunkten des Buchs gehört eine Verfolgungsjagd mit der Star Ferry über die Meerenge zwischen Kowloon und Hong Kong Island. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich diese Szene hier in Cornwall geschrieben und mich dabei einzig auf einen veralteten Reiseführer verlassen hatte. Nun musste ich bitter dafür büßen.
Das Hotel hatte ein Faxgerät. Ich zog mein Vorabexemplar des Romans aus dem Koffer, rief mitten in der Nacht meinen Agenten an und flehte ihn an, er solle die Verleger dazu bringen, die Druckmaschinen anzuhalten. War es für die USA schon zu spät? Das befürchtete er, wollte aber nachfragen. Nach ein paar weiteren Fahrten durch den Tunnel mit einem Notizblock auf den Knien schwor ich mir, nie wieder eine Szene an einem Ort spielen zu lassen, an dem ich nicht selbst gewesen war. Mein Agent hatte recht: Für die amerikanische erste Auflage war es zu spät.
Bei dieser Lektion ging es nicht nur um den Aspekt der Recherche. Es ging auch darum, dass ich in der Mitte des Lebens fett und faul geworden war und von einem Schatz vergangener Erfahrungen zehrte, der langsam zur Neige ging. Es war an der Zeit, mich unbekannten Welten zu stellen. Irgendwo im Hinterkopf schwirrte mir ein Satz von Graham Greene herum: Sinngemäß lautet er, dass man die Pflicht habe, menschliches Leid zu teilen, wenn man darüber berichten wolle.
Ob tatsächlich der Tunnel daran schuld war oder diese Einsicht eigentlich erst später kam, tut nichts zur Sache. Ich weiß nur, dass ich daraufhin mein Bündel geschnürt habe, um, ganz in der Tradition der deutschen Romantik, aufzubrechen und meine eigenen Erfahrungen zu sammeln: erst in Kambodscha und Vietnam, später in Israel und bei den Palästinensern, dann in Russland, Mittelamerika, Kenia und im östlichen Kongo. Diese Reise dauert nun schon vierzig Jahre; der Ausgangspunkt wird für immer Hongkong bleiben.
Nach ein paar Tagen dort hatte ich das große Glück, die Bekanntschaft ebenjenes Hugh David Scott (H. D. S.) Greenway zu machen, der später den vereisten Fußweg von meinem Chalet ohne seinen Reisepass hinunterstürmen sollte, um einer der letzten Amerikaner zu werden, die Phnom Penh noch verlassen konnten. Er plante gerade, für die Washington Post in die Kriegsgebiete aufzubrechen. Ob ich ihn begleiten wolle? Achtundvierzig Stunden später lag ich stocksteif vor Angst neben ihm in einem Schützengraben und spähte zu den Scharfschützen der Roten Khmer hinüber, die sich am anderen Ufer des Mekong eingegraben hatten.
Noch nie hatte jemand auf mich geschossen. Ich hatte eine andere Welt betreten, in der alle mehr Mut zu haben schienen als ich, ob nun die Kriegsberichterstatter oder die Bewohner; die gingen weiter ihrem Tagesgeschäft nach, auch wenn sie wussten, dass ihre Stadt ein paar Kilometer weiter draußen völlig von den Roten Khmer umzingelt war, dass sie jederzeit bombardiert werden konnten und die von den Amerikanern unterstützten Truppen unter Premierminister Lon Nol nichts mehr ausrichten konnten. Natürlich war das alles für mich eine neue Erfahrung, während sie alle alte Hasen waren. Wenn man nur lange genug mit der Gefahr lebt, dann gewöhnt man sich vielleicht daran – oder wird gar, was Gott verhüten möge, süchtig danach. Später in Beirut kam es mir tatsächlich so vor. Vielleicht bin ich aber auch nur einer von denen, die nicht glauben wollen, dass menschliche Konflikte unausweichlich sind.
Jeder hat so seine subjektiven Ansichten über den menschlichen Mut. Und jeder fragt sich, wo die eigene Belastungsgrenze liegt, wann sie erreicht ist und wie man im Vergleich zu anderen abschneidet. Ich jedenfalls weiß nur, dass mein Mut am größten war, als ich meine Angst unterdrücken musste; aber das ist ja wohl die Definition für den geborenen Feigling. Das erlebte ich meist dann, wenn die Menschen um mich herum größeren Mut bewiesen, als ich aufbringen konnte; und durch ihr Vorbild verliehen sie mir mehr Mut. Und die Mutigsten von allen, die ich auf meinen Reisen kennenlernte – andere würden sagen, die Verrücktesten –, waren eine zierliche französische Geschäftsfrau aus Metz namens Yvette Pierpaoli und ihr Partner Kurt, ein Schweizer und ehemaliger Kapitän zur See. Sie betrieben ein mehr oder weniger erfolgreiches Importgeschäft außerhalb von Phnom Penh, für das sie mehrere ältere einmotorige Flugzeuge unterhielten. Eine wilde Crew von Piloten flog über den von Pol Pot beherrschten Dschungel hinweg von Dorf zu Dorf, hatte Nahrungsmittel und medizinischen Nachschub an Bord und brachte kranke Kinder zurück in die relative Sicherheit von Phnom Penh.
Während die Roten Khmer die Schlinge rings um die Hauptstadt immer enger zogen, die Flüchtlingsfamilien von allen Seiten in die Stadt strömten und der wahllose Beschuss und die Autobomben Chaos verbreiteten, hatte Yvette Pierpaoli ihre wahre Aufgabe entdeckt: Kinder aus der Gefahr zu retten. Ihr bunt zusammengewürfelter Haufen aus südostasiatischen und chinesischen Piloten, die es gewohnt waren, Schreibmaschinen und Faxgeräte für Yvettes Handelsfirma zu transportieren, retteten nun Kinder und deren Mütter aus den umliegenden Dörfern, die schon bald Pol Pots Roten Khmer in die Hände fallen sollten.
Die Piloten, aber das dürfte wohl niemanden überraschen, waren im besten Fall Halbtagsheilige. Manche waren für Air America geflogen, die Fluglinie der CIA, andere hatten Opium geschmuggelt, die meisten beides zugleich. Kranke Kinder lagen mitunter zwischen Säcken voller Opium-Rohmasse oder Halbedelsteinen, erworben für harte Dollar in Pailin. Ein Pilot, mit dem ich einmal flog, fand es besonders witzig, mir zu zeigen, wie ich das Flugzeug landen musste, falls er zu high vom Morphium sein sollte, um es selbst zu schaffen. In dem Roman Eine Art Held, für den ich damals recherchierte, taucht er unter dem Namen Charlie Marshall auf.
Wenn es darum ging, Kindern Unterkunft und Hoffnung zu geben, die beides nicht hatten, kannte Yvette keine Angst. Zusammen mit ihr sah ich meine ersten Kriegstoten: blutüberströmte kambodschanische Soldaten, die übereinandergestapelt barfuß auf einem offenen Laster lagen. Jemand hatte ihnen die Stiefel gestohlen und sicherlich auch ihre Soldbücher, Armbanduhren und das bisschen Geld, das sie in den Kampf mitgenommen hatten. Der Laster stand neben einem Artilleriegeschütz, das offenbar völlig ziellos in den Dschungel feuerte. Um die Geschütze streiften kleine Kinder, die von dem Krach schon ganz taub waren. Umgeben von ihren jungen Müttern, deren Männer im Dschungel kämpften. Sie warteten auf ihre Rückkehr, und sie wussten, wenn es nicht dazu kam, würden ihre Kommandanten die Männer nicht als vermisst melden, sondern den Sold selbst einstreichen.
Yvette verbeugte sich, lächelte und bahnte sich einen Weg, setzte sich zu den Frauen und scharte die Kinder um sich. Keine Ahnung, was sie ihnen über den Lärm der Geschütze hinweg wohl sagte, doch schon bald lachten Mütter und Kinder. Und selbst die Männer an den Geschützen stimmten mit ein. In der Stadt hockten an den Straßenrändern kleine Jungen und Mädchen im Schneidersitz neben Literflaschen voller Benzin, das sie aus den Tanks der zerstörten Autos geklaut hatten. Wenn eine Bombe einschlug, entzündete sich der Treibstoff und die Kinder zogen sich Verbrennungen zu. Hörte Yvette vom Balkon ihres Hauses aus eine Explosion, dann sprang sie in ihr kleines klappriges Auto, das sie wie einen Panzer fuhr, und durchkämmte die Straßen nach Überlebenden.
Bis zum endgültigen Fall der Stadt unternahm ich noch weitere Reisen nach Phnom Penh. Bei meinem letzten Aufenthalt sah es ganz danach aus, als seien die indischen Ladenbesitzer und die Mädchen in ihren Rikschas die letzten Bewohner: Die Händler blieben, weil die Preise immer höher kletterten, je größer die Knappheit wurde; die Mädchen, weil sie in ihrer Naivität annahmen, dass ihre Dienste weiter gefragt wären, egal, wer gewann. Am Ende wurden sie von den Roten Khmer rekrutiert oder starben unter Entbehrungen auf den Killing Fields. Aus Saigon, wie es damals noch hieß, schrieb ich an Graham Greene, ich hätte Der stille Amerikaner erneut gelesen und festgestellt, dass der Roman wunderbarerweise überhaupt nicht veraltet war. Der Brief erreichte tatsächlich seinen Adressaten, womit ich nicht gerechnet hatte; Greene schrieb zurück und riet mir dringend, ins Nationalmuseum in Phnom Penh zu gehen und den mit Straußenfedern geschmückten Bowlerhut zu bewundern, mit dem die Khmer-Könige gekrönt worden waren. Ich musste ihm leider mitteilen, dass es den Bowlerhut nicht mehr gab; genauso wenig wie das Museum.
Yvette ist zur Heldin vieler wilder Geschichten geworden, von denen einige übertrieben sind, viele aber wahr, so unwahrscheinlich sie auch klingen mögen. Meine Lieblingsgeschichte, die ich direkt von ihr gehört habe – nicht unbedingt eine Garantie für deren Wahrheitsgehalt –, handelt davon, wie sie mit einer Gruppe von kambodschanischen Waisenkindern auf das französische Konsulat marschiert und für jedes Kind einen Pass verlangt.
»Aber wessen Kinder sind das denn?«, protestiert der bedrängte Konsul.
»Das sind meine. Ich bin die Mutter.«
»Aber sie sind doch alle gleich alt!«
»Und ich hatte mehrmals Fünflinge, Sie Idiot!«
Der Konsul gibt sich geschlagen und fragt nach den Namen der Kinder. Yvette zählt sie auf: »Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi …«
Yvette Pierpaoli verlor 1999 während eines Einsatzes für die Flüchtlinge im Kosovo ihr Leben, als ihr albanischer Fahrer von einer Gebirgsstraße abkam und ihr Wagen mehrere Hundert Meter tief in eine Schlucht stürzte; dabei starben auch das Ehepaar David und Penny McCall, von Refugees International, und der Fahrer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Yvette mit Unterstützung meiner Frau schon selbst ein Buch geschrieben, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Auf Deutsch ist es unter dem Titel Eine Frau für tausend Kinder erschienen. Sie wurde einundsechzig Jahre alt. Als sie starb, war ich in Nairobi, wo ich für meinen Roman Der ewige Gärtner recherchierte. Die Hauptfigur ist eine Frau, die wirklich alles tut, um Menschen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, in diesem Fall afrikanischen Stammesfrauen, die in klinischen Tests als menschliche Versuchskaninchen missbraucht werden. Außer in Kambodscha arbeitete Yvette auch in Afrika, in Guatemala und – dem Ort ihres Todes – im Kosovo. Auch in meinem Roman stirbt Tessa, die weibliche Hauptfigur. Ich hatte dies so vorgesehen, seit ich das Buch geplant hatte; nach meinen Reisen mit Yvette war mir schon klar gewesen, dass ihr Glück nicht ewig halten konnte. Yvette war als kleines Mädchen vergewaltigt, misshandelt und verstoßen worden. Als junge Frau hatte sie Zuflucht in Paris gesucht und sich aus Not prostituiert. Von einem Kambodschaner schwanger, flog sie nach Phnom Penh, nur um dort festzustellen, dass er in Wirklichkeit ein anderes Leben hatte. In einer Bar lernte sie Kurt kennen, und die beiden wurden Partner, geschäftlich und im Leben.
Ich lernte Yvette im Haus eines deutschen Diplomaten im belagerten Phnom Penh kennen, bei einem Diner, das serviert wurde unter dem Geknatter andauernden Artilleriefeuers aus Lon Nols Palast, der 100 Meter entfernt lag. Kurt begleitete sie. Suisindo, die Firma der beiden, hatte ihren Sitz in einem alten Holzhaus im Zentrum der Stadt. Yvette, damals Ende dreißig, braune Augen, war lebhaft und taff, abwechselnd verletzlich und robust, beides nie sehr lang. Sie konnte die Ellbogen ausfahren und schimpfen wie ein Marktweib. Sie konnte einem ein Lächeln schenken, dass einem das Herz dahinschmolz. Sie konnte einen beschwatzen und umschmeicheln und auf jede beliebige Art für sich einnehmen. Doch das alles diente nur einem Zweck.
Und dieser Zweck war, das merkte man schnell, denen Hilfe zu bringen, die sie brauchten, egal wie, egal, was es kostete: Medikamente für die Kranken, Unterkunft für die Obdachlosen, Papiere für die Staatenlosen; kurz gesagt: Es ging darum, äußerst geschäftstüchtig und pragmatisch Wunder zu vollbringen. Das hinderte sie nicht im Geringsten daran, als Geschäftsfrau einfallsreich und gelegentlich skrupellos zu sein, vor allem, wenn sie es mit Menschen zu tun hatte, deren Geld ihrer unerschütterlichen Meinung nach eher in die Taschen der Bedürftigen gehörte. Suisindo war recht profitabel, das musste die Firma aber auch sein, denn ein Großteil des Geldes, das durch die Vordertür hereinkam, ging zur Hintertür gleich wieder hinaus und wurde für den jeweiligen guten Zweck verwendet, an den Yvette nun gerade ihr Herz gehängt hatte. Und Kurt, der klügste und langmütigste Mensch, lächelte und nickte zustimmend.
Ein Beamter der schwedischen Entwicklungshilfe hatte sich in Yvette verliebt und lud sie auf seine Privatinsel vor Schwedens Küste ein. Phnom Penh war gefallen. Kurt und Yvette, die nach Bangkok umgezogen waren, steckten in einer finanziellen Klemme. Ein Vertrag war in Gefahr: Würden sie den Auftrag der schwedischen Entwicklungshilfe bekommen, Reis im Wert von mehreren Millionen zu kaufen und den hungernden kambodschanischen Flüchtlingen an der thailändischen Grenze zu bringen, oder nicht? Ihr direkter Konkurrent war ein skrupelloser chinesischer Händler, und Yvette war, wahrscheinlich einfach rein intuitiv, davon überzeugt, dass der Chinese vorhatte, Hilfsorganisation und Flüchtlinge gleichermaßen übers Ohr zu hauen.
Von Kurt gedrängt, brach Yvette zu der schwedischen Insel auf. Das Strandhaus war bei ihrer Ankunft bereits zum Liebesnest umfunktioniert worden. Im Schlafzimmer hätten Duftkerzen gebrannt, schwor sie später. Ihr Liebhaber in spe war verrückt nach ihr, doch Yvette bat um Geduld. Könnten sie nicht erst einen romantischen Spaziergang am Strand entlang machen? Aber natürlich! Alles, was du möchtest! Es ist eiskalt, und sie ziehen sich warm an. Und wie sie so im Dunklen über die Sanddünen stolpern, schlägt Yvette ein Kinderspiel vor:
»Bleib stehen. So. Jetzt stellst du dich ganz dicht hinter mich. Noch dichter. So. Sehr schön. Jetzt schließe ich die Augen, und du legst deine Hände darauf. Angenehm? Ja, für mich auch. Jetzt darfst du mir eine Frage stellen, ganz egal was für eine, eine einzige, und ich muss die Wahrheit sagen. Wenn nicht, dann bin ich deiner nicht wert. Wollen wir das spielen? Gut. Ich auch. Also, wie lautet deine Frage?«
Wie zu erwarten, betrifft seine Frage ihre tiefsten Sehnsüchte. Sie beschreibt sie und lügt dabei schamlos, da bin ich mir sicher: Sie träumt, sagt sie, von einem gewissen gut aussehenden, sehr männlichen Schweden, der sie in einem duftenden Schlafzimmer auf einer einsamen Insel inmitten der stürmischen See liebt. Nun ist sie an der Reihe. Sie dreht ihn herum, klatscht dem armen Kerl vielleicht etwas weniger zärtlich, als er erwartet hätte, die Hände vor die Augen und brüllt ihm ins Ohr:
»Wie hoch ist das höchste mit Suisindo konkurrierende Angebot, um die tausend Tonnen Reis zu den Flüchtlingen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze zu bringen?«
Heute weiß ich, dass ich Yvettes Werk ein Denkmal setzen wollte, als ich den Ewigen Gärtner schrieb. Vielleicht ahnte ich das auch schon von Anfang an. Und sie vielleicht auch. Yvettes Nähe, vor ihrem Tod und auch danach, leitete mich durch das Buch. Zu alldem würde sie nur sagen: Aber klar.
11
Eine zufällige Begegnung mit Jerry Westerby
George Smiley und Jerry Westerby sitzen in der Fleet Street in einem Kellerlokal voller Weinfässer vor einem großen rosa Gin. Ich zitiere aus Dame, König, As, Spion. Wessen rosa Gin es ist, erfahren wir nicht, doch kann man davon ausgehen, dass es sich um Jerrys Drink handelt. Eine Seite später bestellt Smiley eine Bloody Mary. Jerry ist ein Sportreporter der alten Schule: groß gebaut, ehemaliger Tormann einer Kricketmannschaft. Er hat »riesige« mit Muskeln bepackte Hände, wuscheliges, sandig graues Haar und ein rotes Gesicht, das dunkelrot wird, wenn ihm etwas peinlich ist. Er trägt eine Krawatte in den Farben eines berühmten Sportclubs – welches, wird nicht verraten – auf einem cremefarbenen Seidenhemd.
Jerry Westerby ist allerdings nicht nur ein erfahrener Sportreporter, sondern auch Agent der Briten und betet den Boden an, auf dem Smiley wandelt. Und er ist der perfekte Zeuge. Arglist ist ihm fremd, er hat mit niemandem ein Hühnchen zu rupfen. Er tut, was die besten Agenten tun. Er liefert die Beweise und überlässt das Theoretisieren den Analysten des Secret Service – den Eulen, wie er sie liebevoll nennt.
Während er in einem indischen Lokal beiläufig von Smiley befragt wird, bestellt Westerby sich das schärfste Curry auf der Karte, zerrupft ein Papadam und verteilt es darauf – wieder mit seinen »riesigen« Händen –, gießt dann eine feuerrote Soße darüber, vermutlich ein höllisch scharfes Chili, damit das Ganze Biss kriegt. Jerry witzelt, dass der Wirt die Chilisoße im Atomkeller verstecke. Alles in allem wirkt Jerry wie ein schüchterner, schwerfälliger, liebenswerter Bursche mit Dackelblick, aus Schüchternheit hat er sich angewöhnt, auf Indianer zu machen und Smiley sogar mit ›Hugh!‹ zu grüßen. Dann »trabte er zurück in seine Jagdgründe«.
Ende der Szene. Und das Ende von Jerry Westerbys Kurzauftritt in diesem Roman. Sein Job besteht darin, Smiley beunruhigende Informationen über einen der verdächtigen Maulwürfe unter den Eulen im Circus zuzustecken: Toby Esterhase. Jerry Westerby macht das alles andere als gerne, aber er weiß, es ist seine Pflicht. Mehr erfahren wir in diesem Buch nicht über ihn, und mehr wusste ich auch nicht über ihn, bis ich mich eines Tages nach Südasien aufmachte, um für Eine Art Held (das im Original unter The Honourable Schoolboy erscheinen sollte) zu recherchieren, und Jerry als meinen Verbündeten mitnahm.
Falls der Jerry meines Romans jemandem aus meinem wahren Leben vage ähnelt, dann wohl einem gewissen Gordon, einem Herumtreiber unbestimmter aristokratischer Herkunft, den mein Vater um sein Familienerbe gebracht hatte. Später nahm sich dieser Gordon aus Verzweiflung das Leben; das ist wohl der Grund, warum er mir so klar im Gedächtnis geblieben ist. Seine adlige Herkunft gab ihm das Recht, das absurde »Honourable« vor dem Namen zu tragen, und damit hatte ich auch meinen Jerry in Dame, König, As, Spion versehen – doch keine zehn Pferde hätten ihn dazu gebracht, die Ehrenanrede auch jemals zu benutzen. Und was den »Schoolboy« anging – nun, Jerry mochte ja ein erfahrener Sportreporter und britischer Geheimagent sein, aber wenn es um Herzensangelegenheiten ging, war er noch ein Kindskopf.
So stellte ich mir meinen Jerry vor. Und genau dieser Jerry lief mir im Raffles Hotel in Singapur leibhaftig über den Weg; es war eine der gruseligsten Begegnungen in meiner ganzen Zeit als Schriftsteller. Ich meine damit nicht nur eine verblüffende Ähnlichkeit, sondern den Mann höchstpersönlich, bis hin zu den riesigen, muskelbepackten Händen und den breiten Schultern. Er hieß natürlich nicht Westerby, aber das hätte mich auch nicht mehr gewundert. Es war Peter Simms, ein ehemaliger britischer Auslandskorrespondent und, wie heute allgemein bekannt ist, was ich aber damals nicht ahnen konnte, früherer britischer Geheimagent. Er war eins neunzig groß, hatte rotblondes Haar und ein Jungengrinsen im Gesicht, und wenn er einem zur Begrüßung enthusiastisch die Hand schüttelte, bellte er: »Supah!«
Wer ihm je begegnet war, vergaß nie wieder diese erste spontane Woge reinster Gutherzigkeit, die einen schier umwarf. Und ich werde mich immer an das Gefühl von überwältigtem Unglauben, versetzt mit Schuld, erinnern, weil ich hier vor einem Mann stand, den ich aus jugendlichen Erinnerungen und heißer Luft zusammengesetzt hatte und den ich nun plötzlich in Fleisch und Blut vor mir sah. In Lebensgröße.
Folgendes wusste ich damals noch nicht über Peter Simms, sondern erfuhr es erst später, manches leider erst nach seinem Tod. Im Zweiten Weltkrieg dient Simms in Indien bei den Bombay Sappers and Miners. Ich hatte schon immer angenommen, dass ein Stück des alten Empire in Westerbys früherem Leben stecken müsste. Und so ist es auch. Danach studiert Simms an der Cambridge University Sanskrit und verliebt sich in Sanda, eine wunderschöne Prinzessin aus einem der Shan-Staaten, in ihrer Kindheit war sie in einem Zeremonienboot in der Form eines goldenen Vogels über die birmanischen Seen gefahren. Westerby hätte sich sicher ähnlich heftig verknallt. Simms, sowieso bereits bis über beide Ohren in Asien verliebt, konvertiert zum Buddhismus. Er und Sanda heiraten in Bangkok. Sie bleiben ihr ganzes Leben zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten, und erleben gemeinsam alle möglichen Abenteuer, entweder weil sie einfach passierten oder im Dienst Ihrer Majestät. Peter unterrichtet an der Rangoon University, arbeitet für das Time Magazine in Bangkok und Singapur, später dann für den Sultan von Oman, anschließend für den Geheimdienst der Hong Kong Police, doch da ist Hongkong noch Kronkolonie. Und stets ist Sanda an seiner Seite.
Kurz gesagt, es gab nicht ein Detail aus Simms’ Leben, das ich nicht auch Jerry Westerby zugeschrieben hätte, mit Ausnahme der glücklichen Ehe vielleicht, denn ich brauchte ihn als Einzelgänger, der noch immer auf der Suche nach der Liebe ist. Doch all dies erfuhr ich erst später. Als ich Peter Simms im Raffles Hotel über den Weg lief – wo sonst? –, wusste ich von alldem nichts. Ich wusste nur, dass ich meinen fleischgewordenen Jerry Westerby vor mir hatte, voller Tatendrang und Träume, leidenschaftlich britisch, aber der asiatischen Kultur tief verbunden; es wäre die reinste Schlamperei auf Seiten des britischen Geheimdiensts gewesen, wenn er nicht schon für sie gearbeitet hätte.
Wir begegneten uns in Hongkong wieder, dann in Bangkok und in Saigon. Schließlich traute ich mich zu fragen: Hatte Peter vielleicht Lust, mich auf meiner Reise in die heikleren Ecken Südostasiens zu begleiten? Aber sicher! Nichts würde ihm mehr Vergnügen bereiten. Wäre er wohl auch so freundlich und würde ein professionelles Entgelt für seine Arbeit als mein Rechercheur und Reiseführer akzeptieren? Darauf können Sie wetten! Sein Arbeitsvertrag bei der Hong Kong Police lief bald aus, und sein Kontostand konnte ohne Frage eine kleine Auffrischung gebrauchen. Also machten wir uns auf die Reise. Nur mit Peters unerschöpflicher Energie, asiatischer Gelehrsamkeit und Seele konnte ich die lebensechte Version jenes Westerby vervollständigen, den ich in Dame, König, As, Spion nur leicht skizziert habe.
Peter starb 2002 in Frankreich. In David Greenways elegantem Nachruf, der die Überschrift »Journalist, Abenteurer, Spion und Freund« trägt – Peters Ausruf Supah! habe ich mir dort ausgeborgt –, wird er völlig zu Recht als Vorbild für Jerry Westerby in Eine Art Held beschrieben. Doch mein Westerby war schon vor Peter Simms da. Peter, dieser unheilbare Romantiker, generös bis zum Schluss, schnappte sich meinen Jerry mit beiden riesigen Händen und machte ihn sich ungestüm zu eigen.
12
Einsam in Vientiane
Wir lagen Seite an Seite in einer Opiumhöhle in Vientiane auf Binsenmatten, die Köpfe mit hölzernen Nackenkissen abgestützt, so dass man direkt an die Decke schaute. Ein verhutzelter Kuli mit einem Hakkahut auf dem Kopf kauerte im Halbdunkel zwischen uns und füllte unsere Pfeifen nach oder, wie in meinem Fall, zündete zornig die ausgegangene Pfeife wieder an. Wenn im Drehbuch gestanden hätte: INNENRAUM. OPIUMHÖHLE. LAOS. ENDE DER 70ER JAHRE. NACHT, dann wäre die Szene genau so gestaltet worden, und auch wir Raucher bildeten genau jene Mischung, die Zeit und Ort verlangt hätten: Monsieur Edouard, ein alter Kolonialfranzose und Plantagenbesitzer, vertrieben von dem heimlichen Krieg, der im Norden tobte, zwei Piloten der Air America, ein Quartett von Kriegskorrespondenten, ein libanesischer Waffenhändler und seine weibliche Begleitung und ich, der zurückhaltende Kriegstourist. Und Sam, mein Mattennachbar, von dem ich mich ab dem Augenblick, als ich mich neben ihn gelegt hatte, mit einem einschläfernden Dauermonolog berieseln ließ. In der fumerie herrschte eine gewisse gereizte Nervosität, denn offiziell missbilligten die laotischen Behörden den Opiumkonsum, und wir waren von einem Korrespondenten ernsthaft gewarnt worden, wir könnten jeden Augenblick gezwungen sein zu fliehen und uns über Dächer und Leitern einen Weg in eine Seitengasse zu suchen. Sam meinte nur, das könne ich gleich wieder vergessen, das sei alles Quatsch. Wer Sam war oder ist, werde ich wohl nie herausfinden. Seinem freundlich dahinplätschernden Gedankenfluss nach zu urteilen, wohl so etwas wie ein Weltenbummler, der auf der Suche nach seiner Seele nach Asien gekommen war und im Rückblick auf fünf Jahre an den Fronten von Kambodscha, Vietnam und Laos immer noch nicht fündig geworden war.
Ich hatte noch nie zuvor Opium geraucht und auch seitdem nicht wieder, doch seit jener Nacht hege ich den durch nichts begründeten Verdacht, dass Opium eine jener verbotenen Drogen ist, die Gutes bewirken können, wenn sie von vernünftigen Menschen in vernünftigen Mengen konsumiert würden. Du legst dich auf die Binsenmatte, hast ein bisschen Angst und kommst dir ziemlich dumm vor. Es ist dein erstes Mal. Du nimmst unter Aufsicht einen Zug, machst es falsch, der Kuli schüttelt den Kopf, und du kommst dir nur noch dümmer vor. Doch wenn du dann den Dreh heraushast, dass es darum geht, lange, langsam und im richtigen Augenblick einzuatmen, gewinnt deine freundliche Seite die Oberhand, du bist nicht betrunken oder aggressiv und verspürst auch nicht plötzlich irgendwelche sexuellen Begierden. Du bist einfach nur der zufriedene, frei schwebende Geist, der du schon immer warst. Und das Allerbeste ist, am nächsten Morgen hast du keinen Kater, keine Gewissensbisse, kein qualvolles Tief, sondern du hast einfach nur gut geschlafen und heißt den neuen Tag willkommen. Das jedenfalls versicherte mir Sam, als er feststellte, dass ich blutiger Anfänger war, und das glaube ich bis auf den heutigen Tag.
Sams früheres Leben, so hörte ich aus seinen Abschweifungen heraus, hatte den üblichen Verlauf genommen – nettes englisches Landhaus, Internate, Oxbridge, Heirat, Kinder: bis der Ballon platzte. Welcher oder wessen Ballon, habe ich nicht herausgefunden. Entweder nahm Sam an, ich wisse das, oder es war ihm lieber, ich würde es nicht erfahren, und ich war zu gut erzogen, um nachzufragen. Jedenfalls platzte der Ballon. Es muss wohl einen ziemlich großen Knall gegeben haben, denn Sam schüttelte sich noch am selben Tag die englische Erde von den Schuhen, schwor sich, nie wieder zurückzukehren, und brach nach Paris auf, das er liebte, bis er sein Herz an eine Französin verlor, die ihm einen Korb gab. Und schon platzte der nächste Ballon.
Als Erstes kommt Sam auf die Idee, zur Fremdenlegion zu gehen, aber entweder nehmen sie an dem Tag niemanden auf, oder er hat verschlafen und die falsche Adresse, und so langsam habe ich den Eindruck, alles, was für die meisten von uns ganz einfach ist, ist es für ihn nicht unbedingt. Er hat so etwas Haltloses, das mich vermuten lässt, bei ihm folgt nicht eins ganz natürlich aufs andere. Also geht er nicht zur Fremdenlegion, sondern zu einer in Frankreich sitzenden südostasiatischen Nachrichtenagentur. Die übernehmen zwar keine Reisekosten und Spesen oder Ähnliches, erklärt Sam, aber wenn man etwas irgendwie Nützliches abliefert, zahlen sie eine Kleinigkeit. Und da Sam ja immer noch ein bisschen was auf der hohen Kante hat, findet er das ganz in Ordnung.
In den letzten fünf Jahren ist er also durch die Kriegsgebiete gereist; hier und da hatte er Glück und brachte in den großen französischen Blättern ein-, zweimal etwas unter, entweder weil er einen Tipp von einem der richtigen Reporter erhalten oder die Geschichte schlicht erfunden hatte. Er hatte schon immer gedacht, mit der Literatur könnte er mehr Glück haben, bei dem Leben, das er führt; er würde gern etwas daraus machen: Kurzgeschichten, einen Roman, alles. Nur die Einsamkeit hält ihn davon ab, erklärt er: die Vorstellung, sich im Dschungel an einen Schreibtisch zu setzen und tagelang vor sich hin zu tippen, ohne dass der Lektor drängt oder ein Abgabetermin droht.
Aber er kommt schon noch dazu. Und wenn er sich so anschaut, was er in letzter Zeit rausgehauen hat, dann hat er keine Zweifel; die Geschichten, die er frei erfunden hat, sind der Wirklichkeit erheblich näher als alles, was auf Tatsachen beruht, wie man so sagt. Und irgendwann demnächst wird er sich wirklich an diesen Schreibtisch im Dschungel setzen und loslegen, wird sich nicht um Einsamkeit und fehlende Abgabetermine kümmern, ehrlich. Wenn da nur nicht die Einsamkeit wäre, wiederholt er, nur für den Fall, dass ich ihn noch nicht verstanden habe. Die setzt ihm zu, vor allem hier in Vientiane, wo man nichts tun kann, nur rauchen, sich flachlegen lassen und den betrunkenen mexikanischen Air-America-Piloten zuhören, die mit der Zahl ihrer Abschüsse prahlen, während sie sich in der White Rose einen blasen lassen.
Dann erzählt er mir, wie er mit seiner Einsamkeit umgeht, die sich nicht nur, wie er zugeben muss, auf seine schriftstellerischen Ambitionen auswirkt, sondern sein ganzes Leben beherrscht. Am allermeisten vermisst er Paris. Seit seine große Liebe ihn abgewiesen hat und der Ballon wieder einmal geplatzt ist, ist Paris für ihn verbotenes Terrain, und das wird auch so bleiben. Er wird nie wieder dorthin zurückkehren, schon gar nicht nach der Geschichte mit dieser Frau, das kann er nicht. Jede Straße, jedes Gebäude, jede Flussbiegung kündet von ihr, erklärt er ernst in einem seltenen, wenn auch schläfrigen Anfall von literarischem Schwung. Oder erinnert er sich an ein Chanson von Maurice Chevalier? Jedenfalls ist seine Seele in Paris. Und sein Herz auch, fügt er nach einer Weile hinzu. Verstehst du? Ich verstehe, Sam.
Was er ganz gern macht, wenn er ein, zwei Pfeifchen geraucht hat, fährt er dann fort – er hat beschlossen, mir sein größtes Geheimnis anzuvertrauen, weil ich sein bester Freund bin, der einzige Mensch auf der Welt, der sich für ihn interessiert –, was er also macht, wenn ihm danach ist, und das könnte jeden Augenblick sein, jetzt, wo er klar denken kann: Er geht zur White Rose, da kennen sie ihn schon, er gibt Madame Lulu einen Zwanzig-Dollar-Schein und telefoniert drei Minuten lang mit dem Café de Flore in Paris. Wenn der Kellner im Café de Flore den Hörer abnimmt, bittet Sam darum, mit Mademoiselle Julie Delassus sprechen zu dürfen; den Namen hat er erfunden und noch nie vorher benutzt. Dann lauscht er, wie ihr Name über die Tische hinweg bis auf den Boulevard ausgerufen wird: Mademoiselle Delassus … Mademoiselle Julie Delassus … au téléphone, s’il vous plaît!
Und während sie ihren Namen laut rufen, immer und immer wieder, bis er im Äther verschwindet oder die drei Minuten Zeit um sind, hört er sich für zwanzig Dollar Paris an.
13
Theater des Wirklichen: Tänze mit Arafat
Dies ist die erste von vier zusammengehörenden Geschichten über meine Reisen, die ich zwischen 1981 und 1983 für Die Libelle unternommen habe. Thema des Buchs ist der palästinensisch-israelische Konflikt. Besagte Libelle ist Charlie, eine Figur, zu der mich meine vierzehn Jahre jüngere Halbschwester Charlotte Cornwell inspirierte. Zum Zeitpunkt der Niederschrift war Charlotte bereits eine bekannte Schauspielerin (The Royal Shakespeare Company, die Fernsehserie Rock Follies), aber auch eine militante Fürsprecherin der politischen Linken.
In meinem Roman wird Charlie, ebenfalls Schauspielerin, von einem charismatischen israelischen Agenten namens Joseph angeheuert, um die Hauptrolle im Theater des Wirklichen zu spielen, wie er es nennt. Indem sie sich als die radikale Freiheitskämpferin ausgibt, für die sie sich immer gehalten hat – so Joseph –, indem sie also sich selbst im wirklichen Leben spielt und ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Josephs Regie zu neuen Höhen steigert, zieht sie die Aufmerksamkeit eines ganzen Nests von palästinensischen und westdeutschen Terroristen auf sich und rettet so wirkliches, unschuldiges Leben. Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Mitgefühl angesichts des Elends der Palästinenser, die sie verraten soll, und der Tatsache, dass sie das jüdische Recht auf ein Heimatland anerkennt, fühlt sich nicht zuletzt auch zu Joseph hingezogen und wird so zur zweimal versprochenen Frau im zweimal versprochenen Land.
Ich stellte mir die Aufgabe, Charlie auf dieser Reise zu begleiten, mit ihr hin und her zu schwanken zwischen den Argumenten, die von beiden Seiten auf Charlie einprasseln, und so gut wie möglich selbst ihre widersprüchlichen Gefühle von Loyalität, Hoffnung und Verzweiflung zu durchleben. Und so kam es, dass ich am Silvesterabend 1982 in einer in den Bergen gelegenen Schule für die Waisenkinder der im Kampf für die palästinensische Sache Gefallenen mit Jassir Arafat und seinem Oberkommando die Dabke tanzte.
Die Reise zu Arafat war frustrierend, allerdings wurde er zu jener Zeit derart plakativ als der nur schwer zu fassende, gerissene Staatsmann mit terroristischem Hintergrund dargestellt, dass alles andere einer Enttäuschung gleichgekommen wäre. Meine erste Station auf dem Weg zu ihm war der mittlerweile verstorbene Patrick Seale, der in Belfast geborene, in Oxford ausgebildete britische Journalist, Arabist und angebliche britische Spion, der als Korrespondent des Observer in Beirut Nachfolger von Kim Philby geworden war. Meine zweite Station bildete auf Anraten von Seale ein palästinensischer, Arafat getreuer Militärkommandant namens Salah Ta’amari, dem ich zum ersten Mal bei einem seiner regelmäßigen Besuche in Großbritannien begegnet war. Salah versicherte mir in Odin’s Restaurant in der Devonshire Street (die palästinensischen Kellner hielten vor Ehrfurcht den Atem an), was mir auch schon von allen anderen gesagt worden war, die ich gefragt hatte: Nur mit dem Segen des Vorsitzenden konnte man ernsthaft Kontakt zu den Palästinensern aufnehmen.
Ta’amari versprach, ein gutes Wort für mich einzulegen, aber ich müsse den Dienstweg einschlagen. Das versuchte ich. Mit Empfehlungsschreiben von Ta’amari und Seale in der Tasche hatte ich zwei Mal vorgesprochen und um ein Treffen mit dem Vertreter der Palästinensischen Befreiungsbewegung PLO im Büro der Arabischen Liga in der Green Street in Mayfair gebeten, hatte zwei Mal über mich ergehen lassen, von den Männern im dunklen Anzug auf dem Bürgersteig abgetastet zu werden, hatte zwei Mal in einem Glaskäfig im Eingang gestanden und mich auf versteckte Waffen durchleuchten lassen, und war zwei Mal höflich abgewiesen worden, aus Gründen, die sich der Kontrolle des Vertreters entzogen. Und die Gründe lagen wahrscheinlich tatsächlich außerhalb seiner Kontrolle. Gut möglich: Einen Monat zuvor war sein Vorgänger in Belgien erschossen worden.
Unverrichteter Dinge flog ich nach Beirut und nahm mir ein Zimmer im Commodore Hotel, das von Palästinensern betrieben wurde und für seine Nachsicht gegenüber Journalisten, Spionen und dergleichen bekannt war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich meine Recherchen auf Israel beschränkt. Ich hatte mehrere Tage mit den israelischen Eliteeinheiten verbracht, mich in hübschen Büros aufgehalten und mit gegenwärtigen und ehemaligen Chefs des israelischen Geheimdienstes unterhalten. Das für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Beiruter Büro der PLO hingegen lag in einer zerstörten Straße hinter einem Ring aus mit Zement gefüllten Ölfässern. Bewaffnete Männer mit dem Finger am Abzug schauten mich finster an, als ich dort auftauchte. Im Halbdunkel eines Wartezimmers grüßten mich die vergilbenden, auf Russisch gedruckten Propagandamagazine und die hinter geborstenem Glas ausgestellten Schrapnelle und nicht explodierten Splitterbomben, die man in palästinensischen Flüchtlingslagern gefunden hatte. An Anschlagbrettern hingen wellige Fotos, die tote Frauen und Kinder zeigten.
Das private Allerheiligste des PLO-Sprechers Lapadi sieht auch nicht freundlicher aus. Lapadi, der hinter seinem Schreibtisch sitzt, eine Pistole zur Linken und eine Kalaschnikow neben sich, schaut finster drein, er sieht blass und erschöpft aus.
»Sie schreiben für Zeitung?«
Manchmal. Manchmal schreibe ich auch ein Buch.
»Sie sind Menschenforscher?«
Ich bin Schriftsteller.
»Sie sind hier, um Profit zu schlagen aus uns?«
Ich bin hier, um Ihre Sache aus erster Hand zu verstehen.
»Sie warten.«
Sie lassen mich warten, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ich liege in meinem Hotelzimmer und zähle im anbrechenden Licht des Tages die Einschusslöcher in den Gardinen. Ich hocke tief in der Nacht in der Kellerbar des Commodore und höre mir die Grübeleien der erschöpften Kriegsberichterstatter an, die verlernt haben, wie man schläft. Eines Nachts sitze ich im riesigen, stickigen Speisesaal des Commodore und esse eine große Frühlingsrolle. Ein Kellner flüstert mir aufgeregt ins Ohr: »Unser Vorsitzender möchte Sie jetzt sehen.«
Ich denke noch, er will mich zum Hoteldirektor bringen. Der wird mich vor die Tür setzen, ich habe die Rechnung nicht bezahlt, ich habe jemanden in der Bar beleidigt, oder vielleicht soll ich ihm ein Buch signieren. Dann dämmert es mir langsam. Ich folge dem Kellner in die Hotelhalle und trete hinaus in den strömenden Regen. Bewaffnete Kämpfer in Jeans stehen um einen sandfarbenen Volvo-Kombi mit offener Hintertür. Keiner sagt ein Wort, ich auch nicht. Ich steige ein, Kämpfer springen rechts und links von mir dazu, ein weiterer sitzt vorn neben dem Fahrer.
Wir rasen im Starkregen durch eine zerstörte Stadt, ein Jeep heizt hinter uns her. Wir wechseln die Fahrspuren. Dann wechseln wir die Fahrzeuge, jagen durch Seitengassen, donnern über den Mittelstreifen einer zweispurigen Schnellstraße. Der Gegenverkehr fährt eilig an den Straßenrand. Wieder wechseln wir die Fahrzeuge. Ich werde zum zigsten Mal abgetastet. Dann stehe ich irgendwo in Beirut auf dem regennassen Bürgersteig, umringt von bewaffneten Männern in tropfenden Regencapes. Die Fahrzeuge sind verschwunden. Eine Haustür öffnet sich, ein Mann bittet uns in ein von Einschussnarben übersätes Mehrfamilienhaus mit leeren Fenstern und ohne Licht. Er winkt uns eine gekachelte Treppe hinauf, vorbei an gespenstischen, bewaffneten Männern. Nach zwei Etagen erreichen wir einen mit Teppichboden ausgelegten Absatz und werden in einen offenen Fahrstuhl dirigiert, in dem es nach Desinfektionsmitteln stinkt. Er rumpelt nach oben und bleibt mit einem heftigen Ruck stehen. Wir steigen aus und befinden uns in einem L-förmigen Wohnzimmer. Bewaffnete Männer und Frauen lehnen an den Wänden. Überraschenderweise raucht niemand. Mir fällt ein, dass Arafat Zigarettenqualm nicht mag. Und wieder tastet mich ein Kämpfer ab. Aus keinem logischen Grund überkommt mich die Angst.
»Bitte. Ich bin genug durchsucht worden.«
Der Kämpfer hält mir die offenen Hände hin, wie um mir zu zeigen, dass sie leer sind, lächelt und tritt zurück.
Der Vorsitzende Arafat sitzt an einem Schreibtisch am kürzeren Ende des L und wartet darauf, entdeckt zu werden. Er trägt eine weiße Kufiya und ein akkurat gebügeltes khakifarbenes Hemd, außerdem eine silbrig glänzende Pistole in einem geflochtenen braunen Plastikholster. Er blickt nicht auf, als ich näher komme. Er ist zu sehr damit beschäftigt, Papiere zu unterschreiben. Auch als ich zu einem geschnitzten Holzthron links von ihm geführt werde, scheint er zu abgelenkt, um mich zu bemerken. Schließlich hebt er den Kopf. Er lächelt vor sich hin, als würde er sich an etwas Schönes erinnern. Dann wendet er sich in meine Richtung und springt überrascht auf. Ich springe auch auf. Wie zwei verschworene Schauspieler schauen wir uns in die Augen. Ich bin gewarnt worden: Arafat steht stets auf einer Bühne. Also stelle ich mir vor, ebenfalls auf einer Bühne zu sein. Ich bin ein Schauspielkollege, wir haben ein etwa dreißigköpfiges Publikum. Arafat lehnt sich ein wenig zurück und streckt mir beide Hände zur Begrüßung entgegen. Ich ergreife sie; sie sind weich wie die eines Kindes. Seine vorquellenden braunen Augen wirken leidenschaftlich und flehend.
»Mr David!«, ruft er. »Warum möchten Sie mich sprechen?«
»Mr Chairman«, erwidere ich in demselben Ton. »Ich bin hier, um meine Hand auf das palästinensische Herz zu legen!«
Haben wir das einstudiert? Schon nimmt er meine rechte Hand und führt sie an die linke Brusttasche seines khakifarbenen Hemds. Sie ist zugeknöpft und makellos gebügelt.
»Mr David, hier ist es!«, ruft er leidenschaftlich. »Hier ist es!«, wiederholt er unseren Zuhörern zuliebe.
Das Publikum ist aufgesprungen. Wir sind eine Sensation. Wir umarmen uns auf arabische Art, links, rechts, links. Arafats Bart ist nicht stachlig, sondern seidenweich. Er riecht nach Babypuder. Arafat lässt mich los, legt eine Hand besitzergreifend auf meine Schulter und spricht direkt zu unserem Publikum. Ich darf mich frei unter seinen Palästinensern bewegen, verkündet er – er, der nie zweimal im selben Bett schläft, sich persönlich um seinen eigenen Schutz kümmert und betont, allein mit Palästina verheiratet zu sein. Ich darf sehen und hören, was ich möchte. Er bittet mich nur darum, die Wahrheit zu schreiben und zu sagen, denn nur die Wahrheit wird Palästina befreien. Er wird mich dem Chef der jungen Kämpfer anvertrauen, den ich ja schon in London kennengelernt habe – Salah Ta’amari. Salah wird mir eine handverlesene Leibgarde stellen. Er wird mich in den Südlibanon begleiten, mir den großen Kampf gegen die Zionisten erläutern und mich seinen Kommandanten und Truppen vorstellen. Alle Palästinenser, denen ich begegne, werden offen und ehrlich sprechen. Arafat bittet mich, sich mit mir fotografieren zu lassen. Ich lehne ab. Warum, fragt er. Sein Gesicht strahlt, der Ausdruck wirkt herausfordernd, und ich riskiere eine leichtfertige Bemerkung: »Weil ich damit rechne, etwas früher als Sie in Jerusalem zu sein, Mr Chairman.«
Arafat lacht herzlich, also lacht das Publikum mit. Doch ich bin mit diesem Scherz zu weit gegangen, und ich bedaure meine Bemerkung.
Nach dieser Begegnung mit Arafat erscheint alles ganz normal. Die jungen Kämpfer der Fatah standen unter Salahs Kommando; acht von ihnen bildeten meine persönliche Leibgarde. Sie waren höchstens siebzehn, sie schliefen (oder auch nicht) in einem Kreis um mein Bett im obersten Stockwerk des Hauses und hielten von meinem Fenster aus Ausschau nach den kleinsten Anzeichen eines feindlichen Angriffs zu Wasser, zu Lande oder aus der Luft. Überkam sie die Langeweile, und das passierte schnell, schossen sie aufs Geratewohl mit ihren Pistolen nach irgendeiner Katze, die durchs Gestrüpp schlich. Die meiste Zeit über aber murmelten sie auf Arabisch miteinander oder erprobten ihr Englisch an mir, wann immer ich kurz vor dem Einschlafen war. Mit acht Jahren hatten sie sich der palästinensischen Fatah-Jugendorganisation Ashbal angeschlossen. Mit vierzehn hielt man sie für ausgewachsene Kämpfer. Salah zufolge konnte ihnen niemand das Wasser reichen, wenn es darum ging, mit einem Granatwerfer ins Rohr eines israelischen Panzers zu zielen. Und meine arme Charlie, Star im Theater des Wirklichen, wird sie alle lieben, denke ich und kritzle mir ihre Gedanken in mein zerschlissenes Notizbuch.
Unter Salahs Führung und in Charlies Begleitung suche ich palästinensische Vorposten an der israelischen Grenze auf und höre mir unter dem Dröhnen der israelischen Aufklärungsflugzeuge und dem gelegentlich aufflackernden Artilleriefeuer die – wirklichen oder erfundenen – Geschichten der Kämpfer an von nächtlichen Angriffen mit dem Schlauchboot auf dem See Genezareth. Sie prahlen nicht mit Heldentaten. Nur dort drüben gewesen zu sein ist schon genug, behaupten sie: den Traum zu leben, und sei es nur für ein paar Stunden, auch wenn sie Leben und Gefangenschaft riskierten; auf dem Boot heimlich während der Überfahrt innezuhalten, den Duft der Blumen und Olivenbäume und Felder der Heimat zu riechen, das Blöken der Schafe auf den eigenen Hügeln zu hören – das allein schon ist der wahre Sieg.
Mit Salah an meiner Seite suche ich das Kinderkrankenhaus in Sidon. Ein siebenjähriger Junge, dem nach einem Angriff beide Beine amputiert werden mussten, reckt den Daumen hoch. Charlie ist so präsent wie nie. Ich erinnere mich deutlich an die Flüchtlingslager Rashidieh und Nabatiye, beides eigentlich eigenständige Städte. Rashidieh ist berühmt für seine Fußballmannschaft. Das Spielfeld, eigentlich ein staubiger Acker, ist so häufig bombardiert worden, dass die Spiele nur kurzfristig angesetzt werden. Einige der besten Spieler sind selbst Märtyrer für die Sache geworden. Ihre Fotos hängen zwischen den Silberpokalen, die sie gewonnen haben. In Nabatiye bemerkt ein alter Araber in weißem Gewand meine braunen englischen Schuhe und etwas Koloniales an meinem Gang.
»Sind Sie Brite, Sir?«
Ja, ich bin Brite.
»Lesen Sie.«
Er zieht ein Dokument aus der Tasche. Es handelt sich um eine auf Englisch gedruckte amtliche Bescheinigung, gestempelt und signiert von einem britischen Offizier des britischen Mandats, mit der bestätigt wird, dass die genannte Person rechtmäßiger Besitzer des im Folgenden bezeichneten Kleinbauernhofs und Olivenhains außerhalb von Bethanien ist. Datiert auf 1938.
»Ich bin die genannte Person, Sir. Und jetzt schauen Sie, was aus uns geworden ist.«
Das Aufflammen meines nutzlosen Schamgefühls wird zu Charlies Wut.
Wenn wir in Salahs Haus in Sidon zu Abend essen, dann liegt über allem die Illusion zauberhafter Ruhe nach den Mühen des Tages. Das Haus mag von Einschussnarben übersät sein; eine vom Meer aus abgefeuerte israelische Rakete war glatt durch eine Wand gedrungen, ohne explodiert zu sein. Aber im Garten gibt es schläfrige Hunde und es wachsen Blumen, ein Feuer brennt im Kamin und auf dem Tisch stehen Lammkoteletts. Salahs Frau Dina, früher mit König Hussein von Jordanien verheiratet, ist eine haschemitische Prinzessin. Sie ist auf eine britische Privatschule gegangen und hat am Girton College in Cambridge Englisch studiert.
Belesen, taktvoll und mit viel Humor bringen Dina und Salah mir die Sache der Palästinenser nahe. Charlie sitzt neben mir. Als es das letzte Mal in Sidon zu einer offenen Schlacht kam, erzählt mir Salah stolz, fuhr Dina, eine zarte Frau von großer Schönheit und Charakterstärke, mit ihrem uralten Jaguar in die Stadt, holte einen Stapel Pizzas vom Bäcker, steuerte die Frontlinie an und bestand darauf, das Essen persönlich zu den Kämpfern zu bringen.
Ein Abend im November. Der Vorsitzende Arafat und sein Gefolge sind nach Sidon gekommen, um den siebzehnten Jahrestag der palästinensischen Revolution zu feiern. Der Himmel ist blauschwarz, es droht zu regnen. Als wir uns zu Hunderten in die schmale Straße drängen, in der der Aufmarsch stattfinden soll, sind alle meine Bodyguards verschwunden – alle bis auf den undurchschaubaren Mahmoud, der keine Waffe trägt, nicht aus Salahs Fenster auf Katzen schießt, sehr gut Englisch spricht und geheimnisvoll distanziert wirkt. In den letzten drei Nächten war Mahmoud verschwunden und erst im Morgengrauen wieder zurückgekehrt. Und nun steht der kleine untersetzte, achtzehnjährige Bursche mit Brille in dieser pulsenden, völlig überfüllten, mit Bannern und Ballons geschmückten Straße neben mir und soll mich beschützen.
Die Parade beginnt. Erst die Flötenspieler und Flaggenträger; danach der Parolen bellende Lautsprecherwagen. Dicke Männer in Uniformen und offizielle Vertreter in dunklen Anzügen versammeln sich auf einem provisorischen Podium. Arafats weiße Kufiya ist schon von weitem zu sehen. Die Straße explodiert schier vor Feierlaune, grüner Qualm wabert über unsere Köpfe hinweg, weicht rotem Qualm. Trotz des einsetzenden Regens gibt es ein Feuerwerk, unterstützt von scharfer Munition; unser Anführer steht regungslos in der Mitte der Bühne, ist seine eigene Statue, reckt die Finger zum Siegeszeichen in die Höhe. Jetzt ziehen Krankenschwestern mit grünen Halbmond-Abzeichen vorbei, dann die vom Krieg verstümmelten Kinder in Rollstühlen, dann die Mädchen und Jungen der Ashbal, die heftig mit den Armen rudern und aus dem Takt kommen, dann ein Jeep, der einen Wagen voller Kämpfer zieht. Sie haben sich in palästinensische Fahnen gewickelt und zielen mit ihren Kalaschnikows in den regenschwarzen Himmel. Mahmoud, der dicht neben mir steht, winkt ihnen wild zu, und zu meiner Überraschung drehen sie sich alle um und winken zurück. Es handelt sich um die anderen Burschen aus meiner Leibgarde.
»Mahmoud«, rufe ich durch zu einem Trichter gelegte Hände, »warum bist du nicht bei unseren Freunden und reckst eine Waffe in die Luft?«
»Ich habe keine Waffe, Mr David!«
»Warum denn nicht, Mahmoud?«
»Ich mache Nachtarbeit!«
»Aber was tust du denn nachts, Mahmoud? Bist du ein Spion?« – so leise, wie das bei dem Krach noch geht.
»Mr David, ich bin kein Spion.«
Selbst bei diesem Tumult ist sich Mahmoud nicht sicher, ob er mir sein großes Geheimnis anvertrauen kann.
»Haben Sie auf der Uniformbrust der Ashbal das Foto von Abu Amar gesehen, unserem Vorsitzenden Arafat?«
Ja, habe ich, Mahmoud.
»Ich persönlich habe die ganze Nacht an einem geheimen Ort das Foto von Abu Amar, dem Vorsitzenden Arafat, auf die Brust der Ashbal gebügelt.«
Und ich denke: Charlie wird dich am meisten von allen lieben.
Arafat hatte mich eingeladen, Silvester mit ihm in einer Schule für die Waisenkinder palästinensischer Märtyrer zu verbringen. Er schickte mir einen Jeep, der mich vom Hotel abholte. Ich wohnte noch immer im Commodore. Der Jeep gehörte zu einer Wagenkolonne, die mit atemberaubender Geschwindigkeit Stoßstange an Stoßstange eine Serpentine hinaufjagte und dabei libanesische, syrische und palästinensische Kontrollpunkte passierte; es war wie verhext, aber wie immer, wenn ich mich mit Arafat traf, goss es in Strömen.
Die Straße war einspurig, nicht befestigt und durch den starken Regen ziemlich beschädigt. Der Jeep vor uns bewarf uns mit Schotter. Wenige Zentimeter neben dem Straßenrand gähnten Täler, in denen sich weit unten kleine Lichterteppiche ausbreiteten. Das Fahrzeug an der Spitze war ein gepanzerter roter Land Rover. Gerüchten zufolge saß darin der Vorsitzende. Doch als wir an der Schule eintrafen, teilten uns die Wachen mit, der Land Rover sei nur ein Täuschungsmanöver gewesen. Arafat war bereits im Konzertsaal in Sicherheit und begrüßte seine Gäste.
Von außen sah die Schule aus wie ein ganz normales, schlichtes zweistöckiges Haus. Ging man aber hinein, befand man sich bereits im obersten Stockwerk, und der Rest des Gebäudes zog sich in Terrassen den Hügel hinunter. Die üblichen bewaffneten Männer in Kufiyas und jungen Frauen mit Munitionsgurten über der Brust bewachten unseren Abstieg. Die Konzerthalle, einem riesigen Amphitheater nachempfunden mit einer erhöhten Holzbühne, war voll besetzt; Arafat stand in der ersten Reihe unterhalb der Bühne und umarmte seine Gäste, und die ganze Halle dröhnte unter rhythmischem Händeklatschen. Neujahrsbanner baumelten von der Decke. Revolutionsparolen bedeckten die Wände. Ich wurde zu Arafat gedrängt, und wieder umarmte er mich ganz rituell, grauhaarige Männer in Khaki und mit Gewehrgurten packten meine Hand und brüllten mir über das Klatschen hinweg Neujahrswünsche zu. Einige hatten Namen, andere, wie Arafats Stellvertreter Abu Jihad, nur noms de guerre. Manche blieben namenlos. Dann begann die Veranstaltung. Als Erstes tanzten die verwaisten Mädchen Palästinas im Kreis und sangen, dann folgten die verwaisten Jungen. Dann tanzten alle Kinder gemeinsam die Dabke und reckten unter dem rhythmischen Klatschen der Zuschauer hölzerne Kalaschnikows in die Höhe. Rechts von mir stand Arafat mit ausgestreckten Armen. Der grimmig schauende Kämpfer rechts von ihm nickte mir zu, ich packte Arafat am linken Ellbogen, gemeinsam hoben wir ihn auf die Bühne und kletterten hinterher.
Arafat dreht sich im Kreise seiner geliebten Waisenkinder und scheint sich darin zu verlieren. Er hat das Ende seiner Kufiya gepackt und wirbelt herum wie Alec Guinness in der Rolle des Fagin in Oliver Twist. Sein Gesichtsausdruck ist verzückt. Weint Arafat oder lacht er? Das macht keinen Unterschied, ergriffen wie er ist. Nun bedeutet er mir, ich solle ihn um die Taille fassen. Jemand anderes legt seine Hände ebenso um mich. Und schon bildet die ganze Gruppe – Oberkommando, Anhänger, euphorische Kinder und zweifellos eine ganze Versammlung von Spionen aus aller Welt, denn wohl kaum jemand in der Weltgeschichte dürfte derart ausspioniert worden sein wie Arafat – eine Polonaise, mit unserem Anführer an der Spitze.
Zwischen Betonwänden durch den Flur, eine Treppe hinauf, über eine Empore, eine andere Treppe hinunter. Das Händeklatschen wird durch das Stampfen unserer Füße ersetzt. Hinter und über uns schmettern donnernde Stimmen Palästinas Nationalhymne. Irgendwie stampfen und trampeln wir unseren Weg zurück auf die Bühne. Arafat tritt an den Bühnenrand und bleibt stehen. Unter dem Gejohle der Menge hechtet er in die Arme seiner Kämpfer.
Und in meiner Phantasie jubelt meine Charlie vor Begeisterung mit.
Acht Monate später, am 30. August 1982, wurden Arafat und sein Oberkommando in der Folge der israelischen Invasion aus dem Libanon ausgewiesen. Vom Beiruter Hafen schifften sich Arafat und seine Kämpfer, trotzig in die Luft schießend, nach Tunis ein, wo Präsident Habib Bourguiba und sein Kabinett sie empfingen. Außerhalb der Stadt hatte man eilends ein Luxushotel hergerichtet, das als neues Hauptquartier Arafats dienen sollte.
Ein paar Wochen später stattete ich ihm dort einen Besuch ab.
Zu dem eleganten weißen Haus in den Dünen führte eine lange Zufahrt. Zwei junge Kämpfer fragten, was ich wolle. Kein strahlendes Lächeln, keine der üblichen Gesten arabischer Höflichkeit. Ob ich Amerikaner sei? Ich zeigte ihnen meinen britischen Pass. Und hätte ich auch von den Massakern in Sabra und Chatilla gehört, fragte einer von beiden schonungslos sarkastisch. Ich erwiderte, ich sei nur wenige Tage zuvor in Chatilla gewesen und tief betroffen über alles, was ich dort gesehen und gehört hätte. Ich sagte, ich sei gekommen, um Abu Amar zu sehen, Arafats Name für seine Vertrauten, und wolle ihm mein Mitgefühl aussprechen. Wir seien uns ein paarmal in Beirut und in Sidon begegnet, und ich hätte mit ihm Silvester in der Schule für die Märtyrerwaisen verbracht. Einer der jungen Burschen griff nach einem Telefon. Ich hörte zwar meinen Namen nicht, aber er hielt meinen Pass in der Hand, während er sprach. Er legte das Telefon hin, blaffte: »Kommen Sie«, zog eine Pistole aus dem Gürtel, drückte sie mir an die Schläfe und dirigierte mich durch einen langen Gang zu einer grünen Tür. Er schloss sie auf, gab mir meinen Pass zurück und schubste mich durch die Tür ins Freie. Vor mir lag eine Reitbahn aus zerstampftem Sand. Yassir Arafat mit weißer Kufiya ritt auf einem schönen Araber im Kreis. Ich sah zu, wie er den Platz einmal umrundete, ein zweites, ein drittes Mal. Entweder sah er mich nicht oder er wollte mich nicht sehen.
Mein früherer Gastgeber Salah Ta’amari, der Oberkommandierende der palästinensischen Miliz im Südlibanon, war derweil der Behandlung unterworfen, die dem höchstrangigen palästinensischen Kämpfer widerfuhr, der jemals in israelische Hände gefallen war. Er saß im berüchtigten Ansar-Gefängnis in Einzelhaft und wurde dort erweiterten Verhörtechniken unterzogen, wie man das heutzutage gern nennt. Zeitweilig verband ihn eine enge Freundschaft mit einem angesehenen israelischen Journalisten, Aharon Barnea, der ihn im Gefängnis aufsuchte, und das hatte zur Folge, dass Barnea ein Buch mit dem Titel Freunde trotz Terror und Tod veröffentlichte. Neben anderen Punkten, die gegenseitiges Einvernehmen belegten, wurde durch das Buch bestätigt, dass Salah sich deutlich für eine israelisch-palästinensische Koexistenz aussprach, nicht für den immerwährenden, hoffnungslosen militärischen Kampf.
14
Theater des Wirklichen: Villa Brigitte
Das Gefängnis war eine unauffällige Gruppe von mit Stacheldraht umzäunten grünen Armeehütten in einer Senke der Negev-Wüste. An allen vier Ecken stand ein Wachturm. Unter Insidern der israelischen Geheimdienstler hieß der Ort Villa Brigitte; der Rest der Welt wusste nichts von seiner Existenz. Brigitte, so erklärte mir der junge, Englisch sprechende Oberst von Israels Sicherheitsdienst Shin Bet, während er unseren Jeep auf dem Weg dorthin durch die Sanddünen lenkte, war eine radikalisierte deutsche Aktivistin, die sich auf Gedeih und Verderb mit einer Gruppe palästinensischer Terroristen zusammengetan hatte. Sie hatten den Plan, eine Maschine der El Al im Landeanflug auf Nairobis Kenyatta Airport abzuschießen; dazu hatten sie sich einen Granatwerfer besorgt, das Dach eines Hauses, das in der Einflugschneise der Maschine lag, ausgesucht, und dann war da Brigitte.
Mit ihrem nordischen Aussehen und ihren blonden Haaren hatte sie nichts weiter zu tun, als auf dem Flughafen in einer Telefonzelle zu stehen, Kurzwellenempfänger an einem Ohr, Telefon am anderen, und die Flugangaben des Towers an die Jungs auf dem Dach weiterzugeben. Ein Team israelischer Agenten kam ihr dazwischen; damit hatte sich Brigittes Mitarbeit bei diesem Einsatz erledigt. Die El-Al-Maschine, leer bis auf die Geheimdienstleute, war gewarnt worden und bereits gelandet. Nach Tel Aviv zurück flog sie mit Brigitte, die gefesselt auf dem Boden der Maschine lag. Das Schicksal der Jungen auf dem Dach blieb unklar. Man habe sich um sie gekümmert, versicherte mir mein Oberst der Shin Bet, ohne Einzelheiten zu verraten, und ich hielt es nicht für angebracht, danach zu fragen. Mir war deutlich gemacht worden, dass mir dank der Vermittlung durch General Shlomo Gazit, bis vor kurzem Kopf des israelischen militärischen Abschirmdienstes und ein hochgeschätzter Bekannter, ein seltenes Privileg zuteilwurde.
Brigitte war nun Gefangene der Israelis, doch musste die Operation auf jeden Fall geheim gehalten werden, war ich gewarnt worden. Die kenianischen Behörden hatten mit den Israelis zusammengearbeitet, wollten im eigenen Land aber auf keinen Fall die Stimmung unter den Muslimen anheizen. Und die Israelis hatten kein Bedürfnis, ihre Quellen preiszugeben oder einen wichtigen Verbündeten zu vergraulen. Ich war nur unter der Voraussetzung, dass ich nichts über Brigitte schreiben würde, bis ich die Erlaubnis der Israelis dazu bekam, zu dem Treffen mit ihr gebracht worden. Die Israelis hatten mir auch mitgeteilt, dass sie bis jetzt weder Brigittes Eltern noch der deutschen Regierung gegenüber eingeräumt hatten, ihren Aufenthaltsort zu kennen. Ich würde also noch eine Weile auf die Erlaubnis warten müssen. Aber das bereitete mir keine großen Sorgen. Ich wollte meine fiktionale Charlie schon einmal mit der Gesellschaft bekannt machen, die ihr winkte, falls sie es schaffen sollte, in die deutsch-palästinensische Terrorzelle vorzudringen, für die sie aufgebaut worden war. Mit etwas Glück würde sie bei Brigitte ihre erste Lektion in Theorie und Praxis des Terrors bekommen.
»Spricht Brigitte?«, fragte ich den jungen Oberst vor Ort.
»Vielleicht.«
»Über ihre Motive?«
»Vielleicht.«
Also gut. Dann frage ich sie besser selbst. Ich glaube, das kann ich. Ich denke mir, ich könnte eine Beziehung zu Brigitte aufbauen, wenn vielleicht auch gegründet auf Oberflächlichkeit und Unaufrichtigkeit. Zwar habe ich die Bundesrepublik verlassen, sechs Jahre bevor die Rote Armee Fraktion mit Ulrike Meinhof auftauchte, aber ich kann problemlos erkennen, wo die Ursprünge dafür liegen, oder gar einigen Argumenten zustimmen. Aber nicht den Methoden. In dieser Hinsicht, und nur in dieser, unterscheide ich mich nicht von den Teilen der bürgerlichen Mitte Deutschlands, die die Baader-Meinhof-Gruppe heimlich mit Geld versorgt und ihr Unterschlupf bietet. Auch mich widert die Anwesenheit hochrangiger Nazis in Politik, Justiz, Polizei, Industrie, Bankenwesen und Kirche ebenso an wie die Weigerung deutscher Eltern, mit ihren Kindern die Erfahrungen der Nazizeit zu diskutieren; dazu kommt noch die Unterwürfigkeit der westdeutschen Regierung gegenüber den hässlichsten Auswüchsen amerikanischer Politik im Kalten Krieg. Und falls Brigitte noch weitere Beweise für meine Glaubwürdigkeit braucht: Habe ich nicht palästinensische Flüchtlingslager und Krankenhäuser besucht, das Leid gesehen, den Ruf gehört? Sollte mir das alles zusammen nicht, wie kurz auch immer, Zutritt zu den Gedanken einer radikalen Deutschen von Mitte zwanzig verschaffen?
Ich finde Gefängnisse äußerst bedrückend. Das Bild meines eingesperrten Vaters lässt mich nicht los. In meiner Vorstellung habe ich ihn in mehr Gefängnissen vor mir gesehen, als er tatsächlich von innen erlebt hat, und immer ist er derselbe stämmige, kräftige, ruhelos geschäftige Mann mit buschigen Augenbrauen, der in seinem Käfig hin und her tigert und seine Unschuld beteuert. Wenn ich in meinem früheren Leben losgeschickt wurde, um Männer im Gefängnis zu verhören, musste ich mich sehr zusammenreißen, wenn sich das eiserne Tor hinter mir schloss, weil ich Angst davor hatte, ich könnte mir den Spott der Insassen einhandeln, die ich zu befragen hatte.
Es gab in der Villa Brigitte keinen Innenhof, zumindest erinnere ich mich nicht daran. Wir wurden am Tor angehalten, überprüft und durchgewinkt. Der junge Oberst führte mich eine Außentreppe hinauf und rief auf Hebräisch einen Gruß. Major Kaufmann war die Gefängnisleiterin. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Kaufmann hieß oder ob ich sie nur so nenne. Zu meiner Zeit beim militärischen Geheimdienst in Österreich war ein gewisser Sergeant Kaufmann der Leiter des Stadtgefängnisses von Graz, wo wir unsere Verdächtigen wegschlossen. Diese Gefängnisleiterin hier trug jedenfalls ein weißes Namensschild über der linken Brusttasche ihrer ungewöhnlich makellosen Uniform, war Major der Armee, etwa fünfzig, kräftig, aber nicht mollig, hatte strahlend braune Augen und lächelte gequält, aber freundlich.
Major Kaufmann und ich sprechen Englisch miteinander. Ich habe mit dem Oberst Englisch gesprochen, und da ich ja kein Hebräisch kann, bietet es sich an, dass wir bei Englisch bleiben. Sie möchten also Brigitte besuchen, fragt sie, und ich antworte: Ja, es ist ein Privileg, ich weiß es sehr zu würdigen und bin dafür sehr dankbar, und gibt es irgendetwas, das ich zu ihr sagen oder nicht sagen sollte? Ich erkläre ihr dann, was ich dem Oberst auf der Fahrt hierher verschwiegen habe: Ich bin kein Journalist, sondern Schriftsteller, ich bin hier, um Hintergrundinformationen zu gewinnen, und ich habe geschworen, ohne die Einwilligung meiner Gastgeber nichts über das heutige Treffen zu schreiben oder zu sagen. Sie lächelt zu allem höflich und sagt, natürlich nicht, und ob ich lieber Tee oder Kaffee möchte. Kaffee.
»Brigitte war in letzter Zeit gar nicht einfach«, warnt Major Kaufmann mich mit der beherrschten Stimme einer Ärztin, die über den ernsten Zustand ihrer Patientin spricht. »Zu Anfang hat sie ihre Lage akzeptiert. In den letzten paar Wochen hat sie«, ein leiser Seufzer, »sie nicht mehr akzeptiert.«
Da ich sowieso nicht verstehen kann, wie jemand Gefangenschaft akzeptieren kann, sage ich nichts.
»Vielleicht spricht sie mit Ihnen, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Erst hat sie nein gesagt, jetzt sagt sie ja. Sie ist unentschlossen. Soll ich sie holen lassen?«
Auf Hebräisch lässt sie Brigitte per Funk holen. Wir warten eine ganze Weile. Major Kaufmann lächelt mich an, und ich erwidere das Lächeln. Gerade als ich mich frage, ob Brigitte wieder einmal ihre Meinung geändert hat, höre ich unterschiedliche Schritte, die sich unserer Tür nähern; kurz habe ich das ekelerregende Bild einer jungen, verrückten Frau vor mir, in Handschellen und mit zerwühlten Haaren; gegen ihren Willen wird sie zu mir gebracht. Von der anderen Seite sperrt jemand die Tür auf. Eine große, schöne Frau in einem Gefängniskittel, der durch einen enggezogenen Gürtel optisch aufgewertet wird, kommt mit einer kleinen Gefängniswärterin an jeder Seite herein. Die Wärterinnen halten den rechten und linken Arm leicht fest. Das lange blonde Haar der Frau ist offen nach hinten gekämmt. Sogar die Gefängniskleidung steht ihr. Die Wärterinnen ziehen sich zurück, die Frau geht einen Schritt nach vorn, deutet ironisch einen kleinen Knicks an und streckt mir, ganz die wohlerzogene Tochter aus gutem Hause, die Hand entgegen.
»Mit wem habe ich das Vergnügen?«, fragt sie vornehm auf Deutsch, worauf ich ebenfalls auf Deutsch wiederhole, was ich Major Kaufmann bereits auf Englisch gesagt habe: Ich bin Schriftsteller und auf der Suche nach Informationen. Darauf erwidert sie gar nichts, sondern schaut mich nur an, bis Major Kaufmann sich von ihrem Platz in der Zimmerecke aus einschaltet und in ihrem ausgezeichneten Englisch sagt:
»Sie dürfen sich jetzt setzen, Brigitte.«
Also setzt sich Brigitte, steif und gerade, wie ein braves deutsches Schulmädchen. Ich hatte gedacht, ich könne zu Beginn mit ihr einige freundliche Nichtigkeiten wechseln, doch ich stelle fest, mir fallen keine ein. Also komme ich gleich mit ein paar platten Fragen zur Sache wie: »Bedauern Sie im Nachhinein Ihre Taten, Brigitte?«, und »Was genau hat Sie auf diesen Weg in die Radikalität geführt?« Auf beide Fragen hat sie keine Antwort, sondern sitzt weiter stocksteif mit den Händen auf dem Tisch da und fixiert mich mit einer Mischung aus Verwirrung und Verachtung.
Major Kaufmann kommt mir wieder zu Hilfe: »Möchten Sie vielleicht erzählen, wie Sie sich der Gruppe angeschlossen haben«, schlägt sie Brigitte vor und spricht wie eine englische Lehrerin mit ausländischem Akzent.
Brigitte scheint das gar nicht zu hören. Sie betrachtet mich von oben bis unten, gründlich, abfällig. Als sie mit ihrer Untersuchung fertig ist, verrät mir ihr Gesichtsausdruck alles, was ich wissen muss: Ich bin auch nur einer dieser unaufgeklärten Lakaien der repressiven Bourgeoisie, ein Terrortourist, unwichtig. Wozu soll sie sich mit mir abgeben? Doch sie lässt sich dazu herab. Sie werde mir einen kurzen Abriss ihrer Mission geben, sagt sie, wenn schon nicht für mich, dann eben für sich. Verstandesmäßig ist sie vielleicht Kommunistin, räumt sie ein und analysiert sich selbst ganz sachlich, wenn auch nicht notwendigerweise im sowjetischen Sinne. Sie hält sich lieber für jemanden, der nicht auf eine einzelne Doktrin beschränkt ist. Ihre Mission richtet sich an die unaufgeklärte Bourgeoisie; ihre Eltern seien dafür Musterbeispiele, findet sie. Ihr Vater zeige Anzeichen von Einsicht, ihre Mutter noch nicht. Westdeutschland sei ein Naziland, das von bourgeoisen Staatsfaschisten der Auschwitz-Generation geführt wird. Und das Proletariat folge einfach nur ihrem Beispiel.
Noch mal kommt sie auf ihre Eltern zu sprechen. Sie hofft, sie noch bekehren zu können, vor allem ihren Vater. Sie hat lange darüber nachgedacht, wie sie die unbewussten Barrieren in ihnen niederreißen könnte, die noch vom Nazismus übriggeblieben sind. Sagt sie so auf verschlüsselte Art, dass sie ihre Eltern vermisst, frage ich mich? Dass sie die Eltern sogar liebt? Dass sie sich Tag und Nacht fürchterliche Sorgen um sie macht? Wie um solche bourgeoisen Sentimentalitäten zu korrigieren, betet sie eine ganze Liste ihrer wichtigen Propheten herunter: Habermas, Marcuse, Frantz Fanon und noch ein paar, von denen ich noch nie gehört habe. Dann hält sie mir einen Vortrag über die Übel des bewaffneten Kapitalismus, über die Remilitarisierung Westdeutschlands, die Unterstützung von so faschistischen Diktatoren wie dem Schah von Iran durch den amerikanischen Imperialismus und noch weitere Punkte, bei denen ich wohl zugestimmt hätte, wenn sie sich auch nur ein bisschen für meine Meinung interessiert hätte, aber das tat sie nicht.
»Und jetzt möchte ich gern zurück in meine Zelle, bitte, Major Kaufmann.«
Wieder deutet sie ironisch einen Knicks an und reicht mir die Hand, dann gibt sie den Wärterinnen zu verstehen, dass sie in die Zelle zurückgebracht werden möchte.
Major Kaufmann hat ihren Platz in der Ecke nicht verlassen, und auch ich sitze noch am Tisch gegenüber von Brigittes leerem Stuhl. Die Stille zwischen uns hat eine Qualität, als würden wir aus einem gemeinsamen Alptraum erwachen.
»Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben?«, fragt Major Kaufmann.
»Ja, danke. Es war sehr interessant.«
»Brigitte ist heute ein wenig verwirrt, würde ich sagen.«
Worauf ich erwidere, ja, nun, das bin ich ebenfalls, um ehrlich zu sein. Erst jetzt, in meiner Selbstversunkenheit, fällt mir auf, dass wir wieder Deutsch sprechen und dass in Major Kaufmanns Deutsch keinerlei erkennbare Spuren von Jiddisch oder etwas anderem zu hören sind. Sie bemerkt meine Überraschung und beantwortet meine unausgesprochene Frage.
»Mit Brigitte spreche ich nur Englisch«, erklärt sie. »Niemals Deutsch. Kein einziges Wort. Wenn Brigitte Deutsch spricht, kann ich mich auf mich selbst nicht mehr verlassen.« Und als ob das noch einer weiteren Erklärung bedürfte: »Wissen Sie, ich war in Dachau.«
15
Theater des Wirklichen: Eine Schuldfrage
An einem heißen Jerusalemer Sommerabend sitze ich im Haus von Michael Elkins, dem amerikanischen Korrespondenten, der erst für CBS und dann siebzehn Jahre lang für die BBC gearbeitet hatte. Ich bin dort, weil ich, wie so viele in meiner Generation, mit seiner New Yorker Stentorstimme aufgewachsen bin, mit der er uns in makellosen Sätzen in der Regel aus irgendeinem ungastlichen Kriegsgebiet berichtete. Aber mich hat auch die Suche nach zwei fiktiven israelischen Geheimdienstleuten dorthin geführt, die ich willkürlich Joseph und Kurtz getauft hatte. Joseph war der Jüngere, Kurtz der Erfahrene.
Was genau ich bei Elkins zu finden hoffte, kann ich heute nicht mehr genau sagen; vielleicht war mir das schon damals nicht klar. Elkins war Mitte siebzig. War ich meinem Kurtz auf der Spur? Ich wusste, dass Elkins mehr als nur »ein wenig hiervon und ein wenig davon« gemacht hatte, wusste aber nicht, was genau. Er hatte für den OSS gearbeitet und gleichzeitig, noch vor der Gründung des Staates Israel, illegale Waffenlieferungen für die zionistische Untergrundbewegung Hagana in Palästina organisiert; dafür hatte man ihn beim OSS gefeuert, und er war mit seiner Frau, von der er sich später scheiden ließ, in einem Kibbuz untergetaucht. Allerdings hatte ich sein Buch noch nicht gelesen, das 1971 erschienen war: Forged in Fury. Das hätte ich besser tun sollen.
Ich wusste ebenfalls, dass Elkins, wie im Roman mein Kurtz, osteuropäischer Herkunft und in New Yorks Lower East Side aufgewachsen war, wo seine eingewanderten Eltern in der Textilbranche gearbeitet hatten. Ja, vielleicht suchte ich bei Elkins tatsächlich nach etwas von Kurtz: Nicht in Aussehen oder Gebaren, denn ich hatte schon eine recht bildhafte Vorstellung von meiner Figur und wollte mir die nicht durch Elkins’ Erscheinung nehmen lassen, nein, ich hoffte, dass Elkins vielleicht die eine oder andere Perle der Weisheit fallenließ, während er in Erinnerungen schwelgte. In Wien hatte ich Simon Wiesenthal getroffen, den gefeierten, aber auch kritisierten Nazijäger; Wiesenthal hatte mir zwar nichts Neues erzählt, aber es war eine denkwürdige Begegnung.
Vor allem aber wollte ich wohl Mike Elkins persönlich kennenlernen, den Mann mit der härtesten, verführerischsten Stimme, die ich je im Radio gehört hatte. Bei seinen anschaulichen, sorgsam gebauten Sätzen, in der gedehnten Aussprache der Bronx, horchte man auf, hörte zu, glaubte daran. Als er mich im Hotel anrief und sagte, er habe erfahren, ich sei in Jerusalem, wollte ich die Gelegenheit nicht versäumen, ihn zu besuchen.
Der Abend in Jerusalem ist ungewöhnlich drückend, und ich schwitze; ich kann mir nicht vorstellen, dass Mike Elkins je geschwitzt hat. Er ist schlank, aber kräftig, und seine körperliche Präsenz ist so stark wie seine Stimme. Er hat große Augen, hohle Wangen und lange Gliedmaßen, er sitzt links von mir, ich sehe ihn von der Seite mit einem Whiskyglas in der einen Hand, die andere ruht auf der Lehne seines Liegestuhls; über seinem Kopf prangt ein riesiger Mond. Die perfekte Radiostimme klingt so beruhigend und gesetzt wie immer, wenn auch die Sätze etwas kürzer ausfallen. Manchmal unterbricht er sich, als würde er sich aus der Ferne selbst betrachten, bevor er wieder einen Schluck Scotch trinkt.
Er spricht mich nicht direkt an, sondern eher vor sich hin, in die Dunkelheit, in ein Mikrofon, das nicht da ist, und es ist offenkundig, dass er beim Sprechen noch immer sorgsam auf Syntax und Rhythmus achtet. Wir saßen erst im Haus, doch die Nacht ist so schön, dass wir mit unseren Gläsern auf den Balkon hinausgegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, wann oder wie wir auf die Nazijagd zu sprechen kamen, vielleicht hatte ich von meinem Besuch bei Wiesenthal erzählt, doch Mike denkt nicht an die Jagd, sondern an die Morde.
Manchmal hatten wir keine Zeit, irgendwelche Erklärungen abzugeben, sagt er. Wir haben sie einfach umgebracht und sind abgehauen. Ein anderes Mal dann schafften wir sie irgendwohin und erklärten es ihnen. Auf einen Acker, in ein Lagerhaus. Manche weinten und gestanden. Andere tobten. Manche flehten uns an. Wiederum andere sagten nicht viel. Hatte der Mann eine Garage, dann führten wir ihn vielleicht dorthin. Schlinge um den Hals, am Querbalken befestigt. Wir stellten ihn auf seinen Wagen und fuhren aus der Garage. Dann gingen wir wieder hinein und schauten nach, ob er auch wirklich tot war.
Wir, höre ich recht? Wer genau ist wir? Wollen Sie mir damit sagen, Mike, dass Sie persönlich zu den Rächern gehörten? Oder geht es hier um ein allgemeines Wir, wie wir Juden, zu denen Sie sich zählen?
Elkins beschreibt noch andere Arten des Tötens, spricht weiterhin von diesem Wir, das ich nicht ganz verstehe, bis er auf die moralische Rechtfertigung zu sprechen kommt, Nazi-Kriegsverbrecher umzubringen, die sonst in diesem Leben keine gerechte Strafe gefunden hätten, weil sie ihre Identität vertuscht und sich – zum Beispiel in Südamerika – versteckt hatten. Er geht dann auf Schuld im Allgemeinen ein, spricht nicht mehr von der Schuld der Männer, die getötet worden waren, sondern, wenn überhaupt, von der Schuld jener, die sie getötet hatten.
Viel zu spät nehme ich mir Mikes Buch vor. Es sorgte für ziemliches Aufsehen, vor allem unter Juden. Ton und Inhalt des Buches sind so furchterregend, wie der Titel es vermuten lässt. Mike sagt, ein gewisser Malachi Wald habe ihm in einem Kibbuz in Galiläa zugeredet, dieses Buch zu verfassen. Darin beschreibt er, wie sein eigenes jüdisches Bewusstsein inmitten des amerikanischen Antisemitismus seiner Kindheit geweckt und durch die Gräueltaten im Holocaust und seine eigenen Erlebnisse beim OSS im besetzten Deutschland noch weiter gefestigt wurde. Sein Schreibstil ist in der einen Passage ungeheuer persönlich, in der nächsten wiederum vernichtend ironisch. Minutiös beschreibt er die unvorstellbaren Gräuel, die die Nationalsozialisten an den Juden in den Ghettos und den Lagern verübten. Ebenso anschaulich wird er dann bei den Heldentaten der Märtyrer des jüdischen Widerstands.
Am wichtigsten aber – und besonders kontrovers – ist die Tatsache, dass er uns die Existenz einer jüdischen Organisation namens DIN verrät, Hebräisch für Urteil; deren Gründer war ebenjener Malachi Wald, der Elkins gedrängt hatte, das Buch überhaupt zu schreiben.
Allein in den Jahren 1945 und 1946, so schreibt Elkins, hat DIN über tausend Nazi-Kriegsverbrecher gejagt und ermordet. Zu der Arbeit von DIN, die bis in die 70er fortgesetzt wurde, gehörte ein (gnädigerweise nie umgesetzter) Plan, die Wasserversorgung von 250 000 deutschen Haushalten zu vergiften und so als Vergeltung für die sechs Millionen ermordeter Juden eine Million deutsche Männer, Frauen und Kinder zu töten. DIN, so berichtet Mike, genoss die Unterstützung von Juden auf der ganzen Welt. Die ursprünglich fünfzig Mann große Gruppe rekrutierte sich aus sämtlichen Bereichen des Lebens: Geschäftsleute, Geistliche, Dichter.
Und Journalisten, fügt Mike Elkins ohne weiteren Kommentar hinzu.
16
Theater des Wirklichen: Kosenamen
In jenen angespannten Zeiten – und es dürfte schwerfallen, sich an eine Zeit zu erinnern, in der es in Beirut nicht angespannt war – war das Hotel Commodore die bevorzugte Anlaufstelle für alle echten und angeblichen Kriegsberichterstatter, Waffen- und Drogenhändler und für alle scheinbaren oder wirklichen Aufbauhelfer im gesamten Umland. Seine Anhänger verglichen es mit Rick’s Café in Casablanca, doch konnte ich keine Ähnlichkeit feststellen. Casablanca war kein städtisches Schlachtfeld, nur ein Durchgangslager; die Menschen kamen nach Beirut, um Geld zu verdienen, Unruhe zu stiften oder sogar Frieden zu bringen, aber nicht, weil sie wegwollten.
Das Commodore war nichts Besonderes. Zumindest nicht 1981; heute gibt es das Hotel nicht mehr. Es war ein langweiliges, mehrstöckiges Gebäude ohne irgendwelche besonderen architektonischen Merkmale, es sei denn, man hielt den über einen Meter dicken Empfangstresen aus Beton in der Eingangshalle für beachtenswert, der in schwierigen Zeiten auch als Geschützstellung diente. Hochverehrter Bewohner des Hotels war ein älterer Papagei namens Coco, der mit eiserner Stimme über die Kellerbar regierte. Je ausgeklügelter die Technik des Straßenkampfs wurde – von Halbautomatik zu Panzerfäusten, von leichten zu mittelschweren Waffen, oder wie auch immer der korrekte Begriff lautet –, desto schneller brachte Coco sein Repertoire an Kampfgetöse auf den neuesten Stand, und zwar so täuschend echt, dass sich ein ahnungsloser Gast in der Bar vom Zischen einer näher kommenden Rakete und dem Schrei: »Auf den Boden, du Blödmann, runter mit dem Arsch!« erschrecken ließ. Nichts bereitete den kriegsmüden Schreiberlingen, die von einem weiteren Höllentag zurückkehrten, mehr Vergnügen als der Anblick eines armen Neulings, der unter einen Tisch kroch, während sie lässig an ihrem mahagonifarbenen Whisky nippten.
Coco konnte auch die ersten Takte der Marseillaise und die Eingangssequenz von Beethovens 5. Symphonie pfeifen. Sein weiteres Leben ist in Dunkel gehüllt: Er wurde an einen sicheren Ort gebracht, wo er noch bis zum heutigen Tage singt; er wurde von syrischen Milizen abgeknallt; er erlag schließlich dem Alkohol in seinem Trinknapf.
In jenem Jahr unternahm ich mehrere Reisen nach Beirut und in den Südlibanon, zum einen für meinen Roman, zum anderen für den unter keinem guten Stern stehenden Film, der danach gedreht werden sollte. In der Erinnerung bilden diese Reisen eine einzige ununterbrochene Kette surrealer Erlebnisse. Für die Furchtsamen bot Beirut Angst rund um die Uhr, ob man nun an der Corniche von knatterndem Geschützfeuer untermalt speiste oder sich voller Sorge auf die Worte eines palästinensischen Teenagers konzentrierte, der einem eine Kalaschnikow an den Kopf hielt, erzählte, dass er davon träumte, in Havanna Internationale Beziehungen zu studieren, und wissen wollte, ob man ihm dabei behilflich sein könne.
Als Neuling im Commodore interessierte ich mich schon beim ersten Anblick für Mo. Er hatte mehr Tod und Sterben an einem Nachmittag gesehen als ich in meinem ganzen Leben. Er hatte aus den tiefsten Herzen der Finsternis, die diese Welt zu bieten hat, Exklusivberichte geschickt. Man musste nur mitkriegen, wie er nach einem weiteren Tag an der Front mit einer zerschlissenen khakifarbenen Reisetasche über der Schulter durch die überfüllte Hotelhalle zum Pressebüro marschierte, um zu erkennen, dass er anders war. Mo ist der erfahrenste Mann in der Stadt, erzählte man sich. Hat alles gesehen, alles gemacht, ohne Scheiß, und am besten ist er, wenn es auf Spitz und Knopf steht, da kannst du jeden fragen, der ihn kennt. Manchmal ein bisschen deprimiert, ein wenig seltsam vielleicht. Und er neigt dazu, sich ab und zu mal für ein, zwei Tage mit einer Flasche ins Zimmer einzusperren, aber warum auch nicht? Und der einzige Begleiter, den er in letzter Zeit hatte, sei ein Kater gewesen, der sich, so die Legende im Commodore, aus Verzweiflung aus einem Fenster im obersten Stock gestürzt hatte.
Als Mo also bei meinem ersten Aufenthalt in Beirut nach zwei oder drei Tagen vorschlug, ich könne ihn ja bei einer kleinen Spritztour begleiten, die er gerade vorhabe, da nutzte ich sofort die Gelegenheit. Ich hatte schon alle anderen Korrespondenten ausgefragt, doch Mo hatte sich abseits gehalten. Ich war geschmeichelt.
»Wollen wir eine kleine Ausfahrt in die Wüste machen? Ein paar Verrückten guten Tag sagen, die ich da kenne?«
Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, sagte ich.
»Sie suchen nach Lokalkolorit, stimmt’s?«
Ja, ich suchte nach Lokalkolorit.
»Der Fahrer ist Druse. Diese drusischen Ärsche geben einen Scheiß auf alle anderen Ärsche. Stimmt’s?«
Absolut, Mo, danke.
»Die anderen Ärsche – Schiiten, Sunniten, Christen –, die machen nichts als Ärger. Drusische Ärsche gehen allem Ärger aus dem Weg.«
Klingt prima.
Es wird eine Besichtigungstour zu den Checkpoints. Ich hasse Flughäfen, Fahrstühle, Krematorien, Landesgrenzen und Grenzkontrollen. Aber Checkpoints sind eine Klasse für sich. Dort kontrollieren sie nicht deinen Pass, sondern deine Hände. Dann dein Gesicht. Dann dein vorhandenes oder nichtvorhandenes Charisma. Und selbst wenn der eine Checkpoint findet, dass du okay bist, dann geben sie diese gute Nachricht keineswegs zum nächsten Checkpoint durch, nein, ein Checkpoint ist nämlich misstrauischer als der andere und will sich nicht ausstechen lassen. Wir halten an einer rotweißen Absperrstange zwischen zwei Ölfässern. Der Bursche, der seine Kalaschnikow auf uns richtet, trägt gelbe Gummistiefel und eine an den Knien abgeschnittene, ausgefranste Jeans; auf seiner Brusttasche prangt ein Aufnäher des Fanclubs von Manchester United.
»Arsch Mo!«, ruft diese Erscheinung zur Begrüßung. »Herzlich willkommen, Sir! Wie geht es Ihnen heute?« – in brav geübtem Englisch.
»Bestens, danke, Arsch Anwar, bestens«, entgegnet Mo leichthin. »Empfängt Arsch Abdullah heute Besuch? Darf ich dir meinen guten Freund Arsch David vorstellen?«
»Arsch David, ganz herzlich willkommen, Sir.«
Wir warten, und der Bursche brüllt fröhlich in sein russisches Walkie-Talkie. Dann hebt sich die rotweiße Stange. Ich habe nur noch eine vage Vorstellung von unserem Gespräch mit Arsch Abdullah. Sein Hauptquartier war ein Haufen Backsteine und Felsbrocken, von Einschusslöchern durchsiebt und mit Parolen beschmiert. Abdullah saß hinter einem riesigen Mahagonischreibtisch. Andere Ärsche lungerten um ihn herum und fummelten an ihren halbautomatischen Waffen. Über seinem Kopf hing das gerahmte Foto einer Swissair Douglas DC 8, die auf einer Landebahn in die Luft gesprengt worden war. Ich erinnere mich, dass ich noch genau wusste, das Flugfeld hieß Dawson’s Field und der Jumbo war von palästinensischen Kämpfern mit Unterstützung der Baader-Meinhof-Gruppe entführt worden. Damals flog ich sehr häufig mit der Swissair. Ich erinnere mich auch noch, dass ich mich fragte, wer sich wohl die Mühe gemacht hatte, das Foto zum Rahmen zu bringen. Vor allem aber erinnere ich mich daran, wie ich meinem Schöpfer dafür dankte, dass unser Gespräch von einem Dolmetscher übermittelt wurde, dessen Englisch im besten Fall holprig war, und dass ich betete, es würde lang genug holprig bleiben, damit unser drusischer Fahrer, der jedem Ärger aus dem Weg ging, uns in den sicheren Hafen des Commodore Hotel zurückfahren konnte. Und ich erinnere mich an das fröhliche Lächeln auf Abdullahs bärtigem Gesicht, als er die Hand aufs Herz legte und sich überschwänglich bei Arsch Mo und Arsch David für ihren Besuch bedankte.
»Mo mag es, die Leute bis an den Rand des Abgrunds zu bringen«, warnte mich ein freundlicher Mensch, doch da war es bereits zu spät. Denn die Botschaft lautete: In Mos Welt kriegen Kriegstouristen, was sie verdienen.
Erhielt ich den Anruf aus dem Nirgendwo in derselben Nacht? Jedenfalls wäre das der beste Zeitpunkt gewesen. Ganz sicher kam er zu Beginn meiner Zeit in Beirut, denn nur ein Neuankömmling hätte so dumm sein können, das kostenlose Upgrade in eine Hochzeitssuite im rätselhaft leeren obersten Stockwerk des Commodore anzunehmen. Das Nachtkonzert Beiruts hatte 1981 noch nicht die Qualität späterer Jahre erreicht, aber es machte erstaunliche Fortschritte. Die Vorstellung begann üblicherweise gegen zweiundzwanzig Uhr und erreichte ihren Höhepunkt in den frühen Morgenstunden. Die Gäste im obersten Stockwerk bekamen das gesamte Spektakel präsentiert: Blitze wie eine inszenierte Morgendämmerung, das Geknatter der einschlagenden und abgehenden Artilleriegeschosse – die nicht voneinander zu unterscheiden waren – und das Rattern der Handfeuerwaffen, dem vielsagende Stille folgte. Dies alles, zumindest für das ungeübte Ohr, im Nachbarzimmer.
Mein Zimmertelefon klingelte. Ich hatte gerade überlegt, unters Bett zu kriechen, doch jetzt saß ich aufrecht auf der Bettkante und hielt mir den Hörer ans Ohr.
»John?«
John? Ich? Na ja, ein paar Leute, meist Journalisten, die mich nicht kennen, nennen mich manchmal John. Also sage ich ja, wer ist denn da? – und erhalte zur Antwort eine Schimpftirade. Eine Frau ist am Telefon, eine Amerikanerin, und offenkundig ist sie ziemlich sauer.
»Was zum Teufel soll das heißen, wer ist da? Jetzt tu nur ja nicht so, als ob du meine Stimme nicht erkennst, verdammt! Du bist ein schmieriger britischer Mistkerl, stimmt’s? Du bist ein verlogener Schlappschwanz – unterbrich mich nicht, verdammt!« – und überschreit meine Unschuldsbeteuerungen. »Jetzt komm mir nur ja nicht mit diesem blasierten britischen Scheiß, als ob wir zum Tee im beschissenen Buckingham Palace sind! Ich hab auf dich gezählt, okay? Man nennt so etwas Vertrauen. Jetzt hör mir mal zu, verflucht. Ich gehe zum beschissenen Friseur. Ich packe meinen Krempel in eine nette kleine Tasche. Und dann stehe ich wie eine Nutte am Straßenrand und warte verfluchte zwei Stunden oder so. Ich komme fast um vor Angst, dass du irgendwo tot im Straßengraben liegst, aber wo bist du? Im Scheißbett!« Plötzlich hat sie eine Idee und spricht leiser – »Machst du da oben vielleicht mit einer Frau rum? Denn wenn – stopp! – jetzt komm mir nicht in diesem verdammten Ton, du britischer Mistkerl!«
Langsam, ganz langsam kann ich sie von ihrem Irrtum überzeugen. Ich erkläre ihr, dass sie den falschen John erwischt hat und dass ich eigentlich gar nicht John, sondern David heiße – kurze Pause wegen eines lebhaften Schusswechsels –; der richtige John muss wohl abgereist sein – Bumm-bumm –, denn das Hotel hat mir schon am Vormittag diese wirklich hübsche Suite zur Verfügung gestellt. Es tut mir leid, sage ich, wirklich leid, dass sie das Pech hatte, den falschen Mann anzubrüllen. Ich kann ihre Verärgerung ja verstehen – und eigentlich bin ich ganz dankbar dafür, mit einem anderen menschlichen Wesen zu sprechen, statt allein unter einem Bett in einer Hotelsuite zu sterben, die mich nichts kostet. Wie furchtbar, so versetzt zu werden, fahre ich galant fort – ihr Problem ist jetzt mein Problem, und ich möchte, dass wir uns verstehen. Und vielleicht hat der echte John ja einen ganz vernünftigen Grund dafür, dass er nicht auftaucht, bemerke ich, schließlich kann in dieser Stadt ja alles Mögliche passieren, oder? – Bumm-bumm.
Aber todsicher, David, sagt sie, und warum hätte ich denn eigentlich zwei Namen? Das erkläre ich ihr und frage sie, von wo sie anruft. Aus der Bar im Keller, antwortet sie, und ihr John ist auch ein britischer Schriftsteller, also, das ist wirklich merkwürdig, und sie heißt Jenny – oder vielleicht Ginny oder Penny, denn bei dem ganzen Geballer kann ich sie nicht richtig hören. Warum komme ich denn nicht runter in die Bar und wir trinken was zusammen?
Ich weiche aus und frage, was ist denn mit dem richtigen John?
Sie antwortet, ach, scheiß auf John, der wird schon klarkommen, tut er doch immer.
Alles ist besser, als auf oder unter meinem Bett zu liegen und beschossen zu werden. Und nachdem die Frau sich beruhigt hat, klingt ihre Stimme auch recht liebenswürdig. Ich bin einsam und habe Angst. Andere als schlechte Ausreden fallen mir nicht ein, also ziehe ich mich an und gehe nach unten. Und da ich Fahrstühle hasse und mir über meine wahren Absichten nicht mehr ganz sicher bin, trödle ich und nehme die Treppe. Als ich in der Bar im Keller eintreffe, ist sie leer, bis auf zwei betrunkene französische Waffenhändler, den Barkeeper und den alten Papagei, den ich für ein Männchen halte – aber wer weiß? – und der an seinem Repertoire von Detonationsgeräuschen feilt.
Dann bin ich wieder in England und mehr denn je entschlossen, Die Libelle verfilmen zu lassen. Und meine Schwester Charlotte soll die Rolle der Charlie spielen, zu der sie mich inspiriert hat. Warner Brothers kaufen die Rechte und machen einen Vertrag mit George Roy Hill, der durch Butch Cassidy berühmt ist. Ich bringe Charlottes Namen ins Spiel. Hill ist begeistert, trifft sich mit ihr, mag sie. Er wird mit dem Studio reden. Diane Keaton kriegt die Rolle. George, der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wie man weiß, drückt es später so aus:
»David, ich hab deinen Film versaut.«
17
Der sowjetische Ritter stirbt in seiner Rüstung
Ich bin nur zweimal in Russland gewesen: das erste Mal 1987, als es dank Michail Gorbatschow mit der Sowjetunion zu Ende ging und alle das wussten, nur die CIA nicht; das zweite Mal sechs Jahre später, als der kriminalisierte Kapitalismus sich den gescheiterten Staat wie in einem Rausch angeeignet hatte und das Land in den Wilden Osten verwandelte. Dieses neue, stürmische Russland wollte ich mir unbedingt anschauen. Und so kam es, dass zwischen meinen beiden Reisen Anfang und Ende der größten gesellschaftlichen Umwälzungen in Russland seit der bolschewistischen Revolution lagen. Außergewöhnlich dabei war, dass der Übergang nach russischen Maßstäben recht unblutig vonstattenging – sehen wir mal ab von ein paar tausend Opfern durch Auftragsmorde, Bandenschießereien, politische Attentate, Erpressungen und Folter.
In den fünfundzwanzig Jahren vor meiner ersten Reise waren meine Beziehungen zu Russland alles andere als freundlich gewesen. Seit dem Erscheinen von Der Spion, der aus der Kälte kam war ich Ziel literarischer Beschimpfungen durch die Sowjets; einmal hieß es, ich würde dem Spion den Nimbus des Helden verpassen (so als hätten die Sowjets nicht auf genau dieselbe Art und Weise eine Kunstform daraus gemacht), ein andermal, ich hätte die richtige Vorstellung vom Kalten Krieg, zöge aber falsche Schlüsse, ein Vorwurf, auf den es keine logische Antwort gibt. Allerdings ging es dabei ja auch nicht um Logik, sondern um Propaganda. Aus den Schützengräben der Literaturnaja Gazeta, die vom KGB kontrolliert wurde, und des Encounter, der von der CIA kontrolliert wurde, beschossen wir uns gegenseitig, obwohl wir wussten, dass im sterilen ideologischen Krieg der Wörter keine von beiden Seiten gewinnen würde. Als ich 1987 auf der sowjetischen Botschaft in Kensington Palace Gardens mein Visum abholte, war ich also nicht sonderlich überrascht, dass der dortige Kulturattaché recht unhöflich bemerkte, wenn man mich schon ins Land ließe, dann dürfe ja bald wohl jeder kommen.
Und als ich einen Monat später auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo eintraf – ich war Gast des Schriftstellerverbands der UdSSR, eine Einladung, die offenbar von unserem Botschafter und Raissa Gorbatschowa über die Köpfe des KGB hinweg eingefädelt worden war –, überraschte es mich auch nicht, dass der Bursche im Glaskäfig mit seiner eisigen Miene und den magentafarbenen Schulterstücken die Echtheit meines Reisepasses anzweifelte. Es überraschte mich auch nicht, dass mein Gepäck unerklärlicherweise achtundvierzig Stunden lang verschwunden blieb und ohne jede weitere Erklärung in meinem Hotelzimmer auftauchte (die Anzüge waren zusammengeknüllt); oder dass, wann immer ich mein Zimmer im trostlosen Hotel Minsk für ein paar Stunden verließ, alles demonstrativ auf den Kopf gestellt wurde – durchwühlter Kleiderschrank, auf dem Schreibtisch verteilte Unterlagen; und auch nicht, dass mir zu guter Letzt noch ein Paar übergewichtiger KGB-Wachhunde mittleren Alters zugewiesen wurde, die mir im Abstand von zwei Metern folgten, wann immer ich allein unterwegs war. Ich nannte sie Muttski und Jeffski.
Nur gut, dass ich die beiden hatte. Nach einem rauschenden Abend im Haus des Regimekritikers und Journalisten Arkadi Vaksberg, der nun bewusstlos auf dem Boden seines Wohnzimmers liegt, stehe ich mutterseelenallein auf einer namenlosen Straße; es ist stockfinster, kein Mond, keine Spur von Morgendämmerung, kein Lichtschimmer aus der Innenstadt, der mir den Weg weisen würde. Passanten um Rat fragen kann ich auch nicht, denn ich spreche kein Russisch, aber es gibt sowieso keine Passanten. Zu meiner Erleichterung entdecke ich die Umrisse meiner beiden treuen Wachhunde, die auf einer Parkbank sitzen, wo sie wahrscheinlich abwechselnd ein Nickerchen gemacht haben.
»You speak English?«
Njet.
»Français?«
Njet.
»Deutsch?«
Njet.
»Ich bin sehr betrunken« – idiotisches Grinsen, langsam rotierende Bewegung der rechten Hand über dem rechten Ohr – »Hotel Minsk – okay? Das kennen Sie doch? Gehen wir gemeinsam?« Und damit strecke ich beide Ellbogen aus und signalisiere so Bruderschaft und Widerstandslosigkeit.
Zu dritt marschieren wir langsam nebeneinander einen baumgesäumten Boulevard entlang, dann durch menschenleere Straßen zum fürchterlichen Hotel Minsk. Ich weiß Annehmlichkeiten zu schätzen und versuchte deshalb, ein Zimmer in einem der Devisen-Hotels in Moskau zu bekommen, doch meine Gastgeber wollten davon nichts wissen. Ich muss im Minsk wohnen, in der VIP-Suite im obersten Stock, wo die uralten Mikrofone durchgehend in Betrieb sind und eine furchteinflößende Concierge den Flur bewacht.
Aber auch meine Wachhunde sind nur Menschen. Und nach einer Weile wirkten Muttski und Jeffski so schicksalsergeben, duldsam, ja liebenswert, dass ich ihnen gern nähergekommen wäre, statt sie auf Distanz zu halten. Eines Abends aß ich mit meinem jüngeren Bruder Rupert, in jenen aufregenden Tagen Leiter des Moskauer Büros des Independent, in einem der ersten privaten Restaurants in Moskau. Rupert und mich trennen zwanzig Jahre, doch bei schlechtem Licht und besonders wenn man betrunken ist, ähneln wir uns etwas. Rupert hatte noch ein paar andere Moskauer Korrespondenten eingeladen. Wir unterhielten uns und tranken, doch meine beiden Wachhunde saßen untröstlich an einem Ecktisch. Da mich ihre missliche Lage rührte, bat ich einen Kellner, den beiden eine Flasche Wodka zu bringen, und sah ostentativ weg. Als ich wieder zu ihnen hinüberschaute, war die Flasche nirgendwo zu sehen, doch als wir aufbrachen, folgten die beiden dem falschen Bruder nach Hause.
Wollte man Russland in jenen Tagen beschreiben, ohne Wodka zu erwähnen, dann könnte man genauso gut versuchen, ein Pferderennen ohne Pferde zu beschreiben. In dieser Woche statte ich auch meinem Moskauer Verleger einen Besuch ab. Es ist elf Uhr früh. Sein vollgestopftes Büro im Dachgeschoss ist übersät mit staubigen Akten wie in einem Dickens-Roman, Stapeln rätselhafter Pappschachteln und vergilbten, mit Bindfaden zusammengehaltenen Typoskripten. Als ich eintrete, springt er von seinem Schreibtisch auf und drückt mich vor Freude brüllend an die Brust.
»Wir haben Glasnost!«, ruft er. »Wir haben Perestroika! Die Zensur ist vorüber, mein Freund! Ab sofort kann ich alle Ihre Bücher drucken: alte Bücher, neue Bücher, schlechte Bücher, völlig egal! Sie schreiben Telefonbuch? Ich verlege es! Ich verlege alles, nur keine Bücher, die diese verdammten Mistkerle von der Parteizensur wollen!«
Gorbatschows neueste Gesetze über den Alkoholkonsum interessieren ihn nicht. Selig holt er eine Flasche Wodka aus der Schublade, schraubt den Deckel ab und wirft ihn zu meinem Entsetzen mit einem Schwung in den Papierkorb.
Es schien mir nur logisch, dass ich in dem Spiegelkabinett, in das ich da geraten war, zwar beobachtet, beschattet und mit größtem Misstrauen betrachtet wurde, die sowjetische Regierung mich gleichzeitig aber als Ehrengast behandelte. In der Iswestija druckte man mein Foto über einer wohlwollenden Unterschrift, mein Gastgeber, der Schriftstellerverband der UdSSR, bewirtete mich fürstlich, dabei lagen die literarischen Fähigkeiten bei so manchem Verbandsmitglied im Dunkeln und bei anderen im Reich der Fabel.
Da war zum Beispiel der große Dichter, dessen Lebenswerk aus einem Gedichtband bestand, der vor dreißig Jahren erschienen war, aber, so die Gerüchte, aus der Feder eines anderen Dichters stammte, den Stalin wegen Rebellion hatte hinrichten lassen. Da war der ururalte Mann mit dem weißen Bart und den roten Augen, in denen sich Tränen stauten, er hatte ein halbes Jahrhundert im Gulag verbracht, bevor er im Zusammenhang mit Glasnost, dank der neuen Offenheit, rehabilitiert worden war. Irgendwie hatte er es geschafft, ein backsteindickes Tagebuch über seine lebenslangen Prüfungen zu führen und zu veröffentlichen. Der Band steht nun in meiner Bibliothek, auf Russisch, was ich ja nicht lesen kann. Und da waren die literarischen Artisten, die jahrelang auf dem Drahtseil der offiziellen Zensur getanzt und Allegorien verfasst hatten, mit kodierten Botschaften für jene Leser, die sie zu deuten wussten. Was werden sie wohl schreiben, fragte ich mich, wenn sie in freier Wildbahn ausgesetzt werden? Sind sie die Tolstois und Lermontows von morgen? Oder haben sie schon so lange um die Ecke gedacht, dass sie nicht mehr geradlinig schreiben können?
Bei einer Gartenparty in der Schriftstellerkolonie im grünen Vorort Peredelkino trugen jene, die nach allgemeiner Vorstellung allzu konform mit der Parteilinie gewesen waren, im Licht der aufziehenden Perestroika Armesündermienen, als sie da neben jenen standen, die sich mit ihrer Disziplinlosigkeit einen Namen gemacht hatten. Einer aus dieser Gruppe, wie er mir erzählte, war Jan, ein betrunkener Dramatiker, der mir unbedingt einen Arm um die Schulter legen wollte, während er mir verschwörerisch ins Ohr flüsterte.
Schließlich hatten Jan und ich über Puschkin, Tschechow und Dostojewski diskutiert, vielmehr hatte Jan diskutiert, und ich hatte zugehört. Wir waren von Jack London begeistert. Jan zumindest. Er erzählte mir, falls ich wirklich wissen wolle, was für ein Saustall das real-kommunistische Russland sei, dann müsse ich nur mal versuchen, meiner Großmutter in Nowosibirsk aus meinem Haus in Leningrad einen gebrauchten Kühlschrank zu schicken, da würde ich schon sehen, wie weit ich käme. Wir fanden beide, dass dies ein gutes Beispiel für den Zerfall der Sowjetunion sei, und lachten uns schief darüber.
Am nächsten Morgen rief mich Jan im Hotel Minsk an. »Keine Namen. Sie kennen meine Stimme, ja?«
Ja.
»Gestern Abend habe ich schlechten Witz über meine Großmutter gesagt, okay?«
Okay.
»Sie wissen?«
Ich weiß.
»Ich habe Ihnen niemals schlechten Witz erzählt. Okay?«
Okay.
»Schwören Sie.«
Ich schwöre.
Ein Künstler, den ich traf, sollte zweifellos alle Beschränkungen überleben, die ihm auferlegt wurden: Ilya Kabakow, der im Laufe der Jahrzehnte mehrmals das offizielle sowjetische Wohlwollen genossen und wieder verloren hatte, bis er zum Schluss gezwungen war, die eigenen Zeichnungen mit einem anderen Namen zu signieren. In Kabakows Studio kam man nur, wenn man vertrauenswürdig war und jemanden kannte, erst dann beleuchtete einem ein Bursche mit einer Taschenlampe den Weg über lange klapprige Planken auf den Sparren mehrerer aneinandergrenzender Dachböden.
Dann endlich war man bei Kabakow, dem überschwänglichen Eremiten und außergewöhnlichen Maler, im Kreise einer Gruppe lächelnder Frauen und Bewunderer. Hier fand sich auf Leinwand die wundersame Welt seiner selbstauferlegten Gefangenschaft: Er hatte diese Welt verspottet, ihr vergeben, sie verschönert und ihr mit dem liebenden Blick des unbesiegbaren Schöpfers Allgemeingültigkeit verliehen.
In der Sergius-Kathedrale in Sagorsk, dem heutigen Sergijew Possad, oft auch der russische Vatikan genannt, sah ich alte, schwarzgekleidete russische Frauen, die auf dem steinernen Boden vor den Gräbern niederknieten, in denen die Heiligenreliquien liegen, und das dicke, beschlagene Glas davor küssten. In einem modernen, mit funktionellen skandinavischen Möbeln ausgestatteten Büro erläuterte mir der in feinstes Tuch gewandete Vertreter des Archimandriten, wie der christliche Gott durch die Vertretung des Staates wirkte.
»Gilt dies nur für den kommunistischen Staat?«, frage ich ihn, nachdem er sein Standardrepertoire abgespult hat. »Oder wirkt Er auch durch andere Staaten?«
Als Antwort erhalte ich das breite, vergebungsvolle Lächeln des Folterknechts.
Um den Schriftsteller Tschingis Aitmatow zu besuchen, von dem ich zu meiner Schande bis dato noch nie gehört hatte, fliegen mein britischer Dolmetscher und ich mit der Aeroflot in die Militärstadt Frunse, heute Bischkek, in Kirgisien. Untergebracht sind wir nicht in Frunses Äquivalent des Hotel Minsk, sondern in einem luxuriösen Fünf-Sterne-Erholungsheim des Zentralkomitees.
Um das umzäunte Gelände patrouillieren bewaffnete KGB-Truppen mit Hunden. Die seien da, so sagt man uns, um uns vor den Viehdieben aus den Bergen zu beschützen. Kein Wort über irgendwelche regimekritischen muslimischen Volksstämme. Wir sind die einzigen Gäste im Erholungsheim. Im Keller gibt es einen erstklassig ausgestatteten Swimmingpool mit Sauna. Dort sind Spinde, und die Handtücher und Bademäntel sind mit flauschigen Tieren bestickt. Ich nehme den Elch. Das Wasser ist altherrenwarm. Für ein paar amerikanische Dollar bietet uns der Direktor verschiedene Sorten verbotenen Wodkas und die Damen der Stadt an. Ersteres nehmen wir dankend an, das Zweite lehnen wir dankend ab.
Als wir wieder in Moskau sind, ist der Rote Platz rätselhafterweise abgesperrt. Unsere Pilgerreise an Lenins Grab ist auf einen anderen Tag verschoben worden. Erst nach weiteren zwölf Stunden finden wir heraus, was der Rest der Welt schon weiß: Ein junger deutscher Pilot namens Mathias Rust hat die sowjetische Boden- und Luftabwehr unterflogen und ist auf der Türschwelle des Kreml gelandet, und er verschafft nebenbei Gorbatschow die passende Ausrede, seinen Verteidigungsminister und einen ganzen Haufen Generäle zu feuern, die sich seinen Reformen widersetzen. Doch als die Geschichte im Kreis der Literaten von Peredelkino die Runde macht, höre ich niemanden, der dieses fliegerische Kunststück preist, höre ich niemanden lachen: Alle erstarren und werden stiller, und die vertraute Angst macht sich breit, dass sich Unvorhersehbares, dass sich Gewaltsamkeiten entwickeln könnten. Wird es einen Staatsstreich geben, einen Militärputsch, oder gar – auch heute noch – eine Säuberung solch unerwünschter Intellektueller wie uns?
In der Stadt, die noch Leningrad heißt, treffe ich den berühmtesten russischen Dissidenten und einen der größten Männer seiner Generation: den Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow mit seiner Frau Jelena Bonner; beide sind gerade von Gorbatschow, ganz im Geiste von Glasnost, nach sechs Jahren Verbannung in Gorki freigelassen worden, um an der Perestroika mitzuwirken.
Sacharow, der Physiker, hatte all seine Mühen in die Entwicklung der ersten Wasserstoffbombe für den Kreml gesteckt; Sacharow, der Regimekritiker, wachte eines Morgens auf, erkannte, dass er seine Bombe einer Bande von Gangstern überlassen hatte, und war so mutig, dieses auch laut zu sagen. Wir sitzen, Jelena Bonner neben Sacharow, an einem runden Tisch im einzigen privaten Restaurant der Stadt und unterhalten uns; währenddessen umschwirrt uns eine ganze Schar junger KGB-Beamter und lässt pausenlos uralte Fotoapparate aufblitzen. Das wirkt umso surrealer, da sich weder im Restaurant noch auf den Straßen Russlands irgendjemand umdreht und Andrei Sacharow anstarrt oder heimlich auf ihn zukommt, um die Hand des großen Mannes zu schütteln, und zwar schlicht aus dem Grund, dass sein Gesicht nirgendwo gezeigt werden durfte, seit er in Ungnade gefallen war. Unsere Unfotografen fotografieren ein Ungesicht.
Sacharow fragt mich, ob ich jemals Klaus Fuchs begegnet sei, dem britischen Atomphysiker und Sowjetspion, der aus einem britischen Gefängnis entlassen wurde und nun in der DDR lebt.
Nein, bin ich nicht.
Ob ich denn zufällig wisse, wie Fuchs erwischt worden sei?
Ich kannte den Mann, der ihn verhört hat, erwidere ich, aber ich weiß nicht, wie er erwischt worden ist. Der schlimmste Feind eines Spions ist ein anderer Spion, deute ich an und nicke in die uns umkreisende Runde der falschen Fotografen. Vielleicht hat einer Ihrer Spione einem unserer Spione von Klaus Fuchs berichtet. Sacharow lächelt. Im Gegensatz zu Jelena Bonner lächelt er häufig. Ich frage mich, ob das ein natürlicher Charakterzug ist oder ob er sich das Lächeln angewöhnt hat, um seine Verhörer damit zu entwaffnen. Aber warum fragt er mich nach Fuchs? Insgeheim wundere ich mich. Vielleicht weil Fuchs in der relativ freien westlichen Gesellschaft den Weg des geheimen Verrats beschritten hat, statt aufzustehen und offen seine Ansichten kundzutun. Sacharow wiederum hat in dem Polizeistaat, der nun im Todeskampf lag, für sein Recht auf freie Meinung Folter und Gefangenschaft durchlitten.
Sacharow berichtet, dass es dem uniformierten KGB-Wachmann, der Tag für Tag vor ihrem Quartier in Gorki stand, verboten war, mit seinen Gefangenen Blickkontakt aufzunehmen, und er ihnen dementsprechend die tägliche Ausgabe der Prawda über die Schulter reichte: Hier, aber schauen Sie mir nicht in die Augen. Er erzählt, dass er Shakespeares Werke von vorn bis hinten durchgelesen hat. Bonner erwähnt noch, dass Andrei große Teile der Stücke auswendig gelernt hat, aber nicht weiß, wie man die Worte ausspricht, da er im Exil kein Englisch gehört hat. Dann berichtet er, wie nach sechs Jahren im Exil eines Nachts jemand an die Tür ihres Quartiers hämmerte und Jelena Bonner ihn bat: ›Mach nicht auf‹; er machte trotzdem auf.
»Ich sagte zu Jelena, mehr als das, was sie uns schon angetan haben, können sie uns nicht mehr antun«, erklärt er.
Also öffnete er die Tür und stand vor zwei Männern, ein Offizier in KGB-Uniform und einer in Arbeitskleidung.
»Wir wollen ein Telefon anschließen«, sagte der KGB-Offizier.
Sacharow lächelt wieder verschmitzt. Er sei kein Trinker, sagt er – in Wahrheit ist er Abstinenzler –, aber in einer russischen geschlossenen Stadt ein Telefon angeboten zu bekommen ist etwa so unwahrscheinlich wie das Angebot eines Glases eisgekühlten Wodkas in der Sahara.
»Wir wollen kein Telefon, nehmen Sie es wieder mit«, sagte Bonner zu dem Offizier.
Doch wieder setzte sich Sacharow darüber hinweg: Sollen sie doch ruhig das Telefon anschließen, was haben wir schon zu verlieren? Also schlossen die beiden das Telefon an, keineswegs zum Wohlgefallen von Bonner.
»Stellen Sie sich morgen Mittag auf einen Anruf ein«, sagte der Offizier und warf die Tür hinter sich zu.
Sacharow spricht überlegt, wie ein Wissenschaftler eben. Die Wahrheit liegt im Detail. Es wurde Mittag, dann ein Uhr, dann zwei Uhr. Sie stellten fest, dass sie Hunger hatten. Sie hatten schlecht geschlafen und nicht gefrühstückt. Sacharow sagte zu dem Hinterkopf des Wachmanns, dass er zum Laden gehen wolle, um Brot zu kaufen. Gerade als er sich aufmachte, rief Jelena Bonner ihn zurück.
»Für dich.«
Sacharow kehrte in die Unterkunft zurück und nahm den Hörer. Nachdem er von einer Reihe mehr oder weniger freundlicher Personen weiterverbunden worden war, stellte man ihn zu Michail Gorbatschow durch, dem Generalsekretär der KPdSU. Was vergangen ist, ist vergangen, sagt Gorbatschow. Das Zentralkomitee hat Ihren Fall geprüft; Sie sind frei und können nach Moskau zurück. Ihre alte Wohnung wartet auf Sie, Sie werden sofort wieder in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen, alles ist bereit, damit Sie Ihren rechtmäßigen Platz als verantwortungsvoller Bürger im neuen Russland der Perestroika einnehmen.
Der Ausdruck ›verantwortungsvoller Bürger‹ bringt Sacharow auf die Palme. Ein verantwortungsvoller Bürger sei nach seinen Vorstellungen, teilt er Gorbatschow mit – leicht hitzig, kann ich mir vorstellen, auch wenn Sacharow gerade wieder einmal lächelt –, jemand, der die Gesetze des Landes achtet. Selbst in dieser geschlossenen Stadt, fährt er fort, liefen Bewohner herum, die nie auch nur in die Nähe eines Gerichts gekommen seien, und einige wüssten kaum, warum sie überhaupt hier seien.
»Ich habe Ihnen Briefe deshalb geschrieben, aber nicht mal den Anschein einer Antwort erhalten.«
»Wir haben Ihre Briefe bekommen«, erwiderte Gorbatschow besänftigend. »Das Zentralkomitee prüft sie. Kommen Sie nach Moskau zurück. Das Vergangene ist vorbei. Helfen Sie mit beim Wiederaufbau.«
An diesem Punkt des Telefonats schien sich Sacharow endgültig festgebissen zu haben, denn er spulte eine ganze Liste weiterer vergangener und gegenwärtiger Verfehlungen des Zentralkomitees herunter, zu denen er Gorbatschow ebenfalls ohne Antwort geschrieben hatte. Doch mitten in seiner Tirade, erzählt er, warf ihm Jelena einen Blick zu. Und da wurde ihm klar: Wenn er noch eine Weile so weitermachte, dann würde Gorbatschow zu ihm sagen: »Nun, wenn Sie wirklich so darüber denken, Genosse, dann können Sie bleiben, wo Sie sind.«
Also legte Sacharow auf. Einfach so. Ohne ein »Auf Wiedersehen, Michail Sergejewitsch«.
Und da ging ihm auf – er grinst spitzbübisch, und selbst Jelena Bonner kann ein schelmisches Zwinkern nicht unterdrücken:
»Und da ging mir auf, dass ich es geschafft hatte, bei meinem ersten Telefonat nach sechs Jahren ausgerechnet den Generalsekretär der KPdSU aus der Leitung zu werfen.«
Ein paar Tage später soll ich an der Moskauer Staatsuniversität zu einer Versammlung von Studenten sprechen. Auf dem Podium sitzen John Roberts, mein unerschütterlicher britischer Reiseführer und Dolmetscher, Wolodja, mein russischer Reiseführer, ob mir ihn nun der PEN oder der Schriftstellerverband zur Verfügung gestellt hat, bin ich nicht sicher, und ein blasser Professor, der meine Anwesenheit recht unhöflich, wie ich fand, als eine Folge von Glasnost dargestellt hat. Ich habe den Eindruck, dass er meint, Glasnost sei ohne mich erheblich besser dran. Nicht sonderlich überschwänglich bittet er nun das Publikum um Fragen.
Die ersten Fragen werden auf Russisch gestellt, aber der blasse Professor formuliert sie derart offenkundig um, dass die Studenten, die eh schon unruhig geworden sind, ihre Fragen lieber auf Englisch vorbringen. Es geht darum, welche Autoren ich bewundere und welche nicht. Es geht um den Spion als Produkt des Kalten Krieges. Wir kommen – durchaus frech – darauf zu sprechen, wie unmoralisch es ist, die eigenen Kollegen zu verpfeifen. Doch der blasse Professor hat nun genug. Eine letzte Frage wird er noch zulassen. Eine Studentin reckt die Hand in die Höhe. Ja, Sie.
Studentin: Sir. Bitte. Mr le Carré, was halten Sie von Marx und Lenin, bitte?
Gelächter.
Ich: Ich mag sie beide.
Vielleicht nicht meine schlagfertigste Antwort, aber das Publikum applaudiert und johlt fröhlich. Der blasse Professor beendet die Versammlung, ich werde von Studenten umringt und eine Treppe tiefer in eine Art Gemeinschaftsraum gebeten, wo sie mich ausgiebig zu einem Roman von mir befragen, von dem ich sicher weiß, dass er in den letzten fünfundzwanzig Jahren hier verboten gewesen ist. Wo um alles in der Welt haben sie ihn trotzdem lesen können, frage ich.
»In unserem privaten Buchclub, natürlich«, antwortet eine Studentin in gebrochenem Jane-Austen-Englisch und deutet auf einen klotzigen alten PC-Monitor. »Unsere Gruppe hat Text aus verbotenem Buch abgeschrieben, das uns einer von Ihren Landsleuten gegeben hat. Wir haben dieses Buch nachts zusammen gelesen, viele Male. Auf diese Weise haben wir viele verbotene Bücher gelesen.«
»Und was, wenn man Sie erwischt hätte?«, frage ich.
Sie lachen.
Als ich Wolodja, meinem so hilfreichen russischen Reiseführer, und seiner Frau Irena einen Abschiedsbesuch in ihrer winzigen Wohnung abstatte, spiele ich den Weihnachtsmann, obwohl es noch lang hin ist bis Weihnachten. Die beiden begabten Hochschulabsolventen leben am Existenzminimum. Sie haben zwei kluge kleine Töchter. Wolodja bekommt eine Flasche Scotch, Kugelschreiber, eine Seidenkrawatte und andere unerschwingliche Schätze, die ich im Duty-Free-Shop am Flughafen Heathrow erstanden habe; Irena schenke ich Seife, Zahnpasta, Strumpfhosen, Kopftücher, alles Dinge, zu denen mir meine Frau geraten hat. Für die beiden kleinen Mädchen habe ich Schokolade und Schottenröcke. Ihre Dankbarkeit ist mir peinlich. Ich möchte nicht der reiche Onkel sein. Und sie möchten nicht die armen Verwandten sein.
Wenn ich mich heute an die Ereignisse erinnere, die sich alle in diesen zwei kurzen Wochen im Russland des Jahres 1987 abspielten, dann rührt mich noch immer, wie traurig alles war, rühren mich die Bemühungen und der Durchhaltewillen der sogenannten einfachen Leute, die so gar nicht einfach waren, die Erniedrigungen, die sie alle erdulden mussten, ganz gleich, ob sie nun nach dem Notwendigsten in der Schlange anstehen, um sich und ihre Kinder am Leben zu halten, oder ständig die Zunge im Zaum halten mussten, damit ihnen nur ja nichts Folgenschweres über die Lippen kam. Als ich ein paar Tage nach der unerwarteten Landung von Mathias Rust mit einer älteren Schriftstellerin über den Roten Platz ging, machte ich einen Schnappschuss von den Wachen vor dem Leninmausoleum; sie wurde ganz bleich und zischte mich an, ich solle sofort meine Kamera wegstecken.
Was die kollektive russische Seele am meisten fürchtet, ist Chaos, was sie am meisten liebt, ist Stabilität, und wovor sie sich am meisten graust, ist die unvorhersehbare Zukunft. Aber wie kann das auch anders sein bei einer Nation, die zwanzig Millionen Menschen durch Stalins Henker verlor und weitere dreißig Millionen durch Hitlers Henker? Würde für sie alle das Leben nach dem Kommunismus wirklich besser werden als das, was sie gerade hatten? Wenn die Künstler und Intellektuellen Vertrauen gefasst hatten oder einfach mutig genug waren, dann sprachen sie überschwänglich von den Freiheiten, die sie bald erwarten würden – dreimal auf Holz geklopft. Doch zwischen den Zeilen hörte man Zweifel heraus. Welchen Status würden sie in jener neuen, verlockenden Gesellschaft haben? Und wenn sie Parteiprivilegien genossen, wodurch würden diese ersetzt werden? Wenn sie von der Partei anerkannte Schriftsteller waren, wie sah dann ihre Rolle in einem freien Markt aus? Und wenn sie gerade in Ungnade gefallen waren, würde das neue System sie rehabilitieren?
In der Hoffnung, Antworten auf all diese Fragen zu finden, kam ich 1993 erneut nach Russland.
18
Der wilde Osten: Moskau 1993
Die Mauer ist gefallen. Michail Gorbatschow ist nach einer wilden Achterbahnfahrt, bei der er im einen Augenblick Hausarrest auf der Krim absaß und im nächsten wieder die Macht im Kreml übernahm, von seinem langjährigen Parteifeind Boris Jelzin abgelöst worden. Die KPdSU ist verboten, der Moskauer Parteisitz geschlossen. Leningrad heißt wieder Sankt Petersburg, Stalingrad wieder Wolgograd. Das organisierte Verbrechen blüht. Recht herrscht nirgendwo. Die aus dem unseligen sowjetischen Afghanistaneinsatz zurückgekehrten Soldaten, deren Sold aussteht, ziehen durchs Land und suchen Arbeit. Eine Zivilgesellschaft existiert nicht; Boris Jelzin ist entweder nicht gewillt oder nicht in der Lage, sie zu implementieren. All das wusste ich schon, bevor ich im Sommer 1993 nach Moskau aufbrach. Wie ich auf die Idee kam, meinen zwanzigjährigen Sohn, der mitten im Studium steckte, mit auf die Reise zu nehmen, weiß ich heute nicht mehr, aber er war gern mit von der Partie, und gemeinsam schlugen wir uns durch, ohne dass es zu Unstimmigkeiten kam.
Der Zweck meiner Reise war mir klar, zumindest rede ich mir das heute ein. Ich wollte wissen, wie sich die neue Ordnung anfühlte. Waren die jetzigen Gangsterbosse nur die alten in neuen Gewändern? Hatte Jelzin den KGB tatsächlich aufgelöst, oder war er nur, wie schon so oft in der Vergangenheit, unter anderem Namen neu gegründet worden? Wir starteten in Hamburg, wo ich mich wieder mit denselben notwendigen Artikeln eindeckte, die ich 1987 mit in die Sowjetunion genommen hatte: Seife, Shampoo, Zahnpasta, Schokoladenkekse, Scotch, deutsches Spielzeug. Doch schon bei der Ankunft auf Moskaus Flughafen Scheremetjewo, wo man uns mit einem Kopfnicken einreisen ließ, herrschte ein greller Materialismus. Womit ich wohl am wenigsten gerechnet hätte: Für eine Kaution von fünfzig Dollar konnte man sich an einem Kiosk am Ausgang ein Mobiltelefon leihen.
Und was unser Hotel betraf: Vergessen Sie das Minsk. Diesmal war es ein strahlender, marmorverkleideter Palast mit weiten geschwungenen Treppen, mit Kronleuchtern, die groß genug waren, um ein Opernhaus in Licht zu tauchen, und einem Schwarm gepflegter, erkennbar ungebundener Mädchen, die in der Hotelhalle herumscharwenzelten. Unsere Zimmer rochen nach frischer Farbe, Luftreinigern und Rohrleitungen. Ein Blick auf die Schaufenster während der Fahrt durch die Stadt hatte schon alles erklärt: Das berühmte staatseigene Warenhaus GUM war verschwunden und hatte Estée Lauder Platz gemacht.
Diesmal drückt mich mein russischer Verleger nicht an die Brust. Er zieht auch nicht freudestrahlend eine Flasche Wodka aus der Schublade und wirft den Schraubverschluss mit einem Schwung in den Papierkorb. Er beäugt mich durch den Spion in der Stahltür, bevor er eine ganze Reihe von Schlössern öffnet, zerrt mich herein und schließt hinter mir wieder ab. Mit leiser Stimme entschuldigt er sich dafür, dass sonst niemand im Büro ist, um mich willkommen zu heißen. Seit dem Auftauchen der Versicherungsvertreter, sagt er, kommt niemand mehr zur Arbeit.
Versicherungsvertreter?
Männer in Anzügen und mit Aktentaschen. Verkaufen Versicherungen gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden, meist aber Feuer. Seit einer Reihe von Brandanschlägen ist die Gegend hier sehr risikobehaftet. Folglich sind die Versicherungsprämien hoch, das ist ja nur verständlich. Es könnte ja jederzeit ein Feuer ausbrechen. Am besten, Sie unterschreiben sofort, hier ist ein Stift. Sonst könnten gewisse Personen, die wir kennen, eine Brandbombe ins Büro werfen, und was ist dann mit all den alten Akten und Manuskripten, die hier rumliegen?
Und die Polizei?, frage ich.
Die rät einem, zu zahlen und den Mund zu halten. Die stecken doch alle unter einer Decke.
Sie werden also zahlen?
Vielleicht. Mal sehen. Kampflos wird er jedenfalls nicht aufgeben. Er kannte mal eine Reihe einflussreicher Leute. Aber sie sind jetzt nicht mehr einflussreich.
Ich frage einen früheren Freund vom KGB, wie ich einen der oberen Mafia-Bosse treffen kann. Komm Donnerstagnacht um eins in den Nachtclub So und so, Dima erwartet dich. Dein Sohn? Bring ihn mit, er ist willkommen, und wenn er ein Mädchen hat, bring das auch mit. Es ist Dimas Nachtclub, er gehört ihm. Nette Gäste, gute Musik. Sehr sicher. Unser unverzichtbarer Leibwächter ist Pusya, abchasischer Landesmeister im Ringen und Ratgeber in allem, was den Unabhängigkeitskampf seines Volkes angeht. Er ist so untersetzt und stämmig wie das Michelin-Männchen, vielseitig gebildet, Linguist, Gelehrter und paradoxerweise der friedliebendste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ganz abgesehen davon ist er ein Nationalheld, was an sich ja schon eine Art Schutz ist.
Durchtrainierte junge Männer mit Maschinenpistolen stehen im Eingang des Nachtclubs. Unter Pusyas liebevollen Blicken tasten sie uns ab. Die runde Tanzfläche ist von roten Plüschbänken gesäumt. Paare tanzen gesetzt zu Musik der Sixties. Der Clubmanager führt uns zu einer Sitzbank und teilt Pusya mit, Mr Dima komme gleich zu uns. Schon auf der Fahrt mit seinem Auto hierher lieferte uns Pusya ein Beispiel dafür, wie er seine Kräfte zur friedlichen Intervention einsetzt. Die Straße ist blockiert. Ein kleines und ein großes Auto sind sich ins Gehege gekommen. Die Fahrer werden gleich die Fäuste schwingen. Die Gaffer nehmen eifrig Partei. Pusya öffnet die Wagentür und schlendert zu den Streithähnen hinüber, wohl um sie zu trennen oder zu beruhigen, nehme ich an. Doch nein, er packt den Kleinwagen an der hinteren Stoßstange, löst ihn von dem größeren Wagen und stellt ihn unter dem tobenden Applaus der Menge am Straßenrand ab.
Wir trinken unsere Limonade. Mr Dima komme vielleicht etwas später, informiert uns der Manager, er müsse sich vielleicht um Geschäfte kümmern. Geschäfte ist die neue russische Umschreibung für dunkle Machenschaften. Den Geräuschen im Gang nach zu urteilen, nähert sich der hohe Herr. Zur Begrüßung schwillt die Musik an und verstummt dann. Als Erstes betreten zwei kräftige junge Männer mit Bürstenschnitt und engsitzenden, schwarzblauen italienischen Anzügen den Raum. Spetsnas, flüstert mir Pusya ins Ohr. Für die Neureichen Moskaus sind ehemalige Soldaten der Spezialeinheiten erste Wahl als Bodyguards. Mit an Vögel erinnernden, ruckenden Kopfbewegungen kontrollieren die beiden Männer abschnittsweise den Raum. Als sie Pusya entdecken, schauen sie länger hin. Pusya lächelt sie freundlich an. Die beiden Männer treten einen Schritt zurück und bauen sich links und rechts vom Eingang auf. Eine Pause, und wie auf allgemeinen Wunsch: Auftritt Kojak, New York Police Department, alias Dima, gefolgt von einem Schwarm hübscher Mädchen und junger Männer.
Falls Sie die Fernsehserie kennen – die Ähnlichkeit ist geradezu lächerlich, bis hin zur Ray-Ban-Sonnenbrille: glänzender kahler Kopf, sehr breite Schultern, breitbeiniger Gang, Einreiher, die Arme wie ein Affe zur Seite weggestreckt. Glattrasiertes Gesicht mit Knollennase, ein festgefrorenes, leicht spöttisches Grinsen. Im neuen Russland ist Kojak gerade der Hit. Stylt sich Dima bewusst nach ihm? Er wäre nicht der erste Gangsterboss, der glaubt, in seinem eigenen Film die Hauptrolle zu spielen.
Die erste Reihe ist offenbar der Familie vorbehalten. Dima setzt sich in die Mitte. Seine Leute rutschen neben ihn. Rechts ein ungeheuer schönes, juwelenbehängtes Mädchen; links ein pockennarbiger Mann mit ausdruckslosem Gesicht: der consigliere. Der Nachtclubmanager bringt ein Tablett mit Softdrinks. Dima hat dem Alkohol abgeschworen, erklärt Pusya, auch er hat dem Alkohol abgeschworen.
»Mr Dima spricht jetzt mit Ihnen, bitte.«
Pusya bleibt sitzen. Ich bahne mir mit meinem russischen Dolmetscher einen Weg durch die Tanzenden. Dima streckt mir eine Hand hin. Ich schüttle sie; sie ist so weich wie meine Hand. Ich knie mich vor ihn auf die Tanzfläche. Mein Dolmetscher kniet neben mir. Nicht gerade die ideale Position, aber mehr Platz gibt es nicht. Dima und seine Leute betrachten uns über die Balustrade hinweg. Man hatte mich gewarnt, dass Dima nur Russisch spricht. Russisch kann ich nicht.
»Mr Dima sagt, was wünschen Sie?«, brüllt mir mein Dolmetscher ins rechte Ohr. Die Musik ist so laut, dass ich Dima überhaupt nicht gehört habe, aber mein Dolmetscher schon, und das ist das Einzige, was zählt; sein Mund ist nur zehn Zentimeter von meinem Ohr entfernt. Dass wir auf Knien sind, schreit geradezu nach einer mutigen Tat, also sage ich, es wäre schön, wenn die Musik leiser wäre, und ob Dima wohl so freundlich wäre, die Sonnenbrille abzunehmen, weil es recht schwer ist, sich mit einem Gesicht mit verspiegelten Augen zu unterhalten. Dima befiehlt, die Musik leiser zu drehen, dann nimmt er gereizt die Sonnenbrille ab. Und zum Vorschein kommen seine Schweinsäuglein. Er will immer noch wissen, was ich möchte. Das würde ich auch gern wissen wollen, ehrlich gesagt.
»Wenn ich recht verstehe, sind Sie ein Gangster«, sage ich. »Stimmt das?«
Ich weiß nicht, wie mein Dolmetscher die Frage übersetzt, aber ich habe den leisen Verdacht, dass er sie ein wenig abmildert, denn Dima wirkt bemerkenswert unbefangen.
»Mr Dima sagt, in diesem Land ist jeder Gangster. Alles ist verrottet, alle bisnesmen sind Gangster, alle Geschäfte werden von Gangstersyndikaten gemacht.«
»Darf ich ihn dann fragen, in was für Geschäften er gerade tätig ist?«
»Mr Dima ist im Import-Export«, sagt mein Dolmetscher mit flehentlicher Stimme, damit ich mich nur ja nicht noch weiter auf vermintes Gelände vorwage.
Ich weiß nur anders nicht weiter.
»Bitte fragen Sie ihn, welche Art von Import-Export. Fragen Sie ihn.«
»Das ist nicht angemessen.«
»Also gut. Fragen Sie ihn, wie reich er ist. Fünf Millionen Dollar?«
Zögernd stellt mein Dolmetscher diese oder eine ähnliche Frage, denn Dimas Leute kichern, und Dima reagiert mit einem abfälligen Schulterzucken. Macht nichts. Ich weiß jetzt, was ich fragen will.
»Gut. Hundert Millionen, zweihundert Millionen, egal. Klar, dass es heutzutage in Russland verdammt einfach ist, eine Menge Geld zu machen. Und wenn es so bleibt, dann können wir davon ausgehen, dass Dima in ein paar Jahren ein wirklich reicher Mann ist. Stinkreich. Sagen Sie ihm das bitte. Es ist ja nur eine einfache Feststellung.«
Offenbar teilt mein Dolmetscher ihm das mit, denn in Dimas unterer Gesichtshälfte zeigt sich so etwas wie ein zustimmendes Schmunzeln.
»Hat Dima Kinder?«, frage ich waghalsig.
Hat er.
»Enkelkinder?«
»Unwichtig.«
Dima hat sich die Ray-Ban wieder aufgesetzt, wie um zu sagen, dass das Gespräch beendet ist, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin schon viel zu weit vorgeprescht, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen.
»Folgendes. In den Vereinigten Staaten machten die großen Raubritter in den alten Zeiten ihr Vermögen auf, nun sagen wir mal, recht hemdsärmelige Weise, wie Dima sicherlich weiß.«
Hinter der Sonnenbrille flackert ein wenig Interesse auf, wie ich erfreut feststelle.
»Als die Raubritter dann alt wurden und sich um Kinder und Kindeskinder kümmerten, wurden sie richtig idealistisch und beschlossen, sie müssten eine hellere, freundlichere Welt schaffen als jene, die sie geplündert hatten.«
Die schwarzen Sonnenbrillenaugen schauen mich weiter an, während der Dolmetscher irgendetwas weitergibt.
»Meine Frage an Dima lautet also, kann er sich vorstellen, dass, wenn er älter ist – sagen wir in zehn, fünfzehn Jahren –, es dann an der Zeit ist, Krankenhäuser und Schulen und Kunstmuseen zu bauen? Als gute Tat? Das meine ich ernst. Fragen Sie ihn. Dem russischen Volk auf diese Weise zurückzugeben, was er – nun ja – gestohlen hat, um ehrlich zu sein?«
In alten Schwarzweißkomödien gibt es einen abgedroschenen Witz, wie zwei Personen sich mit Hilfe eines Dolmetschers unterhalten. Der eine stellte eine Frage. Die Frage wird übersetzt. Der Befragte hört aufmerksam zu, fuchtelt dann mit den Armen und redet zwei kostbare Filmminuten lang; der Dolmetscher übersetzt nach kurzer dramatischer Pause: »Nein.« Oder »ja«. Oder »vielleicht«. Dima fuchtelt nicht mit den Armen. Er spricht bedächtig. Sein Fanclub kichert. Die Wachen an der Tür kichern. Dima spricht weiter. Als er schließlich fertig ist, legt er die Hände zusammen und wartet darauf, dass der Dolmetscher seine Botschaft übermittelt.
»Mr David, tut mir leid, aber Mr Dima sagt, Sie sollen verduften.«
Wir sitzen unter dem Kristalllüster in der Lobby unseres glamourösen Hotels in Moskau; ein schlanker, schüchterner Mann, dreißig, grauer Anzug, Brille, nippt an seinem Orange Fizz und erklärt mir den Verhaltenskodex der »Diebe im Gesetz«, der Vory w zakone, zu denen er gehört. Er soll einer von Dimas Söldnern sein. Vielleicht gehört er zu jenen Anzugträgern, die meinem Verleger eine Feuerversicherung verkaufen wollen. Er wählt die Worte so sorgfältig, dass er an den Sprecher eines Außenministeriums denken lässt.
»Haben sich die Vory seit dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus verändert?«
»Die Vory sind mehr geworden, würde ich sagen. Dank der größeren Bewegungsfreiheit im Postkommunismus und dank der besseren Kommunikationsmittel könnte man sagen, dass die Vory ihren Einfluss auf viele Länder ausgedehnt haben.«
»Und um welche Länder handelt es sich da speziell?«
Man solle wohl besser von Städten sprechen, nicht Ländern, meint er. Warschau, Madrid, Berlin, Rom, London, Neapel, New York, all das sind beliebte Orte für Vory-Aktivitäten.
»Und hier in Russland?«
»Ich würde sagen, das gesellschaftliche Chaos hat viele Vory-Aktivitäten in Russland begünstigt.«
»Als da wären?«
»Bitte?«
»Welche Aktivitäten?«
»Drogen sind hier in Russland profitabel, würde ich sagen. Auch viele neue Unternehmen gehen nicht ohne Erpressung. Außerdem haben wir noch Spielkasinos und viele Clubs.«
»Bordelle?«
»Bordelle sind für die Vory nicht notwendig. Es ist besser, die Frauen gehören uns und wir organisieren Hotels für sie. Manchmal gehören uns auch die Hotels.«
»Ist ethnische Zugehörigkeit ein Kriterium?«
»Wie bitte?«
»Rekrutieren sich die Diebesbruderschaften aus bestimmten Regionen?«
»Ich würde sagen, dass wir heute viele Diebe haben, die keine Russen sind.«
»Sondern?«
»Abchasen, Armenier, Slawen. Auch Juden.«
»Tschetschenen?«
»Bei den Tschetschenen ist das etwas anderes, würde ich sagen.«
»Gibt es bei den Vory Rassendiskriminierung?«
»Wenn ein Vor ein guter Dieb ist und sich an die Regeln hält, sind alle Vory gleich.«
»Gibt es viele Regeln?«
»Es gibt nur wenige Regeln, aber die sind streng.«
»Geben Sie mir doch bitte ein Beispiel für Ihre Regeln.«
Das macht er gern. Ein Dieb darf nicht für die Obrigkeit arbeiten. Der Staat, das ist die Obrigkeit, also darf er nicht für den Staat arbeiten oder kämpfen oder ihm irgendwie dienen. Er darf keine Steuern zahlen.
»Glauben die Diebe an Gott?«
»Ja.«
»Kann ein Vor in die Politik gehen?«
»Wenn er vorhat, den Einfluss der Bruderschaft auszudehnen und nicht der Obrigkeit zu dienen, kann er in die Politik gehen.«
»Und wenn er ein bekannter, populärer Politiker wird und erfolgreich ist? Kann er im Herzen ein Vor bleiben?«
»Möglich ist es.«
»Tötet ein Vor den anderen, wenn er gegen die Regeln verstößt?«
»Wenn es vom Rat befohlen wird.«
»Sie würden Ihren besten Freund töten?«
»Falls nötig.«
»Haben Sie persönlich schon viele Menschen getötet?«
»Schon möglich.«
»Haben Sie je daran gedacht, Anwalt zu werden?«
»Nein.«
»Kann ein Vor heiraten?«
»Er muss als Mann über den Frauen stehen. Er kann viele Frauen haben, aber er darf sich ihnen nicht unterwerfen, denn sie sind nicht wichtig.«
»Also lieber nicht heiraten?«
»Die Regel sagt, dass ein Vor nicht heiraten soll.«
»Aber manche tun es trotzdem?«
»Es ist eine Regel.«
»Darf ein Vor Kinder haben?«
»Nein.«
»Aber manche haben welche?«
»Das gibt es, würde ich sagen. Es ist nicht erwünscht. Es ist besser, den anderen Vory zu helfen und dem Rat zu gehorchen.«
»Und was ist mit den Müttern und Vätern der Vory? Sind die akzeptiert?«
»Eltern sind nicht erwünscht. Man verlässt sie besser.«
»Weil sie Obrigkeit sind?«
»Es ist nicht erlaubt, Gefühle zu zeigen, wenn man innerhalb der Gesetze der Diebe bleiben will.«
»Aber manche Vory lieben ihre Mütter?«
»Schon möglich.«
»Haben Sie Ihre Eltern verlassen?«
»Ein Stück weit. Nicht genug, vielleicht.«
»Haben Sie sich jemals in eine Frau verliebt?«
»Das gehört sich nicht.«
»Gehört sich nicht, eine solche Frage zu stellen, oder sich zu verlieben?«
»Es gehört sich nicht«, wiederholt er.
Doch er ist rot geworden und lacht wie ein Schuljunge, und mein Dolmetscher lacht auch. Dann lachen wir alle drei. Als bescheidener Dostojewski-Leser frage ich mich, wo denn in der zeitgenössischen kriminellen russischen Seele Moral, Stolz und Menschlichkeit zu finden sind; ich denke da an eine meiner Figuren, die das wissen muss.
Eigentlich sogar mehrere Figuren, wie sich herausstellt. Sie tauchen in den beiden Romanen auf, die ich schließlich über das neue Russland in der frühen postkommunistischen Zeit geschrieben habe, Unser Spiel und Single & Single. Diese beiden Romane, deren Handlung ziemlich offen blieb, führten mich nach Russland, Georgien und in den westlichen Kaukasus. In beiden habe ich versucht, das Ausmaß krimineller Korruption in Russland und die ständigen Kriege gegen die eigenen Muslime im Süden zu beschreiben. Ein Jahrzehnt später schrieb ich mit Verräter wie wir einen dritten Roman über den wohl nach Energie größten Exportschlager Russlands zu jener Zeit: schmutziges, aus Russlands Kassen gestohlenes Geld in Milliardenhöhe.
Pusya, der abchasische Ringer-Champion, war immer da, kam uns aber nie zu nah. Und nur ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, wir müssten seine eher körperlichen Dienste in Anspruch nehmen.
Diesmal liegt der Nachtclub in Sankt Petersburg. Wie in Dimas Fall, gehört auch dieses Etablissement einem aufstrebenden bisnesman namens Karl; Ilja, sein Anwalt, weicht ihm selten von der Seite. Wir sind in einem gepanzerten Kleinbus hergebracht worden, mit einem ebenfalls gepanzerten Land Rover als Begleitfahrzeug. Am Eingang, der am Ende eines gepflasterten, mit Papierlaternen geschmückten Fußwegs liegt, begegnen wir wieder dem üblichen Aufgebot bewaffneter Männer. Sie sind nicht nur mit Maschinenpistolen, sondern auch mit polierten Handgranaten ausgerüstet, die an ihren Waffengurten baumeln. Im Club tanzen die Mädchen des Hauses träge miteinander zu ohrenbetäubender Rockmusik und warten auf Kundschaft.
Doch es gibt keine Kundschaft, dabei ist es bereits halb zwölf.
»Sankt Petersburg erwacht erst spät zum Leben«, erklärt Karl, lächelt wissend und führt uns an einen langen Esstisch, der uns zu Ehren zwischen den Plüschbänken aufgestellt worden ist. Karl hat eine Hakennase, er wirkt steif, ein junger Mann mit altmodischem Benehmen. Der schwerfällige Ilja neben ihm wirkt zu grobschlächtig. Iljas blonde Gattin trägt selbst jetzt, mitten im Sommer, einen Zobel. Wir werden zur obersten Reihe steil ansteigender Sitze geführt. Die Tanzfläche unter uns nutzen wir auch als Boxring, erklärt Ilja stolz, allerdings nicht heute Nacht. Pusya sitzt links, mein Sohn Nick rechts von mir. Ilja, der neben seinem Herrn Platz genommen hat, murmelt in sein Handy und führt ungerührt ein Telefonat nach dem anderen.
Noch immer keine Kundschaft. Angesichts der leeren Bänke ringsherum, der lärmenden Rockmusik und der gelangweilten Mädchen, die sich pflichtschuldig auf der Tanzfläche drehen, wird der Small Talk an unserem Tisch immer mühseliger. Es liegt am Straßenverkehr, erklärt Karl über Iljas massige Gestalt hinweg. Das kommt vom neuen Reichtum. Jetzt, wo heutzutage jeder ein Auto besitzt, ist der Feierabendverkehr in Sankt Petersburg ein Skandal.
Eine weitere Stunde vergeht.
Es ist Donnerstag, erklärt Karl. Donnerstags geht die Petersburger Schickeria erst auf Partys und dann in die Nachtclubs. Ich glaube Karl kein Wort, Pusya wohl auch nicht, und wir wechseln besorgte Blicke. Mir gehen zu viele Schreckensszenarien durch den Kopf, Pusya wohl auch. Weiß die Petersburger Schickeria etwas, das wir nicht wissen? Hat sich Karl mit einem Konkurrenten angelegt, und sitzen wir nur hier und warten darauf, in die Luft gejagt oder von Schüssen durchsiebt zu werden? Oder sind wir – ich habe diese an Messingringen baumelnden Handgranaten vor Augen – schon Geiseln und Ilja führt bereits murmelnd Verhandlungen auf dem Handy?
Pusya legt einen Finger auf die Lippen, geht zur Herrentoilette und verschwindet im Dunkeln. Ein paar Minuten später kommt er zurück, noch freundlicher lächelnd als sonst. Unser Gastgeber Karl hat am falschen Ende gespart, erklärt er mir leise im Lärm der Musik. Die Leibwächter mit den Handgranaten an den Gurten sind Tschetschenen. Der Sankt Petersburger Gesellschaft geht der Einsatz von tschetschenischen Leibwächtern doch ein wenig zu weit. Niemand, der in Sankt Petersburg etwas auf sich hält, so Pusya, möchte in einem Nachtclub gesehen werden, der von Tschetschenen bewacht wird.
Und Dima? Es ging noch etwa ein Jahr gut, doch dann wurde er, was für die Zeit recht ungewöhnlich war, von der Moskauer Polizei zur Rechenschaft gezogen, entweder auf Befehl eines seiner Konkurrenten oder – falls er seine Schutzgelder nicht gezahlt hatte – des Kreml. Als man zuletzt von ihm hörte, saß er im Gefängnis und versuchte zu erklären, warum man in seinem Keller, an eine Wand angekettet, zwei übel zugerichtete Kollegen bisnesmen gefunden hatte. In meinem Roman Verräter wie wir habe ich meinen eigenen Dima, wenn auch nur dem Namen nach. Mein Dima war ein hartgesottener Gangster und hätte vielleicht, anders als sein Vorbild, wirklich Geld für eine Schule, ein Krankenhaus oder ein Kunstmuseum springenlassen.
19
Blut und Gold
Im Laufe der Jahre habe ich eine zugegebenermaßen recht kindische Aversion dagegen entwickelt, irgendetwas über mich in der Presse zu lesen, sei es nun Lob oder Verriss. Ab und zu aber schlüpft etwas durch meine Abwehr, so geschehen eines Morgens im Oktober 1991, als ich die Times aufschlug und mich mein eigenes mürrisches Gesicht anstarrte. Mein sauertöpfischer Ausdruck verriet mir sofort, dass der dazugehörige Text nicht sonderlich freundlich sein konnte. Die Fotoredaktion kennt sich mit so etwas aus. Ein um seine Existenz kämpfendes Theater in Warschau, las ich, feierte seine postkommunistische Freiheit mit der Inszenierung von Der Spion, der aus der Kälte kam. Doch der habgierige John le Carré (siehe Foto) verlangte satte hundertfünfzig Pfund pro Aufführung: »Das ist wohl der Preis der Freiheit.«
Ich schaute mir noch einmal das Foto an und sah dort genau diese Art von Typen, der herumschleicht und sich mühsam über Wasser haltende polnische Theater ausraubt. Habgierig. Widerwärtig. Achte doch nur mal auf diese Augenbrauen. Die gute Laune war mir gründlich vergangen.
Nur ruhig, ruf deinen Agenten an. Nach einer Weile habe ich ihn in der Leitung. Mit zittriger Stimme, wie ein Schriftsteller sie wohl beschreiben würde, lese ich ihm den Artikel vor und deute vorsichtig an, dass er womöglich in diesem Falle, dieses eine Mal, eine Spur zu weit gegangen sei?
Rainer versteht meine Befindlichkeit. Ganz im Gegenteil, versichert er mir. Da Polen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erst noch auf die Beine kommen muss, hatte er sich wie ein komplettes Weichei gegeben. Und um das zu beweisen, liest er mir die Bedingungen vor, die er mit dem polnischen Theater ausgehandelt hat. Wir verlangen keine hundertfünfzig Pfund pro Aufführung, beteuert er, sondern gerade mal magere sechsundzwanzig Pfund, das absolute Minimum, ob ich das nicht mehr wüsste? Ehrlich gestanden, nein. Außerdem haben wir ihnen die Aufführungsrechte kostenlos überlassen. Kurz gesagt, ein Freundschaftsdienst, David, eine wohlüberlegte helfende Hand in schwierigen Zeiten. Prima, sage ich verwirrt und schnaube innerlich vor Wut.
Nur ruhig, schick doch dem Herausgeber der Times ein Fax. Er ist jemand, dessen Leben und Arbeit ich mittlerweile sehr bewundere; 1991 wusste ich allerdings noch nicht allzu viel über seine Stärken. Seine Reaktion wirkt nicht gerade besänftigend, sondern zeugt vielmehr von Großspurigkeit, um nicht zu sagen, dass sie mich äußerst verärgert. Er findet nicht, dass der Artikel viel Schaden anrichtet, und empfiehlt mir, als einem Mann in meiner glücklichen Position, die Dinge doch einfach hinzunehmen. Doch das ist kein Rat, dem ich zu folgen geneigt bin. Und an wen soll ich mich nun wenden?
Aber natürlich: an den Mann, dem die Zeitung gehört, an meinen alten Freund Rupert Murdoch!
Na ja, alter Freund ist vielleicht etwas übertrieben. Ich war Murdoch ein paarmal bei gesellschaftlichen Anlässen begegnet, aber ich bezweifelte, dass er sich daran erinnern würde. Das erste Mal Mitte der 80er im Restaurant Boulestin’s, wo ich gerade mit meinem damaligen Literaturagenten zu Mittag aß, als Murdoch hereinspaziert kam. Mein Agent machte uns miteinander bekannt, und Murdoch schloss sich uns auf einen trockenen Martini an. Wir sind im selben Alter. Sein bis aufs Messer geführter Kampf gegen die Druckergewerkschaften der Fleet Street war damals in vollem Gange. Wir tauschten uns ein wenig darüber aus, und dann fragte ich ihn beiläufig – vielleicht sprach auch der Martini aus mir –, warum er denn mit der alten Tradition brechen würde. In früheren Zeiten, meinte ich leichthin, hätte man sich als armer Brite nach Australien aufgemacht, um dort das Glück zu suchen. Nun war in diesem Fall ein Australier, der nun wahrhaft nicht arm war, nach Großbritannien gekommen, um hier sein Glück zu versuchen. Was war also schiefgelaufen? Eine gelinde gesagt dämliche Frage, doch Murdoch sprang sofort darauf an.
»Das sage ich Ihnen«, gab er zurück. »Weil ihr Briten von hier ab aufwärts verholzt seid!«
Und begleitend fuhr er sich mit einer schneidenden Handbewegung über die Kehle, um anzudeuten, wo das Holz begann.
Unsere zweite Begegnung fand in einem privaten Rahmen statt; ganz offen hatte Murdoch die Runde an seinen negativen Ansichten zum Zerfall der Sowjetunion teilhaben lassen. Am Ende des Abends war er so frei, mir seine Visitenkarte zu geben: Telefon, Fax, Privatanschrift. Wann immer Sie wollen, das Telefon steht auf meinem Schreibtisch.
Also nur ruhig, schick doch Murdoch ein Fax. Darin stelle ich drei Forderungen: erstens, eine umfassende Gegendarstellung an prominenter Stelle in der Times; zweitens, eine großzügige Spende an das ums Überleben ringende polnische Theater. Und drittens – sprach da noch immer der Martini aus mir? –, Lunch. Am folgenden Morgen lag seine Antwort auf dem Fußboden vor dem Faxgerät:
»Bedingungen angenommen. Rupert.«
In jenen Tagen verfügte der Savoy Grill über eine Art Obergeschoss für die Auserwählten, mit hufeisenförmigen Sitzgelegenheiten in rotem Plüsch, wo in schillernderen Zeiten reiche Herren wohl ihre Ladys unterhielten. Ich flüstere dem Maître d’hôtel den Namen Murdoch zu und werde in eins der Separées geführt. Ich bin früh dran. Murdoch kommt pünktlich auf die Minute.
Er ist kleiner, als ich ihn in Erinnerung habe, aber angriffslustiger, und er hat sich den eiligen Gang und die Hüfthaltung angewöhnt, mit der sich große Geschäftsmänner vor der Kamera einander nähern und die Hand ausstrecken. Er hält den Kopf schräger als in meiner Erinnerung, und während er die Augen zusammenkneift und mir ein strahlendes Lächeln schenkt, beschleicht mich das komische Gefühl, er könnte mich aufs Korn nehmen.
Wir setzen uns und schauen uns gegenseitig an. Mir fällt die unübersehbare, verwirrende Vielzahl von Ringen an seiner linken Hand ins Auge. Wir geben unsere Bestellungen auf und tauschen ein paar banale Höflichkeiten aus. Es täte ihm sehr leid, was da über mich geschrieben worden sei, sagt Rupert. Briten, sagt er, seien große Schönschreiber, aber sie lägen nicht immer richtig. Schon in Ordnung, entgegne ich und danke für seine faire Einschätzung. Doch genug des Small Talks. Rupert schaut mich unverwandt an; das strahlende Lächeln ist verschwunden.
»Wer hat Bob Maxwell umgebracht?«, will er wissen.
Für all jene, die sich nicht mehr an Robert Maxwell erinnern: Maxwell war ein in der Tschechoslowakei geborener britischer Medienzar, Parlamentsabgeordneter und angeblicher Spion für so unterschiedliche Länder wie Israel, die Sowjetunion und Großbritannien. Als junger tschechischer Freiheitskämpfer hatte er an der Landung in der Normandie teilgenommen, war später Offizier in der britischen Armee geworden und hatte eine Tapferkeitsmedaille erhalten. Nach dem Krieg arbeitete er für das britische Außenministerium in Berlin. Aber er war auch ein durchtriebener Lügner und gewaltiger gieriger Gauner, der den Rentenkassen seiner eigenen Firmen die ordentliche Summe von 440 Millionen Pfund entnahm und etwa vier Milliarden Pfund Schulden hatte, die er niemals zurückzahlen konnte. Im November 1991 fand man ihn tot im Meer vor Teneriffa; offenbar war er von Bord einer nach seiner Tochter benannten Nobelyacht gestürzt.
Verschwörungstheorien dazu gab es zuhauf. Für manche war es der offenkundige Selbstmord eines im Netz seiner eigenen Verbrechen gefangenen Mannes; andere wiederum glaubten an Mord durch einen der Geheimdienste, für die er angeblich gearbeitet hatte. Aber welcher? Wie Murdoch zu der Annahme kommt, ich könnte die Antwort auf diese Frage wissen, ist mir völlig unklar, aber ich gebe mein Bestes, um seine Neugier zu befriedigen. Nun, Rupert, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass es sich nicht um Selbstmord handelt, dann würde ich auf die Israelis tippen, sage ich.
»Warum?«
Die kursierenden Gerüchte waren auch bis zu mir vorgedrungen. Ich gebe sie nur wieder: Maxwell, langjähriger Agent des israelischen Geheimdienstes, erpresst seine früheren Zahlmeister; er hatte mit dem Leuchtenden Pfad in Peru Geschäfte gemacht und israelische Waffen für strategisch wichtiges Kobalt angeboten; dann drohte er, mit dem Deal an die Öffentlichkeit zu gehen, sollten die Israelis nicht zahlen.
Doch Rupert Murdoch ist bereits aufgesprungen, schüttelt mir die Hand und verkündet, wie toll es doch gewesen sei, mich wiederzusehen. Vielleicht ist ihm das Ganze so peinlich wie mir, vielleicht fühlt er sich einfach nur gelangweilt, denn schon stürmt er zur Tür hinaus, ohne zu zahlen; für so etwas haben große Männer ihre Leute. Geschätzte Dauer des Mittagessens: fünfundzwanzig Minuten.
Heute wäre es mir lieber, der Lunch hätte ein paar Monate später stattgefunden, denn dann hätte ich ihm eine viel interessantere Theorie dazu vorlegen können, warum Bob Maxwell sterben musste.
Ich sitze in London, schreibe über das neue Russland und möchte mich mit Glücksrittern aus dem Westen treffen, die den Verlockungen des Goldrauschs gefolgt sind. Jemand hat mir gesagt, Barry sei genau der Mann, nach dem ich suche, und dieser Jemand hat recht. Früher oder später tut sich immer ein Barry auf, und wenn man ihn gefunden hat, dann sollte man sich am besten an ihn hängen wie eine Klette. Freund A stellt einem Freund B vor. Freund B meint, es täte ihm leid, aber er könne nicht weiterhelfen, aber vielleicht kann das sein Freund C. C kann leider auch nicht, aber zufällig ist D in der Stadt, man könne ja den guten alten D anrufen und sagen, man sei ein Kumpel von C, hier ist Ds Telefonnummer. Und plötzlich sitzt man mit dem richtigen Mann in einem Zimmer.
Barry ist ein geborener East Ender, und er hat es weit gebracht im West End: Er kennt keine Klassenschranken, hat eine schnelle Zunge, findet es interessant, mal einen Schriftsteller kennenzulernen, liest aber nur, wenn er muss, genießt den Ruf, im Handumdrehen mühelos Reichtümer anzuhäufen, ist tatsächlich mehr als nur rein theoretisch daran interessiert, in der sich auflösenden Sowjetunion ein dickes Geschäft zu machen. Das sei der Grund, erklärt er mir, warum Bob Maxwell eines Tages bei ihm angerufen und auf die ihm eigene Art mitgeteilt habe, er solle auf der Stelle seinen Hintern in sein, Bobs, Büro schwingen und ihm verraten, wie er, Bob, im Laufe einer Woche ein russisches Vermögen machen könne, sonst käme er, Bob, ziemlich in die Bredouille.
Und tatsächlich, Barry hat heute Zeit für einen Lunch mit mir, Hallo, Julia, streichen Sie meine Nachmittagstermine, Schätzchen, David und ich springen mal rüber zum Silver Grill, rufen Sie doch bitte Martha an und sagen Sie ihr, ein hübsches ruhiges Eck für zwei.
Sie müssen sich vor Augen halten, David, sagt Barry streng, erst im Taxi, dann später bei dem Steak, das exakt so ist, wie er es mag, wann genau mich Bob Maxwell anruft. Im Juli 1991, also vier Monate bevor man seine Leiche im Meer findet. Kapiert? Denn wenn nicht, dann verstehen Sie den Sinn der ganzen Geschichte nicht. Also gut. Ich fang dann mal an.
»Ich habe Michail Gorbatschow praktisch in der Hand«, verkündet Robert Maxwell, kaum dass Barry und er in Maxwells pompösem Penthousebüro Platz genommen haben. »Ich möchte, dass Sie die Yacht nehmen, Barry« – ebenjene Lady Ghislaine, von der Maxwell später in den Tod stürzen sollte, falls er nicht schon vorher tot war –, »sich darauf maximal drei Tage lang zurückziehen und mir dann mit einem vernünftigen Vorschlag kommen. Und jetzt verduften Sie.«
Natürlich ist auch ein nettes Handgeld für Barry drin – sonst hätte er sich ja wohl nicht bei Maxwell eingefunden, oder? –, ein Anerkennungsbetrag vorab für seine Mühen und am Ende Prozente vom Ganzen. Aber Barry nimmt nicht die Yacht, Yachten sind nicht so sein Ding, er hat da ein Fleckchen weit draußen auf dem Land, wo er ganz gern hingeht, um mal in Ruhe nachzudenken, und bereits vierundzwanzig Stunden später, nicht drei Tage, wie Bob gesagt hat, taucht er mit seinem Vorschlag wieder im Penthouse auf. Mit drei Vorschlägen, um genau zu sein, David. Alles todsichere Nummern, alle würden sie garantiert satte Summen einspielen, wenn auch vielleicht nicht im gleichen Umfang.
Erstens, Bob, erklärt Barry Maxwell, ist da das Öl, aber das ist ja klar. Wenn Gorbi Ihnen eine von den staatlichen Konzessionen zuschiebt, die in Kürze im Kaukasus zum Verkauf anstehen, dann könnten Sie die an die großen Jungs im Ölgeschäft versteigern oder die Quellen verpachten. So oder so ist da eine Riesensumme drin, Bob –
Und die Kehrseite?, unterbricht ihn Maxwell. Was ist der verfluchte Haken daran?
Der Haken, Bob, ist die Zeit, und das ist ja Ihr Problem, wie Sie sagen. Ein derart großes Ölgeschäft zieht man nicht über Nacht durch, nicht mal, wenn Ihr Kumpel im Kreml die Fäden in der Hand hat, Sie werden also nicht sofort etwas zu versteigern haben –
Kein beschissenes Interesse. Nächster Vorschlag?
Mein nächster Vorschlag, Bob, ist Schrott. Und damit meine ich nicht, dass Sie mit der Schubkarre durch die Gassen tingeln, zu den Fenstern hochrufen und um Altmetall betteln sollen. Ich rede hier von der allerbesten Topqualität, die jemals hergestellt wurde, Berge davon, am laufenden Band produziert von einer durchgeknallten Staatswirtschaft: abgestellte rostige Panzer, Waffen, marode Fabriken, nutzlose Kraftwerke, und von dem, was all die Fünf-Jahres-Pläne, Sieben-Jahres-Pläne und überhaupt gar keine Pläne sonst noch an Schrott hinterlassen haben. Auf dem Weltmarkt, Bob, ist das unbezahlbares Rohmaterial, das nur auf jemanden wie Sie wartet. Niemand ist sonderlich erpicht darauf, es zu besitzen, nur Sie. Sie tun Russland einen Gefallen damit, wenn Sie den Krempel aufräumen. Ein hübscher Brief von unserem Freund im Kreml, der sich für Ihre Mühe bedankt, ein paar Telefonate mit den Leuten, die ich im Metallgeschäft kenne, und schon ist alles in trockenen Tüchern.
Aber?
Die Kehrseite, Bob? Das sind die Vorlaufkosten, um das Zeug zusammenzukarren. Dann noch die ganze Aufmerksamkeit, die Sie auf sich ziehen werden, und das zu einem Zeitpunkt im Leben, da eh schon alle Blicke auf Ihnen ruhen, um es mal so zu sagen. Denn früher oder später wird jemand da drüben fragen, warum Bob Maxwell saubermacht und nicht irgendein netter Russe.
Also fragt Maxwell ungeduldig nach Barrys drittem Vorschlag. Und Barry antwortet: Blut, Bob.
»Blut, Bob«, erklärt Barry Robert Maxwell, »ist auf der ganzen Welt ein wertvolles Gut. Und ist das russische Blut erst mal ordentlich aufbereitet, ist das eine wahre Goldgrube. Der Russe ist Patriot. Wenn der Russe im Radio hört oder im Fernsehen sieht oder in der Zeitung liest, dass es eine nationale Tragödie gegeben hat, ob nun ein kleiner Krieg irgendwo, ein Eisenbahnunglück, ein Flugzeugabsturz, ein Erdbeben, dass eine Gasleitung hochgegangen ist oder ein Terrorist einen Marktplatz in die Luft gesprengt hat, dann sitzt er nicht einfach auf seinem Hintern, sondern begibt sich schnurstracks zum nächsten Krankenhaus und spendet Blut. Er spendet es, Bob. Für lau. Ganz der brave Bürger. Abermillionen Liter. Sie bilden eine Schlange, warten friedlich, bis sie an der Reihe sind, das sind sie ja gewohnt, und spenden ihr Blut. Dazu bewegt sie reine russische Herzensgüte. Für lau.«
Barry hält inne, falls ich eine Frage habe, aber mir fällt keine ein, vielleicht weil mich das unbehagliche Gefühl beschleicht, dass er diese Idee nicht Robert Maxwell schmackhaft machen will, sondern mir.
»Wenn man also von dieser unbegrenzten Menge an russischem Blut ausgeht, die nichts kostet«, fährt Barry fort und wendet sich der Frage der Logistik zu, »was braucht man dann noch? Wir reden von Russland, also ist das erste Problem die Organisation. Einen Blutspendedienst gibt es schon, der muss nur auf den neuesten Stand gebracht werden. Dann geht es um den Transport. Kühlmöglichkeiten findet man in allen russischen Städten, da müssen nur die Kapazitäten ausgebaut werden. Größere und bessere Lagerhaltung. Und wer bezahlt das? Der sowjetische Staat oder das, was davon übrig ist. Aus reiner Herzensgüte modernisiert der Staat den nationalen Blutspendedienst, wird aber auch Zeit, dann kann sich Gorbi selbst auf die Schulter klopfen. Der Finanzminister stellt die Gelder zentral dafür bereit, und jede Republik schickt als Ausgleich für die Zahlungen einen gewissen Prozentsatz an Blutkonserven zu einer zentralen Blutbank – in Moskau, in Flughafennähe. Und was macht die zentrale Blutbank in Moskau offiziell mit dem Blut? Sie verwahrt es im Hinblick auf nicht näher beschriebene Großnotfälle. Und was machen Sie damit? Sie verfügen über eine Flotte von Kühltransportmaschinen, die regelmäßig zwischen Scheremetjewo und JFK hin- und herfliegen. Die Maschinen brauchen Sie nicht zu kaufen. Die leasen Sie über mich. Sie schaffen das Blut nach New York, lassen es an Bord auf HIV untersuchen; auch dafür habe ich die richtigen Leute an der Hand. Haben Sie eine Ahnung, was man auf dem Weltmarkt für einen Liter HIV-getestetes Blut bezahlt? Das sage ich Ihnen …«
Und die Kehrseite, Barry? Diesmal stelle ich die Frage, nicht Maxwell, und Barry schüttelt bereits den Kopf.
»Keine Kehrseite, David. Das mit dem Blut wäre wie am Schnürchen gelaufen. Ich wäre sehr überrascht, wenn in diesem Augenblick nicht jemand anderer das Geschäft macht.«
Und warum war nicht Bob derjenige?
Das hat mit dem Datum zu tun, David. Barry kommt wieder auf das ach so wichtige Datum zu sprechen, auf das er mich schon vor Beginn seiner Geschichte hingewiesen hat.
»Sommer 1991, Sie erinnern sich? Gorbi hält sich mit letzter Kraft an der Macht. Die Partei zerbricht, Jelzin hat es auf seinen Kopf abgesehen. Im Herbst werden die Republiken nach Unabhängigkeit verlangen, da denkt niemand mehr daran, Blut nach Moskau zu schicken. Höchstwahrscheinlich sehen die Republiken die Zeit für gekommen, dass Moskau ihnen zur Abwechslung mal was schickt.«
Und Ihr Freund Bob?, frage ich.
»Bob Maxwell war nicht blind und nicht blöd, David. Als ihm klar war, dass Gorbi fällig war, da erkannte er, die Sache mit dem Blut war vom Tisch und damit auch seine letzte Chance. Wenn er noch einen Monat durchgehalten hätte, dann hätte er erlebt, wie die Sowjetunion endgültig untergeht und mit ihr Käpt’n Gorbi. Bob wusste, das Spiel war aus, also hat er nicht mehr lange gefackelt, richtig?«
In meinem Roman verwendete ich Barrys Idee vom russischen Blutgeschäft, aber es kam nicht ganz so eindringlich rüber, vielleicht, weil niemand deswegen Selbstmord beging.
Es gibt noch einen Nachtrag zu dem Fünfundzwanzig-Minuten-Lunch mit Rupert Murdoch im Savoy Grill. Einer von Murdochs ehemaligen Referenten, der über den Auftritt seines früheren Arbeitgebers vor dem Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments schrieb (es ging um den Abhörskandal einer seiner Zeitungen), berichtete, dass Murdochs Berater ihn gedrängt hatten, die Goldringe an den Fingern seiner linken Hand abzulegen, bevor er die Zuhörer im Ausschuss mit belegter Stimme darüber in Kenntnis setzte, dass dies der demütigendste Tag seines Lebens sei.
20
Die größten Bären im Garten
Ich habe in meinem Leben zwei ehemalige Vorsitzende des KGB kennengelernt, und ich fand beide sympathisch. Der letzte, der den Posten innehatte, bevor der KGB zwar seinen Namen, aber nicht sein Aufgabenprofil änderte, war Wadim Bakatin. Mit Geheimdiensten, so hat es mal ein kluger Mensch formuliert, verhält es sich wie mit der Elektroinstallation in einem Haus: Ein neuer Besitzer zieht ein, betätigt einen Schalter, und schon brennen dieselben alten Lichter wieder.
1993. Wadim Bakatin, ehemaliger Vorsitzender des aufgelösten KGB, kritzelt zerbrochene Pfeile auf seinen Schmierblock. Sie haben säuberlich gefiederte Enden und schmale Schäfte. Doch in der Mitte sind sie im rechten Winkel abgeknickt und werden so zu Bumerangs, und jede Spitze zeigt in eine andere Richtung. Bakatin sitzt aufrecht, mit durchgedrücktem Rücken und eingezogenem Kopf, wie bei einer zeremoniellen Musterung, an dem langen Tisch im Konferenzraum meines russischen Verlegers. Reforma Fund steht auf der englischen Seite seiner schlecht gedruckten Visitenkarte. Internationaler Fonds für soziale und wirtschaftliche Reformen.
Bakatin ist ein wuchtiger, nordisch wirkender Typ mit roten Haaren, einem traurigen Lächeln und gefleckten, kräftigen Händen. Geboren und aufgewachsen in Nowosibirsk, ausgebildeter Ingenieur, ehemaliger Direktor im staatlichen Bauwesen, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU, ehemaliger Innenminister. 1991 dann überreichte ihm Gorbatschow, zu seiner Überraschung und nicht gerade uneingeschränkten Freude, den vergifteten Becher: Er solle den KGB übernehmen und dort aufräumen. Wie ich da sitze und ihm zuhöre, kann ich mir gut vorstellen, warum Gorbatschow ihm diesen Job angeboten hat: weil Bakatin so offensichtlich anständig ist, auf die tief sitzende, eiserne Art, die sich in den langen Pausen zeigt, wenn er eine Frage sorgsam abwägt, bevor er eine ebenso sorgsam abgewogene Antwort gibt.
»Meine Empfehlungen waren beim KGB nicht sehr beliebt«, merkt er an und zeichnet einen weiteren Pfeil. Dann fügt er hinzu: »Das war keine leichte Aufgabe.«
Nein, es kann keine leichte Aufgabe gewesen sein, einfach eines Sommermorgens in die Zentrale des KGB am Lubjanka-Platz zu spazieren, mit einem Schlag sämtliche autokratischen Machenschaften zu eliminieren und einen neuen, sauberen, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewussten Geheimdienst zu schaffen, der bereit ist für das umgebaute, demokratische Russland, von dem Gorbatschow träumte. Bakatin hatte von Anfang an gewusst, dass es hart werden würde. Was genau er gewusst hat, lässt sich nur schwer sagen. War ihm klar, dass der KGB eine moderne Kleptokratie war, die sich einen ziemlichen Batzen an Bargeld und Goldreserven geschnappt und ins Ausland geschafft hatte? Dass die führenden Köpfe mit den Verbrechersyndikaten des Landes gemeinsame Sache machten? Dass viele von ihnen Stalinisten der alten Schule waren, in deren Augen Gorbatschow der große Zerstörer war?
Doch ganz gleich, was Bakatin wusste oder nicht, er vollzog einen Akt von Glasnost, der in den Annalen der Geheimdienste rund um den Globus wohl einzigartig sein dürfte. Nach wenigen Wochen im Amt überreichte er Robert Strauss, dem damaligen amerikanischen Botschafter in Russland, Plan und Handbuch zu den Abhöreinrichtungen, die der KGB im neuerrichteten Gebäude installiert hatte, das die alte US-Botschaft ersetzen sollte. Strauss zufolge tat Bakatin dies »vorbehaltlos und als Zeichen der Kooperation und des guten Willens«. Moskaus zahlreichen Witzbolden zufolge bestand für das Gebäude Einsturzgefahr, nachdem die amerikanischen Säuberungsteams die Abhöreinrichtungen des KGB entfernt hatten.
»Bei diesen Technikern konnte man nie sicher sein«, bekennt Bakatin mir gegenüber offen. »Ich habe Strauss erklärt, dass ich aus ihnen nicht mehr herausbekommen habe.«
Als Preis für seinen Mut zur Offenheit kassierte er den Zorn der Organisation, die er leitete. Verrat, schrien manche, und Bakatins Posten wurde aufgelöst. Während der Amtszeit von Boris Jelzin wurde der KGB auf verschiedene Ministerien verteilt, nur um sich später mit umso größerer Macht und neuem Namen, unter dem persönlichen Kommando von Wladimir Putin, selbst ein Ziehsohn des alten KGB, neu zu formieren.
Wadim Bakatin kritzelt weitere Pfeile und sinniert über das Spionieren an sich. Spione, die sich ihre Arbeit zum Lebensinhalt gemacht haben, sind besessen, haben den Kontakt zum wirklichen Leben verloren, sagt er. Er selbst habe das Geschäft so unbeleckt verlassen, wie er es betreten hatte.
»Sie wissen erheblich mehr darüber als ich«, fügt er plötzlich hinzu und schaut mich an.
»Das stimmt nicht«, protestiere ich. »Ich bin selbst nicht über den Anfängerstatus hinausgekommen. Ich habe die Arbeit gemacht, als ich jung war, und vor über dreißig Jahren damit aufgehört. Davon zehre ich bis heute.«
Bakatin malt noch einen Pfeil.
»Also ein Spiel«, sagt er.
Meint er damit, dass ich das nur als Spiel betrachte? Oder dass das Spionagegeschäft an sich nur ein Spiel ist? Bakatin schüttelt den Kopf, so als wolle er sagen, dass das eh keinen Unterschied mache. Plötzlich werden seine Fragen zum verunsicherten Aufschrei eines Mannes, der seine Überzeugungen verloren hat. Was wird aus der Welt? Was wird aus Russland? Wo liegt der humanitäre Mittelweg zwischen kapitalistischem und sozialistischem Übermaß? Er ist Sozialist, sagt er. So ist er aufgewachsen:
»Man hat mir von klein auf beigebracht, dass der Kommunismus die einzig richtige Wahl für die Menschheit ist. Zugegeben, da ist etwas schiefgelaufen. Die Macht ist in die falschen Hände geraten, die Partei hat ein paarmal die falsche Richtung eingeschlagen. Dennoch glaube ich noch immer, dass wir den moralischen Antrieb zum Guten in der Welt geliefert haben. Und was sind wir jetzt? Was ist aus dem moralischen Antrieb geworden?«
Ein breiterer Graben als zwischen diesen zwei Männern ist nur schwer vorstellbar: hier der in sich gekehrte, standhafte Bakatin, parteitreuer Ingenieur aus Nowosibirsk, dort der in Georgien geborene Jewgeni Primakow, Halbjude, Sohn einer Ärztin und eines politisch verfolgten Vaters, Gelehrter, Arabist, Staatsmann, Akademiker und, nach einem halben Jahrhundert in Diensten eines Systems, das nicht dafür bekannt ist, mit den in Ungnade Gefallenen gnädig zu verfahren, Meister im Überleben.
Anders als Bakatin war Jewgeni Primakow in hohem Maß dazu geeignet, den KGB oder irgendeinen anderen großen Geheimdienst zu übernehmen. Als junger Agent, Codename MAKSIM, hatte er im Nahen Osten und in den Vereinigten Staaten spioniert, mal als Korrespondent für Radio Moskau, mal als Redakteur für die Prawda. Parallel zu seiner Agententätigkeit setzte sich sein Aufstieg in den wissenschaftlichen und politischen Reihen der Sowjetmacht fort. Als die Sowjetmacht unterging, war Primakow weiterhin erfolgreich, und so überraschte es niemanden, dass er nach fünf Jahren im Amt des Direktors des Auslandsnachrichtendienstes russischer Außenminister wurde; in dieser Funktion kam er eines Tages nach London, um mit seinem britischen Kollegen Malcolm Rifkind über die NATO zu sprechen.
Am Abend desselben Tages wurden meine Frau und ich ohne jede Vorankündigung zum Diner mit Primakow und seiner Gattin in die russische Botschaft in Kensington Palace Gardens gebeten. Am Morgen hatte mein Literaturagent einen atemlosen Anruf aus dem Privatbüro von Rifkind erhalten: Der Außenminister benötige ein signiertes Exemplar eines meiner Bücher, um es seinem russischen Gesprächspartner überreichen zu können.
»Ein bestimmtes Buch oder einfach irgendeins?«, will mein Agent wissen.
Agent in eigener Sache. Und der Außenminister braucht es umgehend.
Ich habe meine Bücher nicht stapelweise herumliegen, doch konnte ich eine gebundene Ausgabe von Agent in eigener Sache hervorkramen, die noch in akzeptablem Zustand war. Wohl aus Sparsamkeit hatte Rifkinds Büro nichts von einem Kurier gesagt, also riefen wir selbst einen, packten das Buch ein, adressierten das Päckchen an Rifkind, c/o Foreign Office, SW1, und schickten es los.
Ein paar Stunden später ruft das Privatbüro erneut an. Das Buch ist immer noch nicht eingetroffen, um Himmels willen, was ist passiert? Sofort kontaktiert meine Frau den Kurierdienst. Das besagte Päckchen wurde um soundso viel Uhr im Außenministerium abgeliefert, vom Empfänger per Unterschrift bestätigt. Diese Information geben wir an das Privatbüro weiter. Ach herrje, dann wird es wohl in der Sicherheitskontrolle feststecken, verflixt. Wir schauen nach. Und tatsächlich. Man entreißt das Buch den Klauen der verflixten Sicherheitskontrolle, nachdem es sicherlich beschnüffelt, durchgeschüttelt und durchleuchtet worden ist, und womöglich setzt Rifkind seinen Namen noch neben meinen, schreibt ein paar kollegiale Grüße dazu, so von Außenminister zu Außenminister. Doch das werden wir nie erfahren, denn weder mein Agent noch ich hören jemals wieder von Rifkind oder seinem Privatbüro.
Es ist an der Zeit, sich fertigzumachen und ein Taxi zu rufen. Meine Frau hat weiße Orchideen für unsere Gastgeberin besorgt, die Gattin des russischen Botschafters. Ich habe für Primakow ein paar Bücher und Videokassetten in eine Tragetasche gepackt. Unser Taxi hält vor der Botschaft. Es brennt kein Licht. Ich bin sehr pingelig, wenn es um Pünktlichkeit geht, deshalb sind wir eine Viertelstunde zu früh, doch der Abend ist mild, und ein paar Meter entfernt steht ein roter Polizeiwagen des diplomatischen Schutzes am Straßenrand.
Guten Abend, Officers.
Guten Abend, Sir, Madam.
Wir haben ein kleines Problem. Wir sind zum Diner in der russischen Botschaft eingeladen, aber ein wenig zu früh dran, und wir haben diese Mitbringsel hier für unsere Gäste. Können wir die Sachen bitte bei Ihnen lassen, während wir einen kleinen Spaziergang durch Kensington Palace Gardens machen?
Aber natürlich, Sir, aber nicht im Wagen, tut mir leid. Stellen Sie die Sachen dort vorn auf dem Bürgersteig ab, wir behalten sie im Auge.
Also stellen wir alles ab, gehen spazieren, kommen zurück und sammeln unsere Sachen wieder auf, die in der Zwischenzeit nicht in die Luft geflogen sind. Wir steigen die Treppe zur Botschaft hinauf. Plötzlich geht ein Licht an, und die Tür öffnet sich. Sehr große Männer in Anzügen beäugen misstrauisch unsere Gaben. Einer schnappt sich die Orchideen, der andere wühlt in meiner Tragetasche herum. Dann führt man uns in den prächtigen Salon. Es ist niemand darin. Unvermittelt überkommen mich alte Erinnerungen. Vor sechzig Jahren habe ich mit Mitte zwanzig als angehender Jungspion in britischen Diensten in genau diesem Raum einer Reihe von schauderhaften anglo-sowjetischen Freundschaftstreffen beigewohnt, um anschließend von überfreundlichen Talentsuchern des KGB nach oben gebeten zu werden, mir dort zum zigsten Mal Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin anzuschauen und mich einer weiteren höflichen Befragung zu unterziehen, in der es um meine Biographie, meine Herkunft, Exfreundinnen, um politische Neigungen und berufliche Ziele ging: All dies tat ich in der vergeblichen Hoffnung, in den Fokus eines Annäherungsversuchs des KGB zu rücken und so in den Augen meiner Vorgesetzten den heißbegehrten Status eines Doppelagenten zu erringen. Dazu kam es nie, was angesichts der massiven Unterwanderung unserer Geheimdienste durch die Sowjets in jenen Tagen aber kein Wunder war. Vielleicht hatte ich auch einfach den falschen Stallgeruch, auch das wäre nicht verwunderlich gewesen.
Auch damals schon fand man in einer Ecke dieses wunderschönen Salons eine winzige Bar. Dort gab es warmen Weißwein für all die Genossen, die zäh genug waren, sich einen Weg durch das Gedränge zu bahnen. Heute steht dort eine Babuschka von Mitte siebzig.
»Sie möchten Getränk?«
»Sehr gern.«
»Was möchten trinken?«
»Scotch, bitte. Zwei.«
»Whisky?«
»Ja, Whisky.«
»Sie möchten zwei? Für Frau auch?«
»Bitte. Soda, kein Eis.«
»Wasser?«
»Wasser ist auch gut.«
Kaum wollen wir den ersten Schluck nehmen, fliegen die Doppeltüren auf und Primakow tritt ein, begleitet von seiner Frau, der Frau des Botschafters, dem Botschafter selbst und einer Schar sonnengebräunter Machtmenschen in leichten Anzügen. Primakow bleibt vor uns stehen, setzt ein übertriebenes Grinsen auf und deutet anklagend mit dem Finger auf mein Glas.
»Was trinken Sie?«
»Scotch.«
»Sie sind jetzt in Russland. Trinken Sie Wodka.«
Wir reichen der Babuschka unsere vollen Gläser zurück, schließen uns der Gruppe an und marschieren im Sturmschritt in den eleganten vorrevolutionär eingerichteten Speisesaal. Dort steht eine lange, von Kerzen erhellte Tafel. Ich gehe zu dem mir zugewiesenen Platz, einen knappen Meter entfernt und gegenüber von Primakow. Meine Frau sitzt zwei Plätze weiter auf derselben Seite und wirkt erheblich entspannter, als ich es bin. Breitschultrige Kellner füllen unsere Wodkagläser randvoll. Primakow ist uns ein, zwei Drinks voraus, wie es scheint. Er ist sehr vergnügt, sehr aufgeräumt. Seine Frau, eine blonde, schöne Estin, Ärztin, mit einer mütterlichen Ausstrahlung, sitzt neben ihm. Auf der anderen Seite hat sein Dolmetscher seinen Platz, doch Primakow zieht es vor, sein ihm eigenes, lebhaftes Englisch zu sprechen, und lässt sich nur ab und zu einsagen.
In der Zwischenzeit habe ich erfahren, dass es sich bei den Machtmenschen in leichten Anzügen um russische Botschafter aus dem Nahen Osten handelt, die zu einer Konferenz nach London gekommen sind. Meine Frau und ich sind die einzigen Nichtrussen am Tisch.
»Sie nennen mich Jewgeni, ich nenne Sie David«, setzt Primakow mich in Kenntnis.
Es wird serviert. Wenn Primakow spricht, schweigen alle anderen. Er setzt immer wieder nach langen Pausen des Nachdenkens plötzlich an und wendet sich nur dann an seinen Dolmetscher, wenn ihm ein Wort nicht einfällt. Wie die meisten russischen Intellektuellen, die ich kennengelernt habe, hält auch er sich nicht mit Small Talk auf. Heute Abend lässt er sich erst über Saddam Hussein aus, über Präsident George Bush senior, Premierministerin Margaret Thatcher und dann seine eigenen gescheiterten Bemühungen, den Golfkrieg abzuwenden. Er redet gewandt und anschaulich und wirkt sehr charmant. Sein Blick lässt einen nicht los. In regelmäßigen Abständen legt er eine Pause ein, strahlt mich an, erhebt sein Glas und bringt einen Toast aus. Ich erhebe ebenfalls mein Glas, strahle zurück und erwidere den Trinkspruch. Es scheint ganz so, als gäbe es für jeden Gast einen eigenen Kellner mit einer eigenen Flasche Wodka. Auf mich trifft das jedenfalls gewiss zu. Wenn du dich in einem Wodkagelage wiederfindest, hatte mich ein englischer Freund vor meinem ersten Besuch in Russland gewarnt, dann halte dich an den Wodka und trinke um Gottes willen nichts von diesem tödlichen Krimsekt. Ich war ihm für seinen Rat nie dankbarer.
»Sie kennen Desert Storm, David?«, will Primakow wissen.
Ja, Jewgeni, ich kenne Desert Storm.
»Saddam, er war ein Freund von mir. Sie wissen, was ich meine mit Freund, David?«
Ja, Jewgeni, ich glaube, ich weiß, was Sie in diesem Zusammenhang mit Freund meinen.
»Saddam, er ruft zu mir an«, erklärt Primakow mit wachsender Entrüstung, »›Jewgeni. Hilf mir, das Gesicht zu wahren. Hol mich aus Kuwait raus.‹«
Dann hält er inne und lässt den Satz wirken. Und langsam dämmert es mir. Er will mir damit sagen, dass Saddam Hussein ihn gebeten hat, George Bush senior davon zu überzeugen, dass Hussein seine Truppen in Würde aus Kuwait abziehen kann – um sein Gesicht zu wahren –; was einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak vermieden hätte.
»Also gehe ich zu Bush«, fährt er fort und unterstreicht den Namen mit einem wütenden Schlag. »Dieser Mann ist« – angespannte Diskussion mit dem Dolmetscher. Beinahe wäre ihm wohl ein drastisches Wort herausgerutscht, um George Bush senior zu beschreiben, doch er reißt sich zusammen.
»Dieser Bush ist nicht kooperativ«, sagt er mit Nachdruck und macht ein zorniges Gesicht. »Also komme ich nach England«, fährt er fort. »Nach Großbritannien. Zu Ihrer Thatcher. Ich komme« – wieder eine hastige Rücksprache mit seinem Dolmetscher, doch diesmal schnappe ich das Wort datscha auf, wohl das einzige russische Wort, das ich kenne.
»Chequers«, sagt der Dolmetscher.
»Also, ich komme nach Chequers.« Eine Hand fliegt hoch und fordert Ruhe, dabei ist es rings um die Tafel bereits totenstill. »Eine Stunde hält diese Frau mir Vortrag. Sie wollen den Krieg!«
Es ist schon nach Mitternacht, als meine Frau und ich die russische Botschaft verlassen und wieder englischen Boden betreten. Hat mir Primakow den ganzen langen Abend über auch nur eine einzige persönliche oder politische Frage gestellt? Sprachen wir über Literatur, Spionage, das Leben im Allgemeinen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass er seinen Ärger mit mir teilen wollte; er wollte mich wissen lassen, dass er als Friedensstifter, als vernünftiger, besonnener Mensch alles in seiner Macht Stehende getan hatte, um einen Krieg zu verhindern, und dass seine Bemühungen am Starrsinn zweier westlicher Politiker gescheitert waren.
Diese Geschichte hat noch eine ironische Wendung, die sich erst kürzlich aufgetan hat. Ein Jahrzehnt später ist George Bush junior an der Macht, und erneut steht ein Einmarsch im Irak bevor; Primakow fliegt nach Bagdad und drängt seinen alten Freund Saddam Hussein, alle Massenvernichtungsmittel, über die er möglicherweise verfügt, den Vereinten Nationen zur sicheren Verwahrung zu übergeben. Doch diesmal ist es nicht Bush junior, der ihm eine Abfuhr erteilt, sondern Hussein; die Amerikaner würden sich niemals trauen, ihm so etwas anzutun, dazu teilten sie zu viele gemeinsame Geheimnisse.
Ich habe Primakow seit jenem Abend nicht wiedergesehen oder gesprochen. Wir haben keine Briefe, keine E-Mails gewechselt. Ab und an erreichte mich von dritter Seite eine Einladung: Sagen Sie David, wann immer er in Moskau ist, usw. usf. Aber Putins Russland lockte mich nicht, also schaute ich auch nicht bei Primakow vorbei. Im Frühling 2015 erreichte mich dann die Nachricht, dass er krank sei, und ob ich ihm wohl ein paar von meinen Büchern zum Lesen schicken könne. Da mir niemand gesagt hatte, welche Bücher, packten meine Frau und ich eine große Kiste mit lauter gebundenen Ausgaben. Ich signierte jedes Buch, versah es mit einer Widmung, und wir schickten die Kiste per Kurier an die angegebene Adresse; der russische Zoll schickte sie mit der Begründung zurück, es seien zu viele Bücher für eine einzige Lieferung. Wir packten den Inhalt also in mehrere Kartons um, die es wohl zum Empfänger geschafft haben, auch wenn wir keine Bestätigung dafür erhielten.
Und das werden wir auch nicht mehr, denn Jewgeni Primakow ist gestorben, bevor er die Bücher lesen konnte. Wie man mir sagte, äußert er sich in seinen Memoiren freundlich über mich, was mich sehr freute. Noch immer versuche ich vergeblich, ein Exemplar seiner Memoiren aufzutreiben. Aber so ist Russland eben.
Wie schätze ich jenen Abend nun aus dem großen Abstand ein? Ich habe schon vor längerem festgestellt, dass mich meine Fähigkeiten zu kritischer Betrachtung bei den seltenen Gelegenheiten, wenn ich Menschen in Machtpositionen persönlich begegne, völlig im Stich lassen und ich einfach nur das Bedürfnis habe, dabei zu sein, um zuzuhören und zu beobachten. Für Primakow war ich wohl nur eine Abendattraktion, ich bot ihm die Gelegenheit zu einer kleinen Auszeit, aber auch, so bilde ich mir gern ein, die Gelegenheit, offen mit einem Schriftsteller zu reden, dessen Werk Eindruck auf ihn gemacht hatte.
Wadim Bakatin hatte nur einem Freund einen Gefallen getan, als er einwilligte, mit mir zu sprechen, trotzdem glaube ich, auch ihm die Gelegenheit zu Offenheit gegeben zu haben. Meinen beschränkten Erfahrungen mit dieser Sorte Mensch zufolge haben diejenigen im Zentrum des Geschehens kaum Vorstellungen von dem, was um sie herum vor sich geht. Die Tatsache, dass sie selbst das Zentrum sind, macht das Ganze nur noch schwieriger. Später fand ein Amerikaner bei seinem Besuch in Moskau Gelegenheit, Primakow zu fragen, mit welcher meiner Figuren er sich denn identifizieren würde:
»Na, mit George Smiley, natürlich!«
Oldřich Černý – der auf keinen Fall mit Bakatin oder Primakow verglichen werden soll, beide erklärte Kommunisten ihrer Zeit – übernahm 1993, vier Jahre nach dem Fall der Mauer, den tschechischen Auslandsgeheimdienst und machte sich, auf Anweisung seines alten Freundes und regimekritischen Mitstreiters Václav Havel, daran, den Dienst auf die Gemeinschaft der westlichen Spionagedienste vorzubereiten. Im Laufe seiner fünfjährigen Amtszeit kam er in engen Kontakt mit der britischen MI6, vor allem mit Richard Dearlove, der unter Tony Blair später deren Chef werden sollte. Kurz nachdem Černý – Olda für seine Freunde – von seinem Amt zurückgetreten war, besuchte ich ihn in Prag, und wir verbrachten ein paar Tage gemeinsam, waren entweder in seiner winzigen Wohnung, in der er mit seiner langjährigen Partnerin Helena lebte, oder unterwegs in einer der vielen Kellerbars der Stadt, wo wir an blankgeschrubbten Holztischen Scotch tranken.
Bevor er den Posten übernommen hatte, verfügte Černý über ebenso wenig Ahnung von der Aufklärungsarbeit wie Wadim Bakatin, aber genau das war der Grund gewesen, aus dem Havel ihn dafür vorgesehen hatte, wie Černý erklärte. Als er seinen Dienst antrat, traute er seinen Augen kaum:
»Die Mistkerle hatten noch nicht mal mitgekriegt, dass der verfluchte Kalte Krieg vorüber war«, brachte er unter Gelächter hervor.
Nur wenige Nichtmuttersprachler können überzeugend auf Englisch fluchen; Černý war einer von ihnen. Er hatte während des Prager Frühlings mit einem Stipendium in Newcastle studiert und dort wohl das Fluchen gelernt. Nach seiner Rückkehr in ein Land, das wieder ganz unter der Knute der Sowjetunion stand, übersetzte er am Tag Kinderbücher und schrieb des Nachts anonym regimekritische Pamphlete.
»Es gab welche, die in Deutschland spioniert haben!«, fuhr er skeptisch fort. »1993, verdammt! Und auf den Straßen lungerten die Männer mit Gummiknüppeln, die nach Priestern und parteifeindlichen Elementen Ausschau hielten, um ihnen die Scheiße aus dem Leib zu prügeln! ›Hört mal‹, hab ich gesagt. ›Schluss damit. Wir sind eine Demokratie, verdammt noch mal!‹«
Černý sprach im Überschwang eines befreiten Mannes, und dazu hatte er jedes Recht. Er war von Haus aus Anti-Kommunist. Sein Vater, der im Krieg tschechischer Widerstandskämpfer gewesen war, hatte in der Nazizeit in Buchenwald gesessen, nur um später von den Kommunisten wegen Hochverrats zu zwanzig Jahren verurteilt zu werden. Eine von Černýs frühesten Erinnerungen war die Szene, wie die Gefängniswärter den Sarg seines Vaters vor dem Haus der Familie abgeladen haben.
Kein Wunder also, dass Černý, der Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer mit einem Universitätsabschluss in englischer Literatur, einen lebenslangen Kampf gegen politische Tyrannei focht; das brachte ihm wiederholt Verhöre durch den KGB und den tschechischen Geheimdienst ein, die ihn gnadenlos verfolgten, nachdem sie daran gescheitert waren, ihn zu engagieren.
Durchaus interessant ist die Tatsache, dass Černý, der doch immer wieder beteuerte, wie hoffnungslos schlecht gerüstet er dafür sei, die Führung der Spione des Landes nach der Trennung von der Slowakei zu übernehmen, den Job über fünf Jahre lang machte, bevor er schließlich in Würde zurücktrat. Danach leitete er eine Menschenrechtsstiftung, die sein Freund Václav Havel ins Leben gerufen hatte, und gründete gleichzeitig seine eigene Denkfabrik für Sicherheitsstudien, die auch fünfzehn Jahre später noch, drei Jahre nach seinem Tod, weiterhin floriert.
Kurz nachdem Černý gestorben war, traf ich Václav Havel in London bei einem privaten Lunch des tschechischen Botschafters. Der betagte Havel, müde und bei sichtlich schlechter Gesundheit, saß etwas abseits und schwieg die meiste Zeit. Jene, die ihn gut kannten, wussten, dass man ihn besser in Ruhe ließ. Ich aber ging schüchtern zu ihm und erwähnte Černýs Namen. Ich hätte mit ihm in Prag eine gute Zeit verbracht. Havel strahlte:
»Da haben Sie Glück gehabt«, sagte er und lächelte eine Weile.
21
Bei den Inguschen
Ich hatte schon vor unserem Zusammentreffen von Issa Kostojew gehört, doch den Lesern unter fünfzig wird dieser Name wahrscheinlich nichts sagen. Kostojew hatte es 1990 als für die besonders schweren Delikte zuständiger Polizeibeamter geschafft, dem Serienmörder Andrei Tschikatilo geschickt ein Geständnis zu entlocken. Tschikatilo, ukrainischer Ingenieur, hatte dreiundfünfzig Menschen umgebracht. Heute ist Kostojew russischer Parlamentsabgeordneter und setzt sich unermüdlich und unverblümt dafür ein, dass die Bewohner des Nordkaukasus größeren Respekt erfahren und die Bürgerrechte erhalten, insbesondere geht es ihm dabei um sein eigenes Volk der Inguschen, dessen Schicksal seiner Ansicht nach weithin unbekannt ist.
Kurz nach Kostojews Geburt erklärte Stalin öffentlich alle Tschetschenen und Inguschen zu Kriminellen, die mit den deutschen Eindringlingen kollaborieren würden – etwas, das sie ausdrücklich nicht getan hatten. Alle Inguschen – so auch Kostojews Mutter – wurden in Arbeitslager in Kasachstan zwangsdeportiert. Eine seiner frühesten Kindheitserinnerungen dreht sich darum, wie russische Wachen zu Pferd seine Mutter auspeitschen, weil sie auf einem abgeernteten Feld Mais nachgesammelt hatte. Die Inguschen, so erklärt er düster, hassen alle Invasoren. Als Stalin starb und man den Inguschen widerwillig die Erlaubnis zur Rückkehr in ihre Heimat erteilte, mussten sie feststellen, dass man ihre Häuser den Osseten überlassen hatte, einem christianisierten Volksstamm von Besatzern aus dem Süden, Stalins ehemalige Handlanger. Was Kostojew aber am meisten aufbringt, ist die Art, wie der Durchschnittsrusse sein Volk diskriminiert:
»Ich bin Russlands Nigger«, schimpft er und zupft sich wütend an seiner asiatisch anmutenden Nase und den Ohren. »Ich kann auf den Straßen Moskaus jederzeit verhaftet werden, nur weil ich so aussehe!« Dann bemüht er ohne weitere Erklärung eine andere Metapher und behauptet, die Inguschen seien die Palästinenser Russlands: »Erst vertreiben sie uns aus unseren Städten und Dörfern, und dann hassen sie uns, weil wir überlebt haben.«
Wie wär’s, fragt er mich, wenn er eine Gruppe von Männern zusammenstellt und mich mit nach Inguschetien nimmt? Eine spontane Einladung, aber eine ernstgemeinte, wie ich schnell merke. Wir werden gemeinsam die Schönheit der Landschaft genießen und Inguschen treffen, dann kann ich mir eine eigene Meinung bilden. Mir schwirrt der Kopf, doch ich sage, ich würde mich geehrt fühlen, nichts würde mir mehr Freude machen, also geben wir uns darauf die Hand. Es ist 1993.
Die besten Verhörtechniker haben etwas Spezielles an sich, irgendeinen Charakterzug, den sie als Waffe im Überzeugungskampf einsetzen können. Manche geben sich als personifizierte Vernunft, andere verwirren ihre Gegenüber oder schüchtern sie ein; wieder andere versuchen, den zu Verhörenden mit blanker Offenheit und Charme einzuwickeln. Der große, äußerst zähe und eine tiefe Untröstlichkeit ausstrahlende Issa Kostojew jedoch weckt in seinen Mitmenschen auf Anhieb das Verlangen, ihm gefallen zu wollen. Doch scheint nichts, das man sagen oder tun könnte, die Aura von unendlicher Traurigkeit, die sich hinter seinem freundlichen, betagten Lächeln verbirgt, vertreiben zu können.
»Und bei Tschikatilo«, frage ich ihn, »was brachte da den entscheidenden Durchbruch?«
Kostojew schließt halb die Augen und seufzt leise. Er zieht kräftig an seiner Zigarette und antwortet: »Sein Mundgeruch. Tschikatilo hat die intimen Körperteile seiner Opfer verspeist. Im Laufe der Zeit griff das seine Verdauung an.«
Ein Funkgerät knistert. Wir sitzen im unaufhörlichen Dämmerlicht zugezogener Vorhänge in der oberen Etage eines heruntergekommenen alten Hauses in Moskau. Bewaffnete Männer klopfen an, treten ein, wechseln ein paar Worte mit uns, gehen wieder. Polizisten? Inguschische Patrioten? Ist dies ein Büro oder ein Versteck? Kostojew hat recht: Ich befinde mich unter Exilanten. Die strenge junge Frau, die mir nur als »die Anklägerin« vorgestellt wird, könnte genauso gut eine von Salah Ta’amaris Kämpferinnen in Sidon oder Beirut sein. Der ratternde Kopierer, die uralte Schreibmaschine, die halbgegessenen Sandwiches, überquellenden Aschenbecher und Dosen mit warmer Cola, all das gehört zur Pflichtausstattung der gefährlichen Existenz palästinensischer Freiheitskämpfer, ebenso die riesige Pistole, die Kostojew an der Hüfte trägt und die er sich immer wieder in die Leistengegend schiebt, um es bequemer zu haben.
Die Inguschen hatten mein Interesse geweckt, weil niemand im Westen je von ihnen gehört zu haben schien, wie Kostojew schon richtig bemerkt hatte. Mein amerikanischer Agent fragte mich sogar, ob ich sie nicht vielleicht nur erfunden hätte. Vor allem aber interessierte mich die generelle Frage, die ich während meiner Reisen entwickelt hatte, was aus verschiedenen Ländern nach dem Ende des Kalten Krieges geworden war. Diese Neugier hatte mich andere Male schon nach Kenia, in den Kongo, nach Hongkong und Panama geführt. Anfang der 90er war die Zukunft der muslimischen Republiken im Nordkaukasus noch immer in der Schwebe. Würden die »Einflussbereiche« des Kalten Kriegs überdauern? Oder würden jetzt, mit der Befreiung Russlands von den Ketten des Bolschewismus, ihre südlichen Schutzgebiete anstreben, sich von Russland zu lösen? Und wenn ja, bedeutete das, dass die uralten Kriege gegen den russischen Bären wieder neu aufflammen?
Wie wir heute wissen, lautet die Antwort schlicht ja, die Kämpfe flammen wieder auf und fordern ihren schrecklichen Tribut. Zum Zeitpunkt meines Gesprächs mit Kostojew aber war der Ruf nach der Unabhängigkeit der asiatischen Republiken ohrenbetäubend laut, und niemand schien voraussehen zu können – und falls doch, kümmerte es denjenigen nicht –, dass der Preis der Unterdrückung in der Radikalisierung von Millionen gemäßigten Moslems bestehen würde.
Meinen neuen Roman gedachte ich in Tschetschenien anzusiedeln, doch nachdem ich Kostojew kennengelernt hatte, interessierte ich mich noch mehr für die Sache der benachbarten Inguschen, deren kleines Land man in ihrer Abwesenheit anderen überlassen hatte. In meinem Zuhause in Cornwall bereitete ich mich auf die Reise vor. Ich beantragte ein Visum und bekam es dank Kostojews Unterstützung auch. Im Sportgeschäft in Penzance kaufte ich mir in gespannter Erwartung der Reise einen Rucksack und – wie überraschend – einen Geldgürtel. Ich trainierte ein wenig, um mich in Europas höchsten Bergen nicht völlig zu blamieren. Ich setzte mich mit britischen Wissenschaftlern in Verbindung, die sich auf Russlands muslimische Bevölkerung spezialisiert hatten, und stellte fest, dass es eine internationale Gemeinschaft engagierter Gelehrter gab (wie zu fast allen Themen, wenn man etwas tiefer bohrt), die sich ganz der Sache des Nordkaukasus verschrieben hatten. Eine Zeitlang war ich ihr jüngstes Mitglied. Ich traf mich mit Tschetschenen und Inguschen im europäischen Exil und löcherte sie mit Fragen.
Aus Gründen, denen ich nicht weiter nachging, die ich mir aber gut ausmalen konnte, zog Kostojew es vor, über nichtkaukasische Mittelsmänner mit mir in Kontakt zu treten. Er meinte, ich solle mich reichlich mit amerikanischen Zigaretten und wertlosem Krempel eindecken. Er schlug eine billige vergoldete Armbanduhr vor, ein, zwei Zippos, eine Handvoll metallene Kugelschreiber. Dies alles für den wahrscheinlichen Fall, dass irgendwelche Banditen unsere Eisenbahn auf der Fahrt in den Süden anhalten sollten. Ehrliche Banditen, beharrte Kostojew, solche, die auch niemanden umbringen wollten. Sie bestanden nur auf dem Recht, von jedem, der ihr Territorium durchquerte, eine Art Gebühr zu verlangen.
Kostojew hatte unsere Leibwache auf sechs Mann reduziert. Das seien genug. Ich besorgte wertlosen Krempel und Zippos und packte alles in meinen Rucksack. Doch achtundvierzig Stunden vor meinem Flug nach Moskau (und nach dortigem Zwischenstopp weiter nach Nasran) rief mich unser Mittelsmann an und teilte mir mit, dass die Reise abgesagt worden sei. Die »zuständigen Behörden« könnten meine Sicherheit nicht garantieren und würden mich bitten, erst dann einzureisen, wenn sich die Lage beruhigt hätte. Welche Behörden die zuständigen waren, erfuhr ich nie, doch als ich ein paar Tage später die Abendnachrichten einschaltete, hatte ich allen Grund, ihnen dankbar zu sein. Die Rote Armee hatte einen massiven Boden- und Luftangriff auf Tschetschenien gestartet, und es sah ganz danach aus, als würde das benachbarte Inguschetien ebenfalls in den Krieg gezogen werden.
Als ich fünfzehn Jahre später Marionetten schrieb, wählte ich als unschuldigen jungen russischen Moslem, der in den sogenannten Krieg gegen den Terror verstrickt wird, einen Tschetschenen. Ich gab ihm Kostojews Vornamen Issa.
22
Ein Preis für Joseph Brodsky
Herbst 1987, ein sonniger Tag. Meine Frau und ich essen in einem chinesischen Restaurant in Hampstead zu Mittag. Gemeinsam mit Joseph Brodsky, russischer Exilant, ehemaliger politischer Häftling der Sowjets, Dichter und für seine vielen Bewunderer die wahre Seele Russlands. Wir hatten Brodsky im Laufe der Jahre schon ein paarmal getroffen, aber um ehrlich zu sein, sind wir uns nicht ganz sicher, warum die Wahl diesmal auf uns gefallen ist, ihn zu unterhalten.
»Was immer Sie tun, lassen Sie ihn unter keinen Umständen trinken oder rauchen«, hat uns seine Londoner Gastgeberin, eine Lady mit umfassenden Kontakten in der Kulturszene, gewarnt. Trotz wiederkehrender Herzprobleme ist er Alkohol und Zigaretten zugeneigt. Ich versicherte, wir würden unser Bestes geben, aber nach dem wenigen zu urteilen, was ich über Brodsky weiß, würde er eh tun, was er wolle.
Joseph war eigentlich kein ungezwungener Gesprächspartner, doch bei diesem Essen schien er ungewöhnlich munter, was wohl nicht zuletzt auf mehrere Gläser Black Label zurückzuführen war, die er trotz der sanften Proteste meiner Frau getrunken hatte, dazu rauchte er mehrere Zigaretten, alles mit kleinen Löffelchen Hühnersuppe mit Nudeln heruntergespült.
Meiner Erfahrung nach tauschen Literaten untereinander selten etwas anderes aus als das übliche Gemecker über die Agenten, Verleger und Leser, und im Nachhinein kann ich mir den tatsächlichen Inhalt unseres Gesprächs nur schlecht vorstellen, da die Kluft zwischen uns beiden schier unüberbrückbar schien. Ich kannte seine Gedichte, doch fehlte mir die Gebrauchsanweisung dazu, fand ich. Ich hatte seine Essays gerne gelesen – vor allem jenen über Leningrad, wo er im Gefängnis gesessen hatte – und war gerührt davon, wie sehr er Anna Achmatowa verehrte. Aber wenn Sie mich fragen, dann glaube ich, dass er kein Wort von dem gelesen hatte, was aus meiner Feder stammte, und auch nie die Notwendigkeit dazu gesehen hatte.
Trotzdem war es ein angenehmes Beisammensein, bis Josephs Gastgeberin, eine große, elegante Erscheinung, mit strenger Miene vor uns stand. Mein erster Gedanke war, dass sie die Flaschen auf und den Zigarettenqualm über unserem Tisch gesehen hatte und uns nun die Leviten lesen wollte, weil wir zugelassen hatten, dass Brodsky sich so gehenließ. Doch dann fiel mir auf, dass sie sich bemühen musste, ihre Aufregung zu verbergen.
»Joseph«, sagte sie atemlos. »Du hast den Preis bekommen.«
Langes Schweigen; Brodsky zieht an seiner Zigarette und schaut mürrisch zum Qualm hinauf.
»Welchen Preis?«, murrt er.
»Joseph, du hast den Literaturnobelpreis bekommen.«
Sofort schlägt er sich eine Hand vor den Mund, als wolle er verhindern, dass ihm etwas Schlimmes entschlüpft. Er schaut mich hilfesuchend an: Meine Frau und ich hatten nicht die leiseste Ahnung, dass er auf der Liste der möglichen Kandidaten stand, geschweige denn, dass dieser der Tag der Verkündung war.
Also stelle ich der Dame die offenkundige Frage: »Woher wissen Sie das?«
»Na ja, weil die skandinavischen Reporter jetzt vor der Tür stehen, Joseph, und weil sie dir gratulieren und dich interviewen wollen, Joseph!«
Joseph schaut mich immer noch flehend an. Unternehmen Sie etwas, scheint sein Blick sagen zu wollen. Schaffen Sie mich hier fort. Wieder wende ich mich an seine Gastgeberin: »Vielleicht interviewen die skandinavischen Reporter alle engeren Kandidaten. Nicht nur den Gewinner.«
Im Flur des Restaurants gibt es ein Münztelefon. Brodskys Gastgeberin weiß, dass sein amerikanischer Verleger, Roger Strauss, nach London gekommen ist, um für diesen Fall vor Ort zu sein. Sie ist es gewohnt, schnelle Entscheidungen zu treffen, also ruft sie in Strauss’ Hotel an und lässt sich mit ihm verbinden. Als sie wieder erscheint, lächelt sie.
»Wir müssen nach Hause, Joseph«, sagt sie sanft und berührt ihn am Arm.
Joseph nimmt einen letzten Schluck Scotch und steht schmerzlich langsam auf. Er umarmt seine Gastgeberin und lässt sich von ihr beglückwünschen. Meine Frau und ich schließen uns an. Jetzt befinden wir uns auf dem sonnig hellen Bürgersteig. Joseph und ich schauen uns an. Einen Augenblick lang habe ich das Gefühl, der Freund des Gefangenen zu sein, der wieder hinunter in die Zelle in Leningrad geführt werden soll. Voller russischer Leidenschaft wirft Brodsky seine Arme um mich, legt mir dann die Hände auf die Schultern, drückt mich von sich und erlaubt mir einen Blick auf die Tränen, die sich in seinen Augenwinkeln stauen.
»Ein Jahr Strafe für meine Schlagfertigkeit«, stellt er fest und lässt sich dann widerstandslos abführen, um sich den Verhören zu stellen.
23
Aus falscher erster Hand
Falls Sie für eine Insiderstory hinter den Kulissen der Formel Eins recherchieren, dann, so könnte ich mir denken, werden Sie sich wohl nicht an einen Anfänger unter den Mechanikern wenden, der eine blühende Phantasie und keinerlei Erfahrungen an der Rennstrecke mitbringt. Doch genau wie dieser unerfahrene Mechaniker habe ich mich gefühlt, als ich mich über Nacht und allein aufgrund meiner Schriftstellerei als Experte für alle Fragen rund um den Geheimdienst wiederfand.
Als man mich das erste Mal in der Sache beanspruchte, distanzierte ich mich von dem Gefühl der Verantwortung mit der wahren Begründung, dass es mir nach dem Gesetz verboten sei zuzugeben, Spionageluft auch nur geschnuppert zu haben. Die Angst, dass mein ehemaliger Vorgesetzter im Service, der sicher bereits bedauerte, meine Bücher überhaupt zur Veröffentlichung freigegeben zu haben, in seinem Verdruss beschließen könnte, an mir ein Exempel zu statuieren, ließ mich nicht mehr los, dabei hatte ich weiß Gott nichts Aufregendes an geheimem Wissen zu offenbaren. Noch wichtiger war mir allerdings meine Selbstachtung als Schriftsteller, auch wenn ich mir das damals wohl nicht eingestand. Ich wollte, dass meine Geschichten nicht als heimliche Enthüllungsstorys eines literarischen Deserteurs gelesen wurden, sondern als Fiktionen, die der Wirklichkeit, die sie hervorgebracht hatte, nur kleinste Kleinigkeiten entlehnt hatten.
Jedenfalls klang meine Beteuerung, niemals einen Schritt in die Welt der Geheimdienste getan zu haben, von Tag zu Tag unglaubwürdiger, nicht zuletzt dank meiner ehemaligen Kollegen, die kein Problem damit hatten, meine Tarnung auffliegen zu lassen. Und als mich die Wahrheit einholte und ich schwach protestierte, ich sei nur ein Schriftsteller, der früher mal Spion gewesen war, kein schreibender Spion, bekam ich die klare Rückmeldung, das getrost vergessen zu können: Einmal Spion, immer Spion, und auch wenn ich meine eigene Fiktion nicht für bare Münze nehmen würde, andere täten das trotzdem, damit müsse ich mich nun mal abfinden.
Und ich fand mich damit ab, ob es mir nun gefiel oder nicht. Jahrelang, zumindest kam es mir so vor, verging kaum eine Woche, in der nicht ein Leser von mir wissen wollte, wie man denn Spion oder Spionin werden könne. Ich antwortete auf diese Frage immer überkorrekt: Wenden Sie sich an Ihren Abgeordneten, das Außenministerium oder fragen Sie Ihren Berufsberater, falls Sie noch in der Schule sind.
In Wahrheit konnte man sich damals gar nicht bewerben, und das sollte man auch gar nicht. Man konnte nicht einfach nach MI5 oder MI6 oder GCHQ, Großbritanniens ultrageheimer Kryptographiebehörde, googeln; heute ist das alles möglich. Es gab keine Anzeigen auf der Titelseite des Guardian, die verkündeten, wenn man über die Fähigkeit verfügte, drei Menschen in einem Raum so lange zu bequatschen, bis sie taten, was man von ihnen wollte, dann könne die Arbeit als Spion vielleicht genau das Richtige für einen sein. Nein, man musste ausgespäht werden. Wer sich bewarb, konnte ja auch vom Feind kommen; wurde man aber entdeckt, dann war das ausgeschlossen. Wir alle wissen ja, wie gut sich diese Methode bewährt hat.
Um entdeckt zu werden, musste man in die richtige Familie hineingeboren sein. Man musste eine gute Schule, vorzugsweise eine Privatschule, besucht haben, man musste ein Studium, vorzugsweise in Oxford oder Cambridge, absolviert haben. Im Idealfall fanden sich in der Familienvergangenheit bereits Spione oder zumindest ein, zwei Soldaten. Falls nicht, dann half nur, irgendwann dem Schuldirektor, Tutor oder Dekan aufzufallen, der einen als möglichen Kandidat einstufte und in sein Büro rief, einem hinter geschlossener Tür ein Glas Sherry anbot und die Gelegenheit in Aussicht stellte, in London interessante Leute kennenzulernen.
Wenn man darauf mit einem Ja reagierte, man sei an diesen interessanten Leuten interessiert, dann traf womöglich ein Brief in einem auffälligen, doppelt versiegelten blassblauen Umschlag mit einem eingeprägten offiziellen Wappen ein, in dem man gebeten wurde, sich bei einer bestimmten Adresse in Whitehall einzufinden, und damit hatte das Leben als Spion begonnen. Zu meiner Zeit gehörte zu der Einladung auch ein Mittagessen in einem riesigen Club an der Pall Mall mit einem einschüchternden Admiral, der von mir wissen wollte, ob ich ein Mann für drinnen oder draußen sei. Noch heute frage ich mich manchmal, was ich darauf idealerweise hätte antworten sollen.
Möchtegernspione machten also einen Großteil meiner Fanpostschreiber aus; dicht gefolgt von denjenigen, die sich als Verfolgungsopfer der Geheimdienste sahen. Ihre verzweifelten Hilferufe wiesen eine gewisse Gleichförmigkeit auf. Diese Leute wurden observiert, ihre Telefone abgehört, ihre Autos und Wohnungen waren verwanzt, die Nachbarn hatte man bestochen. Ihre Post kam immer einen Tag zu spät, Ehemänner, Ehefrauen und Liebhaber schienen sie zu kontrollieren, sie konnten nirgendwo parken, ohne einen Strafzettel zu kassieren. Das Finanzamt war hinter ihnen her, und da gab es Männer, die nun so gar nicht nach echten Arbeitern aussahen und sich an den Gullys vor dem Haus zu schaffen machten, die ganze Woche nur herumlungerten und nicht fertig wurden. Es hätte sicherlich keinen Zweck gehabt, den Absendern der Briefe mitzuteilen, dass sie mit ihrem Eindruck womöglich in allen Punkten richtiglagen.
Einige Male rächte sich meine falsche Identität, wie zum Beispiel 1982, als eine Gruppe jugendlicher polnischer Dissidenten, die sich als »Mitglieder einer polnischen aufständischen Heimatarmee« bezeichneten, die Botschaft ihres Landes in Bern besetzte, wo ich studiert hatte, und sich drei Tage lang dort verschanzte.
Mitten in der Nacht klingelte in London mein Telefon. Der Anrufer war ein berühmter Schweizer Politiker, den ich zufällig kennengelernt hatte. Er bräuchte einmal ganz im Vertrauen meinen schnellen Rat, sagte er. Seine Kollegen seien ebenfalls daran interessiert. Er klang ungewöhnlich sonor, aber vielleicht brauchte ich auch einfach noch etwas Zeit, um richtig wach zu werden. Er hege ja nun wirklich keine Sympathien für die Kommunisten, sagte er. Tatsächlich hasse er vielmehr den Boden, auf dem sie gingen. Er setzte voraus, dass dies auch auf mich zutraf. Trotzdem, die polnische Regierung, ob nun kommunistisch oder nicht, sei die Vertretung eines diplomatisch anerkannten Staates, und die polnische Botschaft in Bern genieße den vollen Schutz durch das Gastgeberland.
Ob ich ihn verstünde? Ja. Gut. Denn da gebe es eine Gruppe junger Polen, die gerade mit vorgehaltenen Waffen die polnische Botschaft in Bern gestürmt habe, doch glücklicherweise sei noch kein Schuss gefallen. Ob ich noch zuhören würde? Ja. Und diese jungen Männer seien Antikommunisten, denen man unter anderen Umständen zujubeln würde. Doch darum ginge es jetzt nicht, nicht wahr, David?
Nein. Ging es nicht.
Die Burschen müssten also entwaffnet werden, richtig? Sie müssten so schnell und so diskret wie möglich aus der Botschaft und außer Landes geschafft werden. Und ob ich wohl bitte kommen und sie entfernen könnte, da ich mich ja in solchen Dingen auskennen würde?
Mit leicht hysterischer Stimme, nehme ich an, schwor ich meinem Anrufer, dass ich keinerlei Erfahrungen in diesen Dingen hätte, dass ich kein Wort Polnisch sprechen würde und mit niemandem aus der polnischen Widerstandsbewegung bekannt sei und dass ich so gut wie nichts davon verstünde, Geiselnehmern ihre Tat auszureden, seien es nun Polen, Kommunisten, Antikommunisten oder ganz andere. Nachdem ich auf jede mir nur erdenkliche Weise erklärt hatte, dass ich für diese Aufgabe völlig ungeeignet sei, schlug ich vor, so glaube ich, seine Kollegen und er sollten sich doch einen Priester suchen, der Polnisch sprach. Und wenn das nichts fruchtete, sollten sie am besten den britischen Botschafter in Bern aus dem Bett klingeln und ganz formell die Mithilfe unserer Spezialkräfte erbitten.
Ich werde wohl nie erfahren, ob seine Kollegen und er meinem Rat gefolgt sind. Mein berühmter Freund hat mir nie erzählt, wie die Geschichte ausgegangen ist, wenn auch die Presseberichte nahelegen, dass die Schweizer Polizei die Botschaft gestürmt hat, die vier Rebellen festnahm und die Geiseln befreite. Als ich dem Politiker ein halbes Jahr später auf einer Skipiste begegnete, fragte ich ihn nach der Angelegenheit, doch er erklärte nur leichthin alles zu einem harmlosen Scherz; ich folgerte daraus, dass man einem Ausländer wohl nicht einfach auf die Nase binden würde, welche Art von Deal die Behörden ausgehandelt hatten.
Und dann war da noch der Staatspräsident Italiens.
Als mich der italienische Kulturattaché in London anrief und mir mitteilte, dass Staatspräsident Cossiga ein Bewunderer meiner Werke sei und mich zu einem Essen im Quirinalspalast in Rom einladen wolle, da packte mich der Stolz, denn so etwas ist wohl nur wenigen Schriftstellern vergönnt. Doch hatte ich mich im Vorfeld über die politische Haltung des Präsidenten oder über sein Ansehen in der Bevölkerung zu jenem Zeitpunkt schlaugemacht? Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ich schwebte auf einer Wolke.
Gäbe es denn ein Buch, so fragte ich vorsichtig beim Kulturattaché nach, das der Präsident besonders schätzen würde? Oder galt seine Bewunderung gar meinem gesamten Werk? Der Attaché wollte sich erkundigen. Dann erfuhr ich den Titel: Dame, König, As, Spion.
Wolle Seine Exzellenz denn die englische Originalausgabe haben oder der besseren Lesbarkeit wegen doch lieber die italienische Übersetzung? Die Antwort gefiel mir: Der Präsident wolle das Original lesen.
Am folgenden Tag brachte ich ein Exemplar des Buchs zu Messrs Sangorski & Sutcliffe, den besten Buchbindern Londons, um es, koste es, was es wolle, in feinstes Kalbsleder binden zu lassen – königsblau, wenn ich mich recht erinnere, darauf der Name des Autors in recht markanten, vergoldeten Buchstaben. Danach sah das Buch – zu jener Zeit wirkten die Blöcke britischer Bücher manchmal schäbig, auch wenn sie gerade erst produziert worden waren – aus wie eine neu gebundene, prächtige alte Handschrift.
Auf die Titelseite setzte ich eine Widmung: Für Francesco Cossiga, Staatspräsident der Republik Italien. Darunter groß mein Pseudonym. Wahrscheinlich folgte noch eine Huldigung, eine Ehrerbietung oder gar der Schwur ewiger Treue. Und sicherlich habe ich viel Zeit damit verbracht, die passenden Worte zu finden und sie auf einem Schmierblatt vorzuschreiben, bevor ich sie der Geschichte überantwortete.
Dann machte ich mich mit dem Buch im Gepäck auf den Weg nach Rom.
Ich glaube, die Unterkunft, die man für mich gebucht hatte, war das Grand Hotel, und ich bin sicher, ich schlief schlecht, ließ das Frühstück aus, verbrachte viel Zeit vor dem Spiegel, während ich mir Sorgen um meine Haare machte, die unter Stress dazu neigen, wirr abzustehen. Und womöglich kaufte ich mir eine dieser gnadenlos überteuerten Seidenkrawatten, die in den Glasschaukästen im Hotel ausliegen, zu denen der Portier den Schlüssel hatte.
Lange vor der Zeit drückte ich mich auf dem Hotelvorplatz herum und rechnete höchstens mit einem Pressereferenten mit Wagen und Chauffeur. Was dann kam, traf mich völlig unvorbereitet: Vor dem Hotel hielt eine prächtige Limousine mit zugezogenen Vorhängen an den Scheiben, begleitet von einer Kavalkade weißgekleideter Polizisten auf Motorrädern mit blinkenden Blaulichtern und jaulenden Sirenen. Alles nur für mich. Ich stieg ein, und schneller, als mir lieb war, waren wir am Ziel, ich stieg wieder aus und wurde von einer ganzen Batterie von Reportern und Blitzlichtern empfangen. Als ich die breite Treppe hinaufstieg, erregten würdige, bebrillte Männer in mittelalterlich anmutenden Strumpfhosen meine Aufmerksamkeit.
Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass ich in der Zwischenzeit alles hinter mir gelassen habe, was man gemeinhin als Realität bezeichnen würde. Und bis auf den heutigen Tag habe ich das Gefühl, Ereignis und Ort seien aus der Zeit gefallen. Ich stehe also allein in einem riesigen Raum und halte mich an dem ledergebundenen Buch fest. Welcher Mensch ist denn solchen Dimensionen gewachsen? Diese Frage wird durch einen Mann in einem grauen Anzug beantwortet, der ganz bedächtig eine prunkvolle Steintreppe herunterschreitet. Der Inbegriff des italienischen Staatspräsidenten. Von ungeheuerer Eleganz, findet er schmeichelhafte Willkommensworte in italienisiertem Englisch, während er näher kommt, mir freudig seine Hände entgegenhält, Zuversicht ausstrahlt, Sicherheit, Macht.
»Mr le Carré. Mein ganzes Leben lang. Jedes Wort, das Sie geschrieben haben. Jede Silbe ist in meinem Gedächtnis« – ein freudiger Seufzer – »willkommen, willkommen im Quirinal.«
Ich stammle Dankesworte. Eine undeutliche Armee aus Männern mittleren Alters in grauen Anzügen versammelt sich hinter uns, hält aber respektvoll Abstand.
»Sie erlauben, bevor wir nach oben gehen, ich zeige Ihnen einige Besonderheiten im Palast?«, fragt mein Gastgeber im selben sanften Tonfall.
Ich erlaube. Wir gehen Seite an Seite einen prachtvollen Gang entlang, von dem aus hohe Fenster einen Blick auf die Ewige Stadt gewähren. Die graue Armee folgt uns in respektvollem Abstand. Mein Gastgeber bleibt stehen und scherzt:
»Rechts haben wir dieses kleine Zimmer. Dort saß Galileo, während er darauf wartete, dass sich seine Meinung ändert.«
Ich kichere. Er kichert. Wir gehen weiter und halten dann vor einem riesigen Fenster. Ganz Rom liegt uns zu Füßen.
»Und links sehen wir den Vatikan. Wir sind nicht immer einer Meinung mit dem Vatikan.«
Wieder lächeln wir verständnisinnig. Wir kommen um eine Ecke. Einen Augenblick lang sind wir allein. Mit zwei schnellen Handbewegungen wische ich den Schweiß von Sangorskis Kalbsleder und überreiche meinem Gastgeber das Buch.
Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, sage ich.
Er nimmt das Buch, lächelt freundlich, bewundert es, schlägt es auf und liest meine Widmung. Dann reicht er mir das Buch zurück.
»Sehr hübsch«, sagt er. »Warum geben Sie das nicht dem Staatspräsidenten?«
An die Mahlzeit erinnere ich mich kaum noch. Ich weiß nicht mehr, was wir aßen und tranken, aber gewiss war es vorzüglich. Wir saßen in einem mittelalterlichen »Penthouse« von geradezu himmlischer Schönheit, an einer langen Tafel, etwa dreißig Personen, die undeutliche graue Armee eingeschlossen. Mittig hatte Präsident Francesco Cossiga seinen Platz, ein deprimiert wirkender Mann mit getönter Brille und hängenden Schultern. Trotz der Behauptungen des Kulturattachés in London war sein Englisch nicht sehr gut. Eine Dolmetscherin war anwesend und bewies ihre Fähigkeiten, doch als wir auf Französisch umschwenkten, brauchten wir ihre Hilfe nicht mehr. Schon bald war klar, dass sie nicht nur für uns beide dolmetschte, sondern auch für die graue Armee zu beiden Seiten.
Ich erinnere mich nicht mehr daran, ob ich das Buch ein zweites Mal überreichte, aber so wird es wohl gewesen sein. Ich habe nur noch das Hauptthema der Unterhaltung im Gedächtnis, denn es ging nicht um Literatur oder Kunst, Architektur oder Politik, sondern um Spionage; jedes Mal, wenn Cossiga den Kopf hob und mich durch seine getönte Brille verwirrend intensiv musterte, brach er im Anschluss daran in einen plötzlichen und unerwarteten Wortschwall aus.
Kann man sich eine Gesellschaft ohne Spione denken, wollte er wissen. Was glaubte ich? Wie soll eine angebliche Demokratie ihre Spione kontrollieren? Wie soll Italien das tun? So als sei Italien ein besonderer Fall, keine Demokratie, sondern Italien. Was war meine Meinung über die italienischen Geheimdienste én général, und das bitte offen heraus und in meinen eigenen Worten. Taugten sie überhaupt etwas? Stellten sie meiner Meinung nach eine positive Kraft dar oder eine negative?
Auf all diese Fragen hatte ich keine im Geringsten nützliche Antwort – und habe sie bis heute nicht. Ich hatte keine Ahnung von der Arbeitsweise der italienischen Geheimdienste. Mir fiel auf, dass die graue Armee rings um uns aufhörte zu essen und die Köpfe hob, sobald der Präsident eine Frage auf mich abfeuerte, so als würde ein Dirigent seinen Taktstock heben, und das Essen erst dann weiter fortführte, wenn ich all die Weisheiten losgeworden war, die ich aufbringen konnte.
Plötzlich war der Präsident verschwunden. Vielleicht hatte er genug von mir. Vielleicht musste er sich um seine Geschäfte kümmern. Er war aufgesprungen, hatte mich noch einmal herablassend mit seinem Blick durchbohrt, mir die Hand geschüttelt und mich meinen Mitgästen überlassen.
Bedienstete führten uns in einen angrenzenden Raum, in dem Kaffee und Likör bereitstanden. Noch immer sprach niemand ein Wort. Die graugewandeten Männer saßen in weichen Sesseln rings um einen niedrigen Tisch und wechselten nur ab und zu murmelnd ein Wort miteinander, so als fürchteten sie, dass jemand mithören könnte; an mich richteten sie keine Silbe. Dann verabschiedete sich einer nach dem anderen, gab mir die Hand, nickte und ging.
Erst nachdem ich wieder in London war, erfuhr ich aus berufenem Munde, dass ich mit den versammelten Granden der zahlreichen italienischen Geheimdienste gespeist hatte. Cossiga hatte offenbar darauf spekuliert, dass sie aus erster Hand ein paar gute Ratschläge aufschnappen könnten. Beschämt und peinlich berührt, zog ich Erkundigungen über meinen Gastgeber ein; das hätte ich schon tun müssen, bevor ich Messrs Sangorski & Sutcliffe aufgesucht hatte.
Präsident Cossiga, der sich bei seiner Wahl zum Vater der Nation erklärt hatte, war zu dessen Plage geworden. Er hatte derart heftig auf seine ehemaligen Politikerkollegen links und rechts eingeschlagen, dass er sich den Spitznamen »Der Mann mit der Spitzhacke« eingehandelt hatte. Er bezeichnete Italien gerne als Land der Irren.
Cossiga, ein äußerst konservativer Katholik, der den Kommunismus als des Teufels betrachtete, kehrte 2010 heim zu Gott. Im hohen Alter war er immer wunderlicher geworden, wie man dem Nachruf im Guardian entnehmen kann. Es ist nicht bekannt, ob er aus meinen Ratschlägen, welche immer das auch gewesen sein mögen, Nutzen ziehen konnte.
Auch von Mrs Thatcher erhielt ich eine Einladung zum Lunch. Ihr Büro hatte mich für einen Orden vorschlagen wollen, doch ich hatte abgelehnt. Ich hatte nicht für Mrs Thatcher gestimmt, doch das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Mein bis heute gültiger Eindruck war, dass ich nicht für das britische System der Ehrungen geschaffen bin, dass dieses System für einen Großteil dessen steht, was ich an unserem Land so überhaupt nicht mag; ich wollte also damit nichts zu tun haben. Außerdem hatte ich keine sonderliche Achtung vor unseren britischen literarischen Kommentatoren und dementsprechend auch nicht gegenüber ihren Auswahlkriterien, selbst wenn sie mich einschlossen. In meinem Antwortschreiben bemühte ich mich, dem Büro der Premierministerin zu versichern, dass meine Ablehnung ihren Ursprung nicht in irgendwelchen persönlichen oder politischen Animositäten hätte, bedankte mich, ließ mich bei Mrs Thatcher empfehlen und nahm an, dass sich die Sache damit erledigt hatte.
Ich sollte mich irren. In einem zweiten Brief schlug das Büro einen erheblich vertraulicheren Ton an. Sollte ich bedauern, im Eifer des Gefechts eine vorschnelle Entscheidung getroffen zu haben, so ließ mich der Schreiber dieser Zeilen wissen, dass die Tür zu einer Ehrung noch immer offen stünde. Ich antwortete ebenso höflich, dass die Tür meinerseits fest verschlossen sei und dies auch weiterhin bleiben würde. Wieder bedankte ich mich, wieder bat ich, der Premierministerin meine Grüße auszurichten. Wieder nahm ich an, dass die Sache damit erledigt sei; bis abermals ein Brief eintraf, diesmal mit einer Einladung zum Lunch.
An jenem Tag waren im Speiseraum im Haus Nr. 10, Downing Street, sechs Tische eingedeckt, aber ich erinnere mich nur an den unseren; Mrs Thatcher saß am Kopfende, der niederländische Ministerpräsident Ruud Lubbers rechts von ihr, ich in meinem neuen engen grauen Anzug links. Es muss wohl 1982 gewesen sein. Ich war gerade aus dem Nahen Osten zurückgekehrt, Lubbers war erst kürzlich ins Amt berufen worden. Die anderen drei Gäste bilden in meiner Erinnerung nur einen verschwommenen Farbtupfer. Aus Gründen, die sich mir heute entziehen, nahm ich damals an, dass es sich bei ihnen um Industrielle aus dem Norden handelte. Ich erinnere mich auch nicht an eine freundliche Begrüßung unter uns sechs, vielleicht hatten wir das schon bei einem Cocktail vor dem Essen hinter uns gebracht. Ich weiß nur noch, wie Mrs Thatcher sich an den holländischen Ministerpräsidenten wandte, um mich mit ihm bekannt zu machen.
»Also, Mr Lubbers«, verkündete sie mit einem Ton in der Stimme, der ihn wohl auf eine Überraschung einstimmen sollte. »Das hier ist Mr Cornwell, aber Sie kennen ihn womöglich eher als den Schriftsteller John le Carré.«
Ruud Lubbers beugte sich vor und schaute mich eingehend an. Er hatte ein junges, fast unbekümmert wirkendes Gesicht. Er lächelte, ich lächelte, alles ganz freundlich.
»Nein«, antwortete er.
Und damit lehnte er sich lächelnd zurück.
Doch Mrs Thatcher war, wie man weiß, nicht gerade bekannt dafür, ein Nein einfach so als Antwort gelten zu lassen.
»Kommen Sie, Mr Lubbers. Sie haben doch schon von John le Carré gehört. Er hat Der Spion, der aus der Kälte kam geschrieben und …«, sie war kurz um Worte verlegen, »andere wunderbare Bücher.«
Lubbers, ganz der Vollblutpolitiker, überdachte seine Lage. Wieder beugte er sich vor und widmete mir einen weiteren, längeren Blick, so freundlich wie zuvor, aber überlegter, staatsmännischer.
»Nein«, wiederholte er und lehnte sich wieder zurück; offensichtlich war er sich sicher.
* Meinen Nachforschungen zufolge gab es allerdings tatsächlich auch eine Frau in ihrem Kabinett, Baroness Young, die jedoch nicht zum innersten Kreis gehörte.
Nun war es an Mrs Thatcher, mich genauer zu betrachten, und ich musste wohl über mich ergehen lassen, was die Mitglieder ihres durchwegs männlichen Kabinetts schon am eigenen Leib erfahren hatten, wenn sie das Missfallen ihrer Ministerin erregt hatten.*
»Nun, Mr Cornwell«, sagte sie wie zu einem ungehorsamen Schuljungen, der zur Rechenschaft gezogen wird. »Da Sie nun schon mal hier sind« – womit sie andeuten wollte, dass ich mich irgendwie hineingeschmuggelt hätte –, »gibt es etwas, das Sie mir mitteilen möchten?«
Fast zu spät fiel mir ein, dass ich ihr tatsächlich etwas zu sagen hatte. Ich war gerade aus dem Südlibanon zurückgekehrt und fühlte mich in der Pflicht, für die staatenlosen Palästinenser zu sprechen. Lubbers hörte zu. Die Industriellen aus dem Norden hörten zu. Mrs Thatcher aber hörte aufmerksamer zu als sie alle, und ihr war keine Spur von der Ungeduld anzusehen, die man ihr so häufig nachsagte. Sie blieb ganz Ohr, bis ich meinen Vortrag holprig zu Ende gebracht hatte, dann gab sie mir ihre Antwort.
»Kommen Sie mir doch nicht mit diesen rührseligen Geschichten«, kanzelte sie mich vehement ab, wobei sie die Schlüsselwörter betonte. »Tag für Tag appelliert man an meine Gefühle. So kann man doch nicht regieren. Das ist einfach nicht fair.«
Dann appellierte sie an meine Gefühle und hielt fest, dass es die Palästinenser gewesen seien, die die IRA-Attentäter ausgebildet hätten, welche wiederum ihren Freund Airey Neave in die Luft gesprengt hätten, den britischen Kriegshelden, Politiker und ihren engsten Berater. Ich gehe davon aus, dass wir danach nicht mehr sehr viele Worte miteinander wechselten. Ich nehme an, dass sie sich klugerweise von dem Moment an nur noch Ruud Lubbers und ihren Industriemagnaten widmete.
Ab und zu frage ich mich allerdings, ob Mrs Thatcher nicht doch einen Hintergedanken hatte, als sie mich einlud. Wollte sie vielleicht überprüfen, ob ich mich für eine ihrer Quasi-NGOs eignete – diese merkwürdig halboffiziellen öffentlichen Einrichtungen, die zwar kompetent sind, aber keine Macht haben, oder Machtbefugnisse haben, aber keinerlei Kompetenz?
Allerdings fällt es mir schwer, mir vorzustellen, welchen Nutzen ich denn für sie gehabt hätte – es sei denn natürlich, auch sie wollte eine Anleitung aus erster Hand zu der Frage, wie sie ihre untereinander verstrittenen Geheimdienste in den Griff bekommen könnte.
24
Seines Bruders Hüter
Ich habe erst gezögert, Nicholas Elliotts Beschreibung seiner Beziehung zu Kim Philby, seinem Freund, Spionagekollegen und auch Verräter, in diese Sammlung aufzunehmen. Erstens: Elliotts Darstellung ist eher eine Fiktion, an die er inzwischen selbst glaubt, weniger objektive Wahrheit; zweitens: Was immer Philby meiner Generation auch bedeuten mag, heute ist sein Name nicht mehr so bekannt und emotional besetzt wie damals. Doch am Ende konnte ich nicht widerstehen und liefere diesen Teil nun, um die einleitenden Worte gekürzt, als Einblick in die britische Spionagearbeit in der Nachkriegszeit, in ihre klassenbedingte Überheblichkeit und ihre Denkart.
Wer sich nicht mit diesem Geschäft auskennt, wird kaum begreifen, welches Ausmaß Philbys Verrat hatte. Allein in Osteuropa gerieten Dutzende, wenn nicht Hunderte von britischen Agenten in Gefangenschaft, wurden gefoltert und erschossen. Und wenn es nicht Philby war, der sie verriet, dann übernahm das George Blake, ein weiterer Doppelagent im MI6.
Ich hatte immer meine eigene Meinung zu Philby, was, wie ich schon in anderen Zusammenhängen berichtet habe, zu öffentlichen Streitigkeiten mit Philbys Freund Graham Greene und mit solchen Koryphäen wie Hugh Trevor-Roper geführt hat, erstere bedauere ich im Nachhinein sehr, zweitere hingegen nicht im Geringsten. Für diese Leute war Philby nur ein weiteres herausragendes Kind der 30er, ihres Jahrzehnts, nicht des unseren. Unter dem Zwang, sich zwischen Kapitalismus auf der einen Seite – für die Linken jener Zeit synonym mit Faschismus – und dem Aufbruch des Kommunismus auf der anderen Seite entscheiden zu müssen, hatte Philby den Kommunismus gewählt, Greene den Katholizismus und Trevor-Roper gar nichts. Na gut, Philbys Entscheidung lief westlichen Interessen zuwider, aber damit hatte er sich abzufinden, das war seine Sache. Punkt.
* A Spy among Friends, Bloomsbury, 2014.
In meinen Augen hingegen erweckte Philbys Motiv, sein Land zu verraten, erheblich mehr den Anschein, eine Lust zur Täuschung zu sein. Was mal als Bekenntnis zu einer Ideologie begonnen haben mochte, entwickelte sich zu einer psychischen Abhängigkeit, einer Sucht. Eine Seite war nicht genug für ihn. Er musste das ganz große Spiel spielen. Ich war daher wenig überrascht, als ich Ben Macintyres ausgezeichnetem Porträt* der Freundschaft von Philby und Elliott entnahm, was Philby in seiner Zeit in der Vorhölle in Beirut am meisten vermisst hatte, während er dort das ruhmlose Ende seiner Karriere als Agent des MI6 und des KGB zubrachte, voller Sorge, seine sowjetischen Kontrolleure könnten ihn fallengelassen haben: Abgesehen davon, dass er kein Cricket schauen konnte, fehlte ihm der Nervenkitzel des Doppellebens, das ihm so lange Kraft gegeben hatte.
Hat meine Abneigung gegenüber Philby im Laufe der Jahre etwas nachgelassen? Ich glaube nicht. Es gibt den Typus des Briten, der sich das Recht herausnimmt, die Sünden des Imperialismus zu geißeln, sich aber der nächsten großen imperialen Macht verschreibt, in der Illusion, deren Schicksal beeinflussen zu können. Ich glaube, dass Philby zu diesem Typus gehört. Im Gespräch mit seinem Biographen Phil Knightley hat er sich offenbar laut gefragt, worin mein derartiger Groll gegen ihn begründet wäre. Darauf kann ich nur antworten, dass ich mich, genau wie Philby selbst, mit den heftigen Konflikten auskenne, die ein eigenwilliger Vater auslösen kann, dass es aber durchaus bessere Wege gibt, die Gesellschaft dafür zu bestrafen.
Auftritt Nicholas Elliott, Philbys treuester Freund, Vertrauter und ergebener Waffenbruder in Krieg und Frieden, Eton-Absolvent, Sohn des ehemaligen Rektors von Eton, Abenteurer, Alpinist und Betrogener – außerdem sicherlich der unterhaltsamste Spion, der mir je begegnet ist. Im Rückblick betrachtet, bleibt er auch einer der rätselhaftesten. Wenn man heute sein Erscheinungsbild beschreiben wollte, dann würde man ihn wohl der Lächerlichkeit preisgeben. Er war ein sprudelnder Lebemann der alten Schule. Wann immer ich ihn sah, trug er einen makellos geschnittenen, dunklen Dreiteiler. Er war ein Strich in der Landschaft und schien stets ein wenig über dem Boden zu schweben, hatte immer ein angedeutetes Lächeln auf den Lippen und hielt einen Ellbogen angewinkelt, wegen des Martiniglases oder der Zigarette in der Hand. Seine Westen saßen locker, lagen nie eng an. Er sah aus wie ein Müßiggänger aus einem Roman von P. G. Wodehouse, und so redete er auch, nur mit dem Unterschied, dass er im Gespräch erschreckend direkt war, viel wusste und sich der Obrigkeit gegenüber gewagt despektierlich gab. Soweit ich mich besinne, habe ich es mir nie mit ihm verdorben, aber es hatte seinen guten Grund, dass Tiny Rowland, einer der härteren Brocken unter den Geschäftsleuten der City of London, ihn als den »Harry Lime von Cheapside« beschreibt.
Unter den vielen außergewöhnlichen Erfahrungen seines Lebens muss wohl die markanteste und zweifellos schmerzlichste die gewesen sein, seinem engen Freund, Kollegen und Mentor Kim Philby in Beirut gegenüberzusitzen und zu hören, wie dieser gesteht, in all den gemeinsamen Jahren sowjetischer Spion gewesen zu sein.
Während meiner Zeit beim MI6 grüßten Elliott und ich uns freundlich, aber mehr auch nicht. Als ich das erste Mal ein Gespräch für die Aufnahme in den Dienst durchlief, war er im Auswahlkomitee, und als ich Neuling war, gehörte er bereits zu den Granden vom fünften Stock, deren Spionageeinsätze den Auszubildenden als Muster dafür dienten, was ein einfallsreicher Mann vor Ort ausrichten konnte. Er tauchte immer nur kurz von seinen Einsätzen im Mittleren Osten in der Zentrale auf, hielt einen Vortrag, nahm an einer Einsatzbesprechung teil und verschwand dann wieder.
1964 verließ ich den Dienst mit dreiunddreißig Jahren, nachdem ich nur Unwesentliches hatte beisteuern können. Elliott trat 1969 zurück, da war er dreiundfünfzig und hatte bei jedem größeren Einsatz, den der Geheimdienst seit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs durchgeführt hatte, eine zentrale Rolle gespielt. Wir hielten losen Kontakt. Es plagte ihn, dass unser ehemaliger Arbeitgeber ihm untersagte, gewisse Geheimnisse auszuplaudern, die seiner Meinung nach ihr Verfallsdatum schon lange überschritten hatten. Er glaubte das Recht, ja die Pflicht zu haben, der Nachwelt seine Geschichte zu erzählen. Das mag der Punkt gewesen sein, an dem ich seiner Meinung nach ins Spiel kam – als eine Art Mittler oder Pappkamerad, der ihm dabei helfen sollte, seine einzigartigen Großtaten an die Öffentlichkeit zu bringen, wo sie hingehörten.
Und so kam es dazu, dass Elliott mir eines Abends im Mai 1986, dreiundzwanzig Jahre nach Philbys Teilgeständnis, in meinem Haus in Hampstead sein Herz ausschüttete; das erste einer ganzen Reihe solcher Treffen. Er redete, ich schrieb mit. Und wenn ich mir meine Notizen weitere drei Jahrzehnte später so anschaue – handgeschrieben, vergilbtes Papier, rostige Heftklammer –, dann stelle ich erleichtert fest, dass ich kaum etwas durchgestrichen habe. Im Verlauf unserer Gespräche versuchte ich, ihn für eine Mitarbeit an einem Theaterstück über Philby und ihn in den Hauptrollen zu gewinnen, aber davon wollte der echte Elliott nichts wissen.
Noch 1991 schrieb er mir: »Lassen Sie uns nie wieder an das Stück denken.« Heute bin ich, Ben Macintyre sei Dank, sehr froh drüber, dass wir uns daran hielten, denn was Elliott mir erzählte, war nicht die Geschichte, sondern die Vertuschungsgeschichte seines Lebens. Egal, über wie viel sarkastische Ungezwungenheit er auch verfügte, nichts konnte ihm den Schmerz der Erkenntnis nehmen, dass der Mann, dem er vorbehaltlos seine verborgensten persönlichen und beruflichen Geheimnisse anvertraut hatte, ihn vom allerersten Tag an beim sowjetischen Feind verraten hatte.
Elliott über Philby:
* Gründer und erster Herrscher Saudi-Arabiens.
»Überaus charmant, schockiert aber gern. Ich kannte ihn sehr gut, vor allem die Familie. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich kannte niemanden, der sich so betrinken konnte. Ich habe ihn verhört, er hat die ganze Zeit Scotch gekippt, und dann musste ich ihn buchstäblich ins Taxi verfrachten und nach Haus fahren lassen. Der Fahrer bekam noch fünf Pfund obendrauf, damit er ihn die Treppe hochtrug. Hatte ihn mal zu einer Dinnerparty mitgenommen. Alle fanden ihn charmant, und dann fängt er plötzlich an, über die Titten der Gastgeberin zu reden. Sie habe die schönsten Brüste in der ganzen Firma. Völlig daneben. Ich meine, man spricht doch auf einer Dinnerparty nicht von den Titten der Gastgeberin. Aber so war er. Er schockierte gern. Ich kannte auch seinen Vater. In der Nacht, in der er starb, hatte ich ihn in Beirut zum Essen eingeladen. Faszinierender Mann. Redete ununterbrochen über seine Kontakte zu Ibn Saud*. Eleanor, Philbys dritte Frau, himmelte ihn an. Der alte Knabe schaffte es doch tatsächlich, sich an die Frau von einem anderen ranzumachen, und verdrückte sich dann. Ein paar Stunden später ist er gestorben. Seine letzten Worte waren: ›Gott, ist mir langweilig.‹
* Flora Solomon machte Philby 1939 mit Aileen bekannt.
Meine Befragung dauerte ziemlich lange. Der eine Termin bei Philby in Beirut stand am Ende einer ganzen Reihe. Wir hatten zwei Quellen. Die eine war ein ziemlich glaubwürdiger Überläufer. Die andere war Philbys Mutterersatz. Der Seelenklempner in der Zentrale hatte mir von ihr erzählt. Er hatte mich angerufen. Er hatte Aileen, Philbys zweite Frau, behandelt, und er sagte: ›Sie hat mich von der Schweigepflicht entbunden. Ich muss mit Ihnen reden.‹ Also bin ich zu ihm gegangen, und er erzählte mir, dass Philby homosexuell ist. Trotz all der Liebeleien, trotz Aileen, die ich relativ gut kannte und die sagte, dass Philby gern Sex hatte und sich ziemlich gut dabei anstellte. Er war homosexuell, das gehörte alles zum Syndrom, und der Psychiater war überzeugt davon, dass er böse war, ohne irgendeinen Beweis dafür zu haben. Er würde für die Russen arbeiten. Oder so was. Er konnte sich nicht festlegen, aber er hatte keine Zweifel. Er riet mir, nach dem Mutterersatz zu suchen. Irgendwo gibt es einen Mutterersatz, sagte er. Es war diese Solomon*. Jüdin. Sie arbeitete bei Marks & Spencer, Einkäuferin oder so was. Sie waren zeitgleich Kommunisten gewesen. Wegen der Sache mit den Juden war sie sauer auf Philby. Philby hatte für Colonel Teague gearbeitet, Leiter der Station in Jerusalem, Teague war judenfeindlich, deshalb war sie sauer. Und sie verriet uns ein paar Dinge über ihn. Die alte kommunistische Schiene. Five (MI5) kümmerte sich damals um die Sache, also gab ich alles an Five weiter – sie sollten sich den Mutterersatz Solomon schnappen. Aber die wollten natürlich nichts davon wissen, die waren zu bürokratisch.
Die Leute waren so unvernünftig, wenn es um Philby ging. Sinclair und Menzies (ehemalige Generaldirektoren beim MI6) – also, die wollten nichts von dem hören, was man gegen ihn vorbrachte.
Ich kriegte also dieses Telegramm, darin stand, sie hätten den Beweis, und ich kabelte an White zurück (Sir Dick White, ehemaliger Generaldirektor von MI5, jetzt Chef beim MI6), ich müsse Philby aufsuchen und zur Rede stellen. Die Sache lief schon so lange, und ich war es der Familie schuldig, die Wahrheit aus ihm herauszubekommen. Was ich dabei gefühlt habe? Na ja, ich halte mich nicht für einen sonderlich gefühlvollen Kerl, aber ich mochte seine Frauen und Kinder, und ich hatte immer den Eindruck, dass Philby selbst alles loswerden wollte, um sich zur Ruhe zu setzen und Cricket zu schauen, denn das liebte er. Er kannte die Cricketstatistiken rauf und runter. Er konnte bis zum Abwinken über Cricket reden. Okay, meinte Dick White, machen Sie das. Also bin ich nach Beirut geflogen, hab ihn besucht und gesagt, wenn du so intelligent bist, wie ich glaube, dann machst du jetzt reinen Tisch, schon allein deiner Familie zuliebe, das Spiel ist aus. Na, jedenfalls konnten wir ihn nicht vor Gericht festnageln, er hätte alles geleugnet. Unter uns gesagt, war der Deal ganz einfach. Er sollte alles gestehen, das wollte er meinem Eindruck nach ja sowieso tun, aber da hat er mich aufs Glatteis geführt, und er musste uns alles, aber auch alles über den angerichteten Schaden verraten. Das hatte höchste Priorität. Schadensbegrenzung. Also, ich meine, überhaupt wird doch der KGB ihn ja wohl gefragt haben, wen können wir, mal abgesehen von Ihnen, im Dienst noch ansprechen, wer würde für uns arbeiten? Vielleicht hatte er jemanden vorgeschlagen. Das mussten wir wissen. Danach dann alles andere, was er ihnen verraten hatte. Da blieben wir standhaft.«
Meine Notizen wechseln zur Dialogform:
Ich: »Und welche Sanktionen hatten Sie zu verhängen, falls er nicht kooperieren würde?«
Elliott: »Wie bitte, alter Knabe?«
»Die Sanktionen, Nick, womit hätten Sie ihm im schlimmsten Fall drohen können? Ihn niederschlagen und nach London fliegen, zum Beispiel.«
»In London wollte ihn keiner haben, alter Knabe.«
»Nun, was ist mit der letzten Drohung – Verzeihung –, hätten Sie ihn umgebracht, liquidiert?«
»Aber mein Lieber. Einer von uns.«
»Und was hätten Sie sonst tun können?«
»Ich hab ihm gesagt, wir würden ihn sonst völlig isolieren. Keine Botschaft, kein Konsulat, keine Legation im gesamten Nahen Osten hätte auch nur das Geringste mit ihm zu tun haben wollen. In der Geschäftswelt würde er keinen Fuß mehr fassen können, seine journalistische Karriere wäre völlig am Arsch. Ein Aussätziger. Sein Leben wäre vorüber. Ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass er sich nach Moskau absetzen könnte. Er hatte diese eine Sache gemacht, aber das war früher, er wollte das aus dem Weg schaffen, also würde er alles gestehen. Danach würden wir die Angelegenheit vergessen. Was sollte denn aus seiner Familie und Eleanor werden?«
Ich erwähne das Schicksal eines gesellschaftlich weniger privilegierten britischen Verräters, der erheblich weniger verraten hatte als Philby, dafür aber jahrelang im Gefängnis saß.
* John William Vassall, homosexueller Sohn eines anglikanischen Pfarrers, arbeitete für den Marineattaché der britischen Botschaft in Moskau; er wurde wegen Spionage für den KGB zu achtzehn Jahren Haft verurteilt.
»Ach, na ja, Vassall – nun, er gehörte ja auch nicht zur obersten Liga, richtig?«*
* Peter Lunn, Leiter der MI6-Station in Beirut, der erste meiner zwei Chefs in Bonn.
** James Jesus Angleton, der an Wahnstörungen und Alkoholsucht leidende Chef der Gegenspionage im CIA, der davon überzeugt war, dass das rote Netz des KGB sich auf die gesamte westliche Welt ausgebreitet hatte. Während seiner Zeit in Washington hatte Philby ihn bei fuselgetränkten Schachpartien in der Kunst der Führung von Doppelagenten beraten.
Elliott: »Das war die erste Sitzung; wir verabredeten uns wieder für 16 Uhr, und da tauchte er mit einem Geständnis auf, acht oder neun eng getippte Seiten voll, über den angerichteten Schaden, über alles Mögliche, Unmengen davon. Dann meint Philby, ob ich ihm wohl einen Gefallen tun könne. Eleanor wisse, dass ich in der Stadt sei. Sie wisse aber nichts über seinen Hintergrund. Aber ob ich wohl auf einen Drink vorbeikommen würde, sonst würde sie noch den Braten riechen. Aber erst musste ich das ganze Zeug chiffrieren und an Dick White kabeln, und das tat ich auch. Als ich zu dem Drink in seine Wohnung kam, lag er besoffen auf dem Boden. Bewusstlos. Eleanor und ich mussten ihn ins Bett schleppen. Sie packte ihn am Kopf, ich an seinen Füßen. Er sagte nie ein Wort, wenn er besoffen war. Hat sein Lebtag nie etwas ausgeplaudert, soweit ich weiß. Und dann erzählte ich es ihr. Ich sagte: ›Du weißt, worum es hier geht, oder?‹ – ›Nein‹, antwortete sie, also sagte ich es ihr. ›Er ist ein verdammter russischer Spion.‹ Er hatte mir gegenüber erwähnt, dass sie ihn nie durchschaut hatte, und damit lag er richtig. Also kehrte ich nach London zurück und überließ es Peter Lunn*, ihn weiter zu befragen. Dick White hatte den Fall wunderbar abgewickelt, aber den Amerikanern kein Wort gesagt. Also musste ich auf dem kürzesten Weg nach Washington und es ihnen selbst auftischen. Der arme alte Jim Angleton**. Er hatte so einen Wirbel um Philby veranstaltet, als er Leiter der Station in Washington gewesen war, und als er die Wahrheit über Philby herausbekam – na ja, als ich sie ihm sagte –, da schlug er sich auf die vollkommen andere Seite. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gegessen.
Ich glaube, dass der KGB eines Tages den Rest von Philbys Autobiographie veröffentlichen wird. Der erste Band endet abrupt um 1947. Ich nehme an, da liegt noch ein Band im Tresor. Aber eine Sache, die Philby dem KGB geraten hat, ist, ihre Männer besser aufzupolieren. Sie sollen sich sauberer anziehen und besser riechen. Kultivierter auftreten. Heutzutage sehen sie einfach völlig anders aus. Extrem smart, aalglatt, erste Klasse. Das war Philbys Werk, da kannst du drauf wetten. Nein, wir hatten nie vor, ihn umzubringen. Aber er hat mich reingelegt. Ich dachte, er würde bleiben, wo er war.
* 1945 behauptete Konstantin Wolkow, ein aufstrebender Geheimdienstoffizier am sowjetischen Konsulat in Istanbul, er wisse von drei Spionen im britischen Auswärtigen Amt, einer davon in der Gegenspionage. Philby riss den Fall an sich, und Wolkow wurde schwer bandagiert in eine sowjetische Transportmaschine nach Moskau verfrachtet. Ich habe eine andere Version dieser Geschichte in Dame, König, As, Spion verarbeitet.
Wenn ich so zurückschaue – finden Sie nicht? – auf all das, was wir angestellt haben – na, wir hatten ganz gut was zu lachen – bei Gott –, aber wir haben uns ja auch wie Amateure angestellt. Also wirklich, diese Versorgungslinien durch den Kaukasus, Agenten, die ein und aus gehen, also so was von amateurhaft. Na ja, natürlich hat er Wolkow betrogen, und deswegen haben sie den ja auch umgebracht.* Und als Philby mir schrieb und mich einlud, ihn in Helsinki oder Berlin zu treffen, ohne dass ich meiner Frau Elizabeth oder Dick White etwas davon sagen sollte, schrieb ich ihm zurück und bat ihn, doch in meinem Namen ein paar Blumen auf Wolkows Grab zu legen. Ich fand das recht clever von mir.
* Reinhard Gehlen war zu diesem Zeitpunkt Direktor des Bundesnachrichtendienstes, BND. Siehe auch Kapitel 8 in diesem Buch.
** Ein gescheiterter Versuch von MI6 und CIA, die albanische Regierung 1949 zu untergraben, was mit dem Tod von mindestens dreihundert Agenten und unzähligen Verhaftungen und Hinrichtungen unter der albanischen Bevölkerung einherging. Kim Philby war einer der Planer gewesen.
*** Elliott war, genau wie sein Vater, ein begeisterter Alpinist.
Ich meine, was zum Teufel hat er denn geglaubt, wer ich bin, dass ich es ihnen nicht sage? Die erste Person, die alles wusste, war Elizabeth, und sofort danach kam Dick White. Ich war mit Gehlen* essen – kannten Sie Gehlen? –, kam spät nach Hause, und da lag dieser unscheinbare Briefumschlag auf meiner Fußmatte, auf dem stand ›Nick‹. Persönlich eingeworfen. ›Wenn Du kommen kannst, schick mir eine Postkarte mit der Nelsonsäule für Helsinki oder eine mit den Horse Guards für Berlin‹, irgend so ein Blödsinn. Für wen zum Teufel hielt er mich? Für die albanische Operation?* Die hatte er ja auch vermasselt. Ich meine, früher mal hatten wir selbst ein paar verflixt gute Aktivposten in Russland. Keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Und dann will er sich mit mir treffen, weil er einsam ist. Natürlich ist er einsam. Er hätte nicht gehen dürfen. Er hat mich reingelegt. Ich habe über ihn geschrieben. Sherwood Press. Alle großen Verlage wollten, dass ich ihnen was über das Verhör liefere, aber ich lehnte ab. Das ist eher was für die Bergkameraden**, für die Memoiren. Über die Zentrale kann man doch nicht schreiben. Verhören ist eine Kunst. Sie verstehen das. Das ging über eine lange Zeitspanne. Wo war ich stehengeblieben?«
Manchmal schweifte Elliott zu Erinnerungen an andere Fälle ab, mit denen er zu tun gehabt hatte. Am bedeutendsten war der des Oleg Penkowski gewesen, Oberst der GRU, die den Westen im Vorlauf der Kuba-Krise mit wichtigen Militärgeheimnissen versorgte. Elliott war wütend über ein Buch mit dem Titel The Penkovsky Papers, das die CIA als typische Propaganda des Kalten Krieges zusammengeschustert hatte.
* Harold (Shergy) Shergold, Controller der Einsätze des MI6 im Ostblock.
»Grauenhaftes Buch. Demnach war der Kerl eine Art Held oder ein Heiliger. Dabei war er eigentlich nichts dergleichen, er war schlichtweg übergangen worden und hatte die Schnauze voll. Die Amerikaner hatten ihm eine Abfuhr erteilt, aber Shergy* wusste, dass er okay war. Dafür hatte er einen Riecher. Wir hätten nicht unterschiedlicher sein können, aber wir kamen blendend miteinander aus. Les extrêmes se touchent. Ich kümmerte mich um die Einsätze, Shergy war der zweite Mann. Großartig im Außendienst, sehr einfühlsam, lag so gut wie nie falsch. Auch bei Philby täuschte er sich nicht, schon ganz früh wusste er Bescheid. Shergold hat sich Penkowski angeschaut und für okay befunden, also haben wir ihn genommen. Sehr mutige Sache in der Spionage, jemandem zu vertrauen. Jeder Trottel kann sich an seinen Schreibtisch setzen und erklären: ›Ich trau diesem Burschen nicht ganz. Einerseits, andererseits.‹ Erfordert schon ziemlichen Mumm, auf jemanden zu setzen und zu sagen: ›Ich glaube an ihn.‹ Aber das hat Shergy getan, und wir sind ihm gefolgt. Frauen. Penkowski hatte diese Huren in Paris, wir schafften sie ran, aber er klagte nur, er könne mit ihnen nichts anfangen: Einmal die Nacht, das war’s. Wir mussten den Dienstarzt nach Paris schicken, und der gab ihm eine Spritze in den Hintern, damit er ihn wieder hochkriegte. Es gab schon was zu lachen, manchmal lebte man für nichts anderes. Echte Brüller. Ich mein, wie konnte man Penkowski für einen Helden halten? Verrat braucht Mut, wohlgemerkt. Das muss man Philby lassen. Mut hatte er. Shergy ist mal zurückgetreten. Er war fürchterlich launisch. Ich kam rein und fand seine Kündigung auf dem Tisch. ›Angesichts der Tatsache, dass Dick White‹ – er schrieb natürlich CSS (Chief of the Secret Service) – ›ohne meine Einwilligung Informationen an die Amerikaner weitergegeben und damit meine hochsensible Quelle gefährdet hat, möchte ich hiermit als Beispiel für die anderen Mitglieder des Dienstes meinen Rücktritt einreichen‹ – so in etwa. White entschuldigte sich, und Shergy nahm seine Kündigung zurück. Ich musste ihn allerdings überreden. War nicht leicht. Sehr launisch. Aber im Außendienst großartig. Und bei Penkowski hatte er einfach recht. Ein Künstler.«
Über Sir Claude Dansey, auch bekannt als Colonel Z, stellvertretender Generaldirektor des MI6 im Zweiten Weltkrieg:
»Ein absolutes Arschloch. Und strohdumm. Hart und grob. Schrieb diese fürchterlichen kurzen Anweisungen an die Leute. Lag mit allen im Streit. Ich mein, ein richtiges Arschloch. Als ich nach dem Krieg Stationsleiter in Bern wurde, habe ich seine Netze übernommen. Aber er hatte diese Quellen in den oberen Wirtschaftsetagen. Die waren gut. Er hatte es raus, diese Geschäftsleute dazu zu bringen, für ihn zu arbeiten. Das konnte er gut.«
Über Sir George Young, Stellvertreter von Sir Dick White während des Kalten Krieges:
»Hatte seine Schwachstellen. Brillant, harter Hund, es musste immer nach seiner Nase gehen. Nach dem Dienst landete er bei Hambro’s (Bank). Später habe ich sie gefragt: Wie ist es mit George gelaufen? Gewinn oder Verlust? Ungefähr ausgeglichen, schätzten sie. Er hat ihnen das Geld vom Schah eingebracht, aber er hat auch ein paar ziemliche Pfuschereien hingelegt, die in etwa so viel gekostet haben, wie er für sie eingespielt hat.«
Über Professor Trevor-Roper, Historiker und während des Zweiten Weltkriegs Angehöriger des SIS:
»Genialer Wissenschaftler, alles in allem, aber schlapp und nutzlos. Er hatte was Schrulliges an sich. Ich hab mich totgelacht, als er auf diese Hitler-Tagebücher reinfiel. Der ganze Dienst wusste, dass sie gefälscht waren. Aber Hugh ist denen voll auf den Leim gegangen. Wie hätte Hitler sie denn schreiben können? Während des Kriegs wollte ich den Kerl nicht in meiner Nähe haben. Als ich die Leitung auf Zypern hatte, da habe ich der Wache gesagt, wenn ein Captain Trevor-Roper auftaucht, soll er ihm das Bajonett in den Hintern schieben. Und er taucht doch tatsächlich auf, und die Wache teilt ihm mit, was ich gesagt hatte. Hugh war verwirrt. Ein Brüller. Das mochte ich am Dienst. Es gab immer was zu lachen.«
Über die Bereitstellung einer Prostituierten für einen möglichen SIS-Aktivposten aus dem Nahen Osten:
»St. Ermin’s Hotel. Sie wollte nicht. Zu nah am Unterhaus. ›Mein Mann ist Abgeordneter.‹ Am 4. Juni brauchte sie auch frei, um ihren Sohn in Eton zu besuchen. ›Möchten Sie, dass wir lieber eine andere holen?‹, fragte ich. Sie zögerte keine Sekunde. ›Ich will nur wissen, wie viel.‹«
Über Graham Greene:
»Ich traf ihn während des Krieges in Sierra Leone. Greene wartete am Hafen auf mich. ›Haben Sie Gummis mitgebracht?‹, rief er schon auf Hörweite. Er hatte diese fixe Idee mit Eunuchen. Er hatte das Codebuch der Station studiert und herausgefunden, dass der Dienst tatsächlich einen Codebegriff für Eunuchen hatte. Musste wohl noch aus der Zeit stammen, als wir sie in den Harems als Agenten angeheuert haben. Er wollte unbedingt ein Signal mit dem Wort Eunuch darin absetzen. Eines Tages hat er dann eine Möglichkeit gefunden. Die Zentrale wollte, dass er irgendwo an einer Konferenz teilnahm. Kapstadt, glaube ich. Er war in irgendeiner Operation eingespannt. Kein richtiger Einsatz, wie ich ihn kenne, er hat nie einen geführt. Jedenfalls antwortete er: ›Kann nicht kommen, wie der Eunuch.‹«
Eine Kriegserinnerung an die Zeit in der Türkei unter diplomatischem Deckmantel:
* Cicero war ein deutscher Geheimagent namens Elyesa Bazna, der als Kammerdiener für Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, den britischen Botschafter in Ankara, arbeitete. Heute nimmt man an, dass er die ganze Zeit über britischer Agent gewesen ist, um den Deutschen Fehlinformationen unterzujubeln. Vielleicht tat Elliott dasselbe mit mir.
»Diner beim Botschafter. Es ist mitten im Krieg. Die Botschafterin schreit auf, weil ich die Spitze abgeschnitten habe. ›Welche Spitze?‹ – ›Die Spitze vom Käse.‹ – ›Der Butler hat mir den verfluchten Käse gereicht‹, erwidere ich. ›Und Sie haben die Spitze abgeschnitten‹, meckert sie. Wo zum Henker hatten sie den wohl her? Es war mitten im verfluchten Krieg. Cheddar. Und der Bursche, der ihn mir gereicht hatte, das war Cicero* gewesen, der Kerl, der der deutschen Abwehr all unsere Geheimnisse verkauft hat. D-Day, alles. Und die Deutschen haben ihm nicht geglaubt. Typisch. Kein Vertrauen.«
Ich erzähle Elliott, wie während meiner Zeit beim MI5 Graham Greenes Unser Mann in Havanna erschien und der Rechtsberater des Secret Service Greene aufgrund des Official Secrets Act unter Anklage stellen wollte, weil er die Beziehung zwischen einem Stationsleiter und seinem führenden Agenten öffentlich gemacht habe.
»Ja, und beinahe hätte es ihn auch erwischt. Wäre ihm nur recht geschehen.«
Am unvergesslichsten ist wohl, wie Elliott sich an eine Situation erinnert, als er Philby zu seiner Zeit in Cambridge aushorcht:
»›Man nimmt an, dass du da ein paar Flecken auf der Weste hast‹, sage ich.
›Woher denn?‹
›Ach, du weißt schon, frühere Liebschaften, Mitgliedschaften –‹
›Mitglied von was?‹
* Die Cambridge Apostles, auch bekannt als Conversazione Society, war 1820 als elitäre intellektuelle Geheimgesellschaft gegründet worden. Ihren eigenen Aussagen zufolge praktizierten die Mitglieder ›Homoerotik‹ und ›platonische Liebe‹. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Gesellschaft von sowjetischen Talentsuchern genutzt, um vielversprechende junge Studenten für die kommunistische Sache zu gewinnen. Kim Philby wird allerdings nirgends als ehemaliges Mitglied geführt.
›Hört sich wie eine ganz interessante Gruppe an. Aber dazu ist die Universität ja da. Alle Linken auf einem Haufen. The Apostles*, richtig?‹«
1987, zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, war ich in Moskau. Bei einem Empfang des Schriftstellerverbandes der UdSSR lud mich ein Journalist mit Kontakten zum KGB namens Genrich Borovik zu sich nach Hause ein, um dort einen alten Freund und Bewunderer meiner Arbeit zu treffen. Als ich nachfragte, stellte sich heraus, dass es sich um Kim Philby handelte. Wie ich inzwischen aus recht zuverlässiger Quelle weiß, war Philby zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass sein Tod bevorstand, und er hoffte, mit mir am zweiten Band seiner Memoiren arbeiten zu können, ebendem Buch, von dem Elliott überzeugt war, dass es bereits existierte. Ich lehnte ein Treffen ab. Elliott war mit mir zufrieden. Zumindest nehme ich das an. Vielleicht hatte er andererseits auch insgeheim gehofft, dass ich ihn mit Neuigkeiten über seinen alten Freund versorgen könnte.
Elliott hatte mir eine bereinigte Fassung seiner letzten Begegnung mit Kim Philby und seines mutmaßlichen Verdachts gegen ihn in den Vorjahren geliefert. In Wahrheit, und dafür müssen wir Ben Macintyre dankbar sein, hatte Elliott vom ersten Augenblick an, als Philby in Verdacht geriet, alles nur Erdenkliche unternommen, um seinen engsten Freund und Kollegen zu schützen. Erst als es nichts mehr zu leugnen gab, bemühte sich Elliott, seinen alten Freund zu einem Geständnis zu bewegen – das im besten Falle höchstens ein Teilgeständnis war. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits den Befehl erhalten hatte, Philby die Flucht nach Moskau zu ermöglichen, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Doch ob es nun stimmt oder nicht, mich hat er genauso zum Narren gehalten wie sich selbst.
25
Quel Panama!
1885 endete Frankreichs gigantisches Unterfangen, einen Kanal auf Meereshöhe durch Panama zu graben, in einem Desaster. Kleine und große Investoren jeglicher Art standen vor dem Ruin. Der Schmerzensschrei »Quel Panama!« wurde laut im Land. Dass dieser Ausdruck auch heute noch im Französischen benutzt wird, bezweifle ich, aber er erfasst meine persönliche Verbindung zu diesem wunderschönen Land sehr gut. Diese besteht seit 1947, als mein Vater Ronnie mich nach Paris schickte, um beim panamaischen Botschafter in Frankreich fünfhundert Pfund einzukassieren, einem gewissen Graf Mario da Bernaschina, der ein hübsches Haus in einer der eleganten Seitenstraßen der Champs-Élysées besaß, in denen es stets nach Frauenparfums duftet.
Es war Abend, als ich nach Voranmeldung in meinem grauen Schulanzug und mit gekämmten und gescheitelten Haaren vor der Tür des Botschafters stand. Ich war sechzehn. Der Botschafter, hatte mir mein Vater mitgeteilt, sei ein prima Kerl und würde nur zu gern eine lang ausstehende Ehrenschuld begleichen. Ich wollte ihm allzu gern glauben. Schon früher am Tag hatte ich einen ähnlichen Botengang zum Hotel George V unternommen, aber ohne Erfolg. Der Portier, ein gewisser Anatole, noch so ein prima Kerl, verwahrte Ronnies Golfschläger. Ich sollte Anatole zehn Pfund zustecken – zu der Zeit eine ungeheure Summe und praktisch das gesamte Geld, das mir Ronnie für diese Reise mitgegeben hatte –, und Anatole würde mir dafür die Golfschläger überlassen.
Doch Anatole, der die zehn Pfund einsteckte und sich herzlich nach Ronnies Gesundheit erkundigte, bedauerte, dass er, so gern er die Schläger auch herausgeben würde, auf strikten Befehl der Hotelleitung handelte, sie aufzubewahren, bis Ronnie seine Rechnung bezahlt hätte. Ein Anruf in London (R-Gespräch) hatte die Angelegenheit nicht klären können.
»Du meine Güte, Sohn, warum hast du nicht den Direktor kommen lassen? Glauben die vielleicht, dein alter Herr will sie übers Ohr hauen, oder was?«
Natürlich nicht, Vater.
Die Tür zu dem eleganten Haus wurde von der begehrenswertesten Frau geöffnet, die ich je gesehen hatte. Ich muss wohl eine Stufe unter ihr gestanden haben, denn in meiner Erinnerung lächelt sie auf mich herab wie mein persönlicher Erlöserengel. Ihre Schultern waren frei, sie hatte schwarze Haare und trug ein hauchdünnes Kleid aus mehreren Lagen Chiffon, das ihre Umrisse kaum verhüllte. Wenn man sechzehn ist, tauchen ständig begehrenswerte Frauen jeden Alters auf. Aus heutiger Sicht würde ich sie auf blühende Mitte dreißig schätzen.
»Sie sind Ronnies Sohn?«, fragte sie ungläubig.
Sie trat zurück und ließ mich herein. Dann legte sie ihre Hände auf meine Schultern, begutachtete mich im Schein des Lichts in der Eingangshalle ungezwungen von Kopf bis Fuß und schien alles zu ihrer Zufriedenheit zu befinden.
»Und Sie sind gekommen, um mit Mario zu sprechen«, sagte sie.
Wenn das in Ordnung wäre.
Ihre Hände blieben auf meinen Schultern liegen, und ihre Augen, die ja so viele Farben hatten, musterten mich weiter.
»Und Sie sind noch ein Kind«, stellte sie fest, so als wollte sie sich diese Information einprägen.
Der Graf stand mit dem Rücken zu einem Kamin in seinem Salon und sah aus, wie ein Botschafter zu jener Zeit im Kino eben aussah: korpulent, im Samtjackett, Hände hinter dem Rücken, die grauen Haare perfekt gelegt – onduliert –, und der leicht beherzte Handschlag von Mann zu Mann, dabei bin ich doch noch ein Kind.
Die Gräfin – denn in dieser Rolle sehe ich sie – fragt mich nicht, ob ich Alkohol trinke, geschweige denn, ob ich Daiquiri mag. Meine Antwort auf beide Fragen wäre sowieso ein gelogenes ›Ja‹ gewesen. Sie reicht mir ein mattiertes Glas, in dem eine aufgespießte Kirsche steckt, wir nehmen alle in weichen Sesseln Platz und üben uns in diplomatischem Small Talk. Gefällt mir die Stadt? Habe ich viele Freunde in Paris? Vielleicht sogar eine Freundin? Neckisches Zwinkern. Auf all diese Fragen gebe ich zweifellos überzeugende und unehrliche Antworten, verliere aber kein Wort über Golfschläger oder Portiers, bis mir eine Pause im Gespräch signalisiert, dass es nun an der Zeit ist, den Grund meines Besuchs zu erklären, was, wie mich meine Erfahrung schon gelehrt hat, am besten durch die Blume erfolgt, nicht rundheraus.
»Mein Vater hat erwähnt, dass Sie und er eine kleine geschäftliche Angelegenheit zu klären hätten, Sir«, deute ich an und höre mich selbst infolge des Daiquiri wie aus weiter Ferne.
Ich sollte an dieser Stelle die Natur dieser kleinen geschäftlichen Angelegenheit erklären, die, anders als so viele von Ronnies Geschäften, sehr unkompliziert ist. Als Diplomat und einer der obersten Botschafter, mein Sohn – ich gebe hier den Enthusiasmus wieder, mit dem Ronnie mich auf meine Mission vorbereitet hatte –, ist der Graf immun gegenüber solchen lästigen Störfaktoren wie Steuerabgaben und Einfuhrzöllen. Der Graf konnte importieren, was er wollte, er konnte exportieren, was er wollte. Falls also jemand vorhatte, dem Grafen ein Fass noch nicht ausgereiften, markenlosen Scotch Whisky für ein paar Pennys pro Pint zu schicken, und der Graf würde diesen Whisky in Flaschen umfüllen und ihn unter Nutzung seiner diplomatischen Immunität nach Panama oder sonstwohin verschiffen, dann war das ganz allein seine Angelegenheit.
Und falls der Graf beschloss, besagten unausgereiften Whisky in Flaschen einer bestimmten Art zu exportieren – die, sagen wir, im Design Dimple Haig ähnelt, einer damals populären Marke –, dann war auch das sein gutes Recht, genauso wie die Auswahl des Etiketts und die Angaben zum Flascheninhalt. Ich sollte mich nur darum kümmern, dass der Graf bezahlte – cash, mein Sohn, keine krummen Touren. Dann sollte ich mir eine schöne gemischte Grillplatte auf Ronnies Kosten gönnen, mir die Rechnung geben lassen, am nächsten Morgen die erste Fähre nehmen und mich mit dem Rest der Summe auf direktem Weg in sein prächtiges Büro im West End in London begeben.
»Eine geschäftliche Angelegenheit, David?«, wiederholte der Graf mit einem Ton in der Stimme, der mich an meinen Hausleiter in der Privatschule erinnerte. »Was sollen das für Geschäfte sein?«
»Die fünfhundert Pfund, die Sie ihm schulden, Sir.«
Ich erinnere mich noch an sein verwirrtes, ach so geduldiges Lächeln. Ich erinnere mich noch an die reich drapierten Sofas und Seidenpolster, an die alten Spiegel und die Vergoldungen überall, an meine Gräfin mit ihren langen, übereinandergeschlagenen Beinen unter den vielen Lagen aus Chiffon. Der Graf betrachtete mich weiter mit einer Mischung aus Verwirrung und Sorge. Die Gräfin ebenfalls. Dann schauten sie sich gegenseitig an, so als würden sie sich darüber verständigen, was sie da gesehen hatten.
»Nun, das ist sehr bedauerlich, David. Denn als ich hörte, Sie würden mir einen Besuch abstatten wollen, da habe ich gehofft, Sie würden mir einen Teil der großen Summe Geldes bringen, die ich in die Unternehmungen Ihres verehrten Vaters gesteckt habe.«
Ich weiß bis heute nicht mehr, was ich auf diese bestürzende Information erwidert habe und ob ich so bestürzt war, wie ich hätte sein sollen. Ich weiß nur noch, dass ich kurzfristig das Gefühl für Zeit und Ort verlor, was wohl teilweise auf den Daiquiri zurückzuführen war, teilweise aber auch darauf, dass ich nichts mehr zu sagen hatte und gerade das Recht verwirkt hatte, in diesem Salon zu sitzen; am besten wäre also gewesen, mich an dem Punkt zu verabschieden und zu verschwinden. Dann ging mir auf, dass ich allein in dem Raum war. Nach einer Weile kehrten meine Gastgeber zurück. Der Graf lächelte freundlich und entspannt. Die Gräfin wirkte ausgesprochen zufrieden.
»Also, David«, sagte der Graf, so als sei alles vergeben und vergessen. »Warum gehen wir nicht gemeinsam essen und unterhalten uns über Angenehmeres?«
Fünfzig Meter von dem Haus entfernt lag ihr russisches Lieblingsrestaurant. In meiner Erinnerung handelt es sich um ein winziges Lokal, bis auf einen Mann in einem weiten weißen Hemd, der Balalaika spielt, sind wir die einzigen Gäste. Während des Essens spricht der Graf über etwas Angenehmeres, die Gräfin legt einen Schuh ab und streicht mir mit dem bestrumpften Fuß am Bein entlang. Auf der kleinen Tanzfläche singt sie ›Dark Eyes‹ für mich, drückt sich mit ihrem ganzen Körper an mich und macht sich mit den Lippen an meinem Ohr zu schaffen, während sie mit dem Balalaikaspieler flirtet und der Graf nachsichtig zuschaut. Auf dem Weg zurück zu unserem Tisch beschließt der Graf, dass es nun an der Zeit sei, ins Bett zu gehen. Die Gräfin drückt mir zur Bekräftigung die Hand.
Mir sind die Entschuldigungen entfallen, die ich vorbrachte, aber offenbar brachte ich sie vor. Später fand ich mich in einem Park auf einer Bank wieder, und irgendwie gelang es mir, das Kind zu bleiben, das ich war, das Kind, als das die Gräfin mich gesehen hatte. Jahrzehnte später, allein in Paris, machte ich mich vergeblich auf die Suche nach Straße, Haus und Restaurant. Doch zu dem Zeitpunkt hätte die Realität der Erinnerung schon längst nicht mehr gerecht werden können.
Ich möchte nicht behaupten, dass es die unwiderstehliche Anziehungskraft des Grafen und der Gräfin gewesen sei, die mich ein halbes Jahrhundert später nach Panama zog, um zwei Romane und ein Drehbuch zu schreiben; nur, dass die Erinnerung an diese sinnliche, unerfüllt gebliebene Nacht sich mir ins Gedächtnis gebrannt hat, und sei es nur als eine der fragwürdigen verpassten Chancen einer endlos langen Jugendzeit. Ein paar Tage nach meiner Ankunft in Panama-Stadt erkundigte ich mich nach dem Namen. Bernaschina? Niemand hatte je von ihm gehört. Ein Graf? Aus Panama? Das schien höchst unwahrscheinlich. Vielleicht hatte ich die ganze Sache nur geträumt? Nein, hatte ich nicht.
Ich war nach Panama gereist, um für einen Roman zu recherchieren. Ungewöhnlicherweise hatte er bereits einen Titel: Der Nachtmanager. Ich suchte nach der Art von Gaunern, Schönrednern und schmutzigen Geschäften, die dem Leben eines unmoralischen englischen Waffenhändlers namens Richard Onslow Roper Schwung verleihen sollten. Roper dachte ich mir als Überflieger, im Vergleich zu dem mein Vater immer nur ein kleiner Nebenspieler gewesen war, der ständig Bruchlandungen hinlegte. Ronnie hatte versucht, Waffen in Indonesien zu verkaufen, und war dafür im Gefängnis gelandet. Roper aber war zu groß, um zu scheitern, bis er seinem Schicksal in Form von Jonathan Pine begegnete, einem ehemaligen Soldaten einer Eliteeinheit, der Nachtmanager in einem Hotel geworden war.
Pine war also mein stiller Teilhaber; für ihn und seine Geliebte fand ich ein Versteck in der Pracht Luxors; ich kundschaftete die Luxushotels von Kairo und Zürich ebenso aus wie die Wälder und Goldminen im nördlichen Quebec; danach ging es nach Miami, wo ich den Rat der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde, der DEA, suchte. Dort versicherte man mir, dass es keinen besseren Ort für Roper geben könne, um einen Drogen-Waffen-Deal durchzuziehen, als die Freihandelszone Colón in Panama, am westlichen Eingang zum Kanal. In Colón würde Roper genau die offizielle Unaufmerksamkeit vorfinden, die sein Unternehmen erforderte.
Und falls Roper seine Ware unübersehbar präsentieren wollte, ohne gleichzeitig unnötige Aufmerksamkeit zu erregen?, fragte ich. Auch in Panama, sagte man mir. Gehen Sie in die Berge in Zentralpanama. Dort oben werden keine Fragen gestellt.
In einem schwülen Bergwald Panamas nahe der costa-ricanischen Grenze führt mich ein amerikanischer Militärberater – im Ruhestand, wie er betont – durch ein grausiges Lager. Hier bildete die CIA in den Tagen, als die Vereinigten Staaten in ihrem Kampf gegen alles, was sie für Kommunismus hielten, jeden Drogentyrannen in der Region unterstützten, die Spezialeinheiten aus einem halben Dutzend mittelamerikanischer Länder aus. Zieht man an einem Draht, schnellen von Kugeln durchsiebte, auffällig bemalte Zielscheiben aus dem Erdboden hervor: eine Lady aus spanischen Kolonialtagen mit nackten Brüsten und einer gezückten Kalaschnikow; ein blutbeschmierter Pirat mit Dreispitz und erhobenem Entermesser; ein kleines rothaariges Mädchen mit aufgerissenem Mund, so als wolle es schreien: »Nicht schießen, ich bin nur ein Kind.« Am Waldrand des Lagers stehen Holzkäfige für gefangene Wildtiere: Bergtiger, Dschungelkatzen, Böcke, Schlangen, Affen, alle verhungert und in ihren Käfigen verrottet. In einem verdreckten Vogelhaus liegen die Überreste von Papageien, Adlern, Kranichen, Milanen und Geiern.
Um die Jungs scharf zu machen, erklärt mein Fremdenführer. Um sie herzlos zu machen.
In Panama-Stadt geleitet mich ein vornehmer Panamaer namens Luis zum Palacio de las Garzas, dem Palast der Reiher, um dort den amtierenden Präsidenten Endara zu treffen. Unterwegs unterhält er mich mit dem neuesten Tratsch.
Die Reiher, die ich auf dem Vorplatz des Palastes herumstolzieren sehe, sind nicht die Nachfahren der vielen Generationen an Reihern, wie allgemein angenommen. Das sind Betrüger, erklärt Luis mit gespielter Entrüstung, sie wurden im Schutz der Nacht hergeschmuggelt. Als der amerikanische Präsident Jimmy Carter seinen panamaischen Amtskollegen besuchen wollte, hatten dessen Geheimdienstleute den Palast mit Desinfektionsmitteln gesäubert. Bei Anbruch der Nacht lagen alle Präsidenten-Reiher tot auf dem Hof. Ersatzvögel von unbekannter Herkunft, in Colón eingefangen, waren Minuten vor Carters Ankunft mit einem Passagierflugzeug herangeschafft worden.
Endara, jüngst verwitwet, hat nur wenige Monate nach dem Ableben seiner ersten Frau seine Geliebte geheiratet, fährt Luis fort. Der Präsident ist vierundfünfzig, seine Braut, eine Studentin von der University of Panama, zweiundzwanzig. Panamas Presse nutzt das Event, um sich einen Spaß daraus zu machen, und nennt Endara »El Gordo Feliz«, den »Glücklichen Dicken«.
Wir überqueren den Vorplatz, bewundern die betrügerischen Reiher und steigen die prächtige kolonialspanische Treppe hinauf. Auf alten Fotos sieht man Endara bei Straßenschlachten, doch der Endara, der mich empfängt, ähnelt meinem Grafen so sehr, dass ich ihn wohl in meinen Träumen nach den fünfhundert Pfund gefragt hätte, wenn er nicht einen Frack und die rote Schärpe über der breiten weißen Weste getragen hätte. Eine junge Frau kauert auf allen vieren zu seinen Füßen, das wohlgeformte Gesäß in eine Designerjeans gezwängt, und müht sich mit einem Lego-Palast ab, den sie gerade mit den Kindern des Präsidenten errichtet.
»Darling«, ruft Endara zu ihr hinunter, mir zuliebe auf Englisch. »Schau doch, wer hier ist! Du hast doch sicher schon gehört von …«, und so weiter.
Die First Lady, immer noch hockend, mustert mich kurz und nimmt ihre Tätigkeit dann wieder auf.
»Aber Darling, natürlich hast du schon von ihm gehört!«, drängt der Präsident. »Du hast doch seine wunderbaren Bücher gelesen! Wir beide!«
Recht spät meldet sich der ehemalige Diplomat in mir.
»Sehr verehrte Madame Präsident, es gibt überhaupt keinen Grund, warum Sie jemals von mir gehört haben sollten. Aber vielleicht kennen Sie Sean Connery, den Schauspieler, der in meinem letzten Film mitgespielt hat?«
Langes Schweigen.
»Sie sind Freund von Mister Connery?«
»Ja, bin ich«, antworte ich, dabei kenne ich ihn kaum.
»Sie sind herzlich willkommen in Panama«, erklärt die First Lady.
Im Club Union, der Bühne der Reichen und Berühmten Panamas, frage ich erneut nach Graf Mario da Bernaschina, Botschafter in Frankreich, mutmaßlicher Ehemann der Gräfin, Einkäufer namenlosen Whiskys. Niemand kann oder will sich an ihn erinnern. Es brauchte den Einsatz eines unermüdlichen panamaischen Freundes namens Roberto, der mir nach langen Ermittlungen meldet, dass es den Graf zwar tatsächlich gegeben hat, er aber nur eine unwesentliche Rolle in der unbeständigen Geschichte seines Landes gespielt hat.
Der Grafentitel »stammte aus Spanien über die Schweiz«, was immer das auch heißen mag. Er war ein Freund von Arnulfo Arias, Präsident von Panama. Als Arias durch Torrijos gestürzt wurde, war Bernaschina in die amerikanische Panamakanalzone geflohen und hatte dort behauptet, Arias’ ehemaliger Außenminister gewesen zu sein, was nicht stimmte. Dennoch lebte er mehrere Jahre lang auf großem Fuß, bis er während eines, wie ich annehme, üppigen Essens in einem amerikanischen Club von Torrijos’ Geheimpolizei entführt wurde. Er saß im berüchtigten Gefängnis von La Modelo und sah sich einer Anklage wegen Verschwörung gegen den Staat, Verrats und Volksverhetzung gegenüber. Drei Monate später wurde er aus rätselhaften Gründen entlassen. Zwar prahlte er im Alter damit, er habe fünfundzwanzig Jahre lang im diplomatischen Dienst für sein Land gestanden, doch hatte er nicht mal zum panamaischen Auslandsdienst gehört. Botschafter Panamas in Frankreich war er auf keinen Fall gewesen. Von der Gräfin, wenn sie denn eine gewesen war, erfuhr ich glücklicherweise nichts: Meine Jugendphantasien blieben unangetastet.
Und was das Fass mit namenlosem Whisky angeht und die ungelöste Frage, wer, wenn überhaupt, wem fünfhundert Pfund schuldete, so können wir uns nur einer Sache sicher sein: Trifft ein Hochstapler auf einen Schwindler, schimpft einer den anderen Betrüger.
Auch Länder sind handelnde Figuren. Nach einer Statistenrolle in Der Nachtmanager beharrt Panama darauf, in dem neuen Roman, den ich fünf Jahre später plane, die Hauptrolle zu spielen. Mein Held in spe ist jener arg vernachlässigte Stammgast in der Welt der Spionage, der Geheiminformationen erdichtet oder, wie man ihn in der Branche nennen würde, der Hausierer ist. Natürlich ließ Graham Greene in Unser Mann in Havanna den Beruf des Hausierers hochleben. Doch aus Wormolds Erfindungen erwuchs kein plötzlicher Krieg. Ich wollte, dass sich die Farce in eine Tragödie verwandelte. Die Vereinigten Staaten hatten schon den bemerkenswerten Coup gelandet, in Panama einzumarschieren, obwohl sie das Land ja bereits besetzt hielten. Dann sollten sie doch einfach ein zweites Mal einmarschieren, nur aufgrund der an den Haaren herbeigezogenen Geheiminformationen meines Hausierers.
Aber wer soll die Rolle des Hausierers spielen? Er muss gesellschaftlich belanglos sein, ungefährlich, unschuldig, liebenswert, einer, der in den Spielchen dieser Welt nicht mitspielt, es aber gern möchte. Loyal gegenüber allem, was er liebt: Frau, Kinder, Beruf. Ein Phantast. Geheimdienste sind berühmt dafür, auf Phantasten hereinzufallen. Viele ihrer berühmtesten Vertreter – Allen Dulles zum Beispiel – sind selbst Phantasten gewesen. Mein Hausierer muss in der Dienstleistungsbranche arbeiten, wo er mit den Großen, Guten, Einflussreichen, Leichtgläubigen zusammenkommt. Ein angesagter Modefriseur vielleicht, ein Figaro? Ein Antiquitätenhändler? Ein Galerist?
Ein Schneider?
Nur bei zwei, drei meiner Bücher kann ich mit Sicherheit sagen, wo sie ihren Ausgangspunkt hatten. Der Spion, der aus der Kälte kam begann am Londoner Flughafen, als ein untersetzter Mann Mitte vierzig sich neben mir auf einen Barhocker plumpsen ließ, in der Tasche seines Regenmantels herumwühlte und eine Handvoll Kleingeld in einem halben Dutzend verschiedener Währungen auf die Theke kullern ließ. Mit den massigen Fingern eines Boxers suchte er in den Münzen herum, bis er genug von einer Währung zusammenhatte.
»Einen doppelten Scotch«, bestellte er. »Kein blödes Eis.«
Mehr vernahm ich nicht aus seinem Mund, wenn ich mich recht erinnere, aber ich glaubte einen Einschlag Irisch herausgehört zu haben. Er bekam seinen Drink, dann schürzte er die Lippen in der vielfach praktizierten Weise eines Gewohnheitstrinkers und leerte das Glas in zwei Zügen. Im Anschluss schlurfte er davon, ohne sich umzuschauen. Ein Geschäftsreisender, dessen glückliche Zeiten vorbei waren, nehme ich an. Doch wer immer er auch war, ich machte ihn zu Alec Leamas, meinem Protagonisten in Der Spion, der aus der Kälte kam.
Dann war da noch Doug.
Mitte der 90er schlägt ein amerikanischer Freund, der gerade in London weilt, vor, doch mal bei dem Schneider Doug Hayward vorbeizuschauen, der sein Geschäft in der Mount Street im West End hat. Mein Freund kommt aus Hollywood. Doug Hayward kleidet eine ganze Reihe mehr oder weniger berühmter Filmschauspieler ein. Eigentlich rechnet man nicht damit, einen Schneider sitzend anzutreffen, doch als wir bei Doug ankommen, thront er in einem Ohrensessel und telefoniert. Später erzählt er mir, dass er häufig sitzt, weil er ziemlich groß ist und seine Kunden nicht überragen möchte.
Er telefoniert mit einer Frau, jedenfalls nehme ich das an, bei all den Herzchen und Darlings und Kommentaren über den Kerl. Seine Stimme hat etwas Theatralisches und klingt herrisch, die letzten Hinweise auf seinen Cockneyakzent sind ausgebügelt, nur die Satzmelodie ist noch geblieben. In jungen Jahren hat Doug viel Zeit damit verbracht, seine Aussprache zu verbessern, um sich im Geschäft entsprechend gewählt ausdrücken zu können. Dann kamen die 60er, gewählt war nicht mehr angesagt, Dialekte kamen in Mode, und nicht zuletzt dank Michael Caine war Cockney wieder voll im Trend. Doch Doug hatte seine Aussprache ja nicht umsonst verbessert, also beließ er es dabei, während die mit der vornehmen Aussprache wegblieben und sich in vulgärem Ausdruck übten.
»Jetzt hör mal, Darling«, spricht Doug ins Telefon. »Tut mir leid zu hören, dass dein Kerl fremdgeht, ich mag euch ja beide. Aber sieh das doch mal so. Als ihr euch kennengelernt habt, da hatte er eine Frau, und du warst sein Seitensprung. Und dann legt er die eine Frau ab und heiratet seinen Seitensprung.« Kunstpause, denn er weiß, dass wir lauschen. »Und jetzt ist also eine Stelle frei, nicht, Darling?«
»Schneidern ist Schauspielerei«, erklärt Doug beim Lunch. »Niemand kommt zu mir, weil er einen Anzug braucht. Man kommt zu mir wegen des Kicks, weil man seine Jugend zurückhaben oder ein Schwätzchen halten will. Wissen die Kunden, was sie wollen? Natürlich nicht. Jeder kann sich anziehen wie Michael Caine, aber kann man sich anziehen wie Charles Laughton? Man ist für seinen Anzug verantwortlich. Neulich war hier ein Typ, der fragt mich, warum ich denn nicht Anzüge schneidere wie Armani. ›Hör mal‹, habe ich zu ihm gesagt, ›Armani macht bessere Armani-Anzüge als ich. Willst du Armani, dann geh zur Bond Street rüber, kauf dir einen und spar dir sechshundert Pfund.‹«
Ich nannte meinen Schneider Pendel, nicht Hayward, und das Buch trug den Titel Der Schneider von Panama, eine leise Verbeugung vor Beatrix Potters Die Geschichte vom armen Schneider. Ich stattete meine Figur mit einem halbjüdischen Hintergrund aus, denn wie schon bei den frühesten amerikanischen Filmemachern setzten sich auch unsere Schneiderdynastien aus Einwanderern aus Osteuropa zusammen. Den deutschen Namen Pendel erhielt er nach dem gleichnamigen Gegenstand, und ich verband damit ein Hin- und Herschwingen zwischen Wahrheit und Fiktion. Jetzt brauchte ich nur noch einen dekadenten, wohlgeborenen britischen Schuft, der meinen Schneider anheuert und ihn dazu einsetzt, sich die eigenen Taschen zu füllen. Für diese Rolle gab es allerdings für jemanden wie mich, der in Eton unterrichtet hat, Vorbilder in Hülle und Fülle.
26
Schläfer im eigenen Land
Es ist erst ein paar Jahre her, seit wir uns von ihm verabschiedeten, doch ich verrate Ihnen nicht, wann oder wo es war. Ich verrate Ihnen nicht, ob er eingeäschert oder begraben wurde, ob in der Stadt oder auf dem Land, ob er so oder anders hieß und ob es sich um eine Beerdigung nach christlichem oder einem anderen Ritus handelte.
Ich nenne ihn Harry.
Seine Frau, mit der er fünfzig Jahre verheiratet gewesen war, hielt sich bei seiner Beerdigung sehr aufrecht. Seinetwegen war sie in der Schlange vor dem Fischstand angespuckt worden, die Nachbarn hatten sie wegen ihm verspottet, die Polizei, die glaubte, ihre Pflicht zu erfüllen und damit die örtliche Brandfackel der kommunistischen Partei auszulöschen, war in ihr Haus eingebrochen.
Es gab auch ein Kind, nun schon erwachsen, das ähnliche Demütigungen in der Schule und der Zeit danach erdulden musste. Aber ich werde Ihnen nicht verraten, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte, und auch nicht, ob er oder sie eines der sicheren Fleckchen in der Welt gefunden hat, die Harry zu beschützen glaubte. Die Frau, nun seine Witwe, hielt sich genau auf die Art aufrecht, wie sie dies unter Druck gewohnt war, doch das erwachsene Kind war ganz geschlagen vor Kummer, wofür die Mutter nur offenkundige Verachtung übrighatte. Ein Leben voller Härten hatte sie gelehrt, viel Wert auf Haltung zu legen, und von ihrem Kind erwartete sie dasselbe.
Ich besuchte die Beerdigung, weil ich vor langer Zeit Harrys Vorgesetzter gewesen war. Das hatte höchstes Vertrauen verlangt, war zugleich aber auch äußerst heikel gewesen, da Harry von später Kindheit an alle Energie darauf gerichtet hatte, die vermeintlichen Feinde seines Landes dadurch zu stören, dass er einer von ihnen wurde. Harry hatte die Parteilinie so sehr verinnerlicht, dass sie ihm zur zweiten Natur geworden war. Er hatte seine Ansichten dermaßen angepasst, dass er kaum noch wusste, was er eigentlich glaubte. Mit unserer Hilfe hatte er trainiert, so zu denken und zu handeln wie der treueste Genosse, ohne lange zu überlegen. Stets erschien er mit einem Lächeln bei seinen wöchentlichen Besprechungen mit seinem Sachbearbeiter.
»Alles in Ordnung, Harry?«, fragte ich ihn.
»Alles bestens, danke. Und wie geht’s dir und deiner Frau?«
Harry hatte all die schmutzigen Parteijobs übernommen, abends und an den Wochenenden, die die anderen Genossen nur zu gern abgaben. Er hatte an den Straßenecken gestanden und den Daily Worker verkauft (oder auch nicht), hatte die unverkauften Exemplare weggeworfen und das Geld abgeliefert, das wir ihm für diese Exemplare gegeben hatten. Er hatte als Bote und Talentesucher für sowjetische Kulturattachés und Dritte Sekretäre des KGB gearbeitet und ihre öden Aufträge angenommen, Tratsch über die Industriebetriebe in der Gegend zu sammeln, in der er lebte. Und wenn ihm kein Tratsch zuflog, dann versorgten wir ihn damit, nachdem wir uns vergewissert hatten, dass er harmlos war.
Nach und nach stieg Harry durch Eifer und Hingabe für die Sache auf und wurde zu einem geschätzten Genossen, dem man halbkonspirative Aufgaben anvertraute, die auf dem Gebiet der Geheimdienste jedoch nur selten ins Gewicht fielen; er spielte sie bis zum Letzten durch, und wir mit ihm. Sein mangelnder Erfolg würde nichts zur Sache tun, versicherten wir ihm, er sei dennoch der richtige Mann an der richtigen Stelle, der unerlässliche Lauscher an der Wand. Wenn du nichts hörst, Harry, sagten wir ihm, dann ist das auch in Ordnung, dann heißt das, wir können nachts etwas ruhiger schlafen. Und Harry erwiderte darauf heiter, tja, John – oder wie immer ich mich auch nannte, einer muss ja die Drecksarbeit machen, richtig? Und wir antworteten, ja, Harry, einer muss sie machen, und wir sind dir dankbar dafür, dass du das machst.
Ab und zu taten wir so, als befänden wir uns in der virtuellen Welt der Agenten hinter den feindlichen Linien, vielleicht um seine Moral zu stärken: Wenn die Roten jemals kommen, Harry, und du wachst auf und bist auf einmal der große Hansdampf der Partei in deinem Bezirk – dann wirst du der Verbindungsmann zur Widerstandsbewegung, die diese Mistkerle wieder ins Meer zurückjagt. Und um die Phantasie zu beflügeln, holten wir sein Funkgerät aus dem Versteck auf dem Dachboden, staubten es ab und schauten zu, wie er unechte Nachrichten an ein angebliches Hauptquartier im Untergrund schickte und von dort unechte Befehle erhielt, und alles nur, um für den Fall der drohenden Besetzung Großbritanniens durch die Sowjets gewappnet zu sein. Uns war ein wenig unbehaglich zumute, Harry wohl ebenfalls, aber es gehörte nun mal zum Job, also machten wir weiter.
Seit ich die Welt der Geheimdienste verlassen habe, beschäftigten mich die Beweggründe, die Harry und seine Frau, ebenso wie andere Harrys und ihre Frauen, wohl antrieben. Psychiater hätten wohl ihre helle Freude an Harry gehabt, aber Harry wahrscheinlich auch mit ihnen. »Was soll ich denn Ihrer Meinung nach tun?«, hätte er sie gefragt. »Soll ich denn zulassen, dass mir die Partei das gottverdammte Land unter der Nase wegstibitzt?«
Harry hatte keine Freude an diesem falschen Spiel. Er betrachtete es als notwendige Last seiner Berufung. Wir gaben ihm einen Hungerlohn, doch hätten wir ihn besser bezahlt, dann wäre es ihm peinlich gewesen. Außerdem hätte er mit dem Geld nie etwas anfangen können. Also gaben wir ihm ein kleines privates Einkommen und eine winzige Pension und nannten es Abfindung, und wir legten so viel Respekt und Freundschaft obendrauf, wie wir aus Sicherheitsgründen verantworten konnten. Im Laufe der Jahre wandten sich Harry und seine Frau, die ganz in der Rolle der Frau des guten Genossen aufging, heimlich dem Glauben zu. Der Priester der Religion, der sie anhingen, scheint sich wohl nie gefragt zu haben, warum zwei derart passionierte Kommunisten zu ihm kamen und beteten.
Als Harrys Beerdigung vorüber war und Freunde, Familie und Genossen sich zerstreut hatten, trat ein Mann mit freundlicher Miene in Regenmantel und mit schwarzer Krawatte an meinen Wagen und gab mir die Hand. »Ich bin vom Büro«, murmelte er schüchtern. »Harry ist schon der Dritte diesen Monat. Sie scheinen alle gleichzeitig das Zeitliche zu segnen.«
Harry war einer aus der armen verfluchten Infanterie der ehrenwerten Männer und Frauen, die glaubten, dass die Kommunisten es darauf abgesehen hatten, das Land zu vernichten, welches sie liebten, und das Gefühl hatten, lieber etwas dagegen unternehmen zu sollen. Er hielt die Roten in ihrer Art für nette Leute, Idealisten, aber auf dem Holzweg. Also setzte er sein Leben für das ein, woran er glaubte, und starb als unbekannter Soldat des Kalten Krieges. Die Praxis, Spione in angeblich subversive Organisationen einzuschleusen, ist so alt wie die Welt. Wie J. Edgar Hoover mit ungewöhnlichem Witz sagte, als er die Neuigkeit hörte, dass Kim Philby ein sowjetischer Doppelagent war:
»Sagt ihnen, Jesus hatte nur zwölf Jünger, aber einer davon war ein Doppelagent.«
Wenn wir heute von Polizisten lesen, die sich in Friedens- oder Tierschutzorganisationen einschleusen, sich unter falschem Namen Liebhaberinnen nehmen und Kinder kriegen, dann stößt uns das ab, weil wir sofort wissen, dass die Ziele niemals eine solche Täuschung oder gar den Verlust von Menschenleben rechtfertigen. Gott sei Dank hat Harry so nicht gearbeitet, und er glaubte fest daran, dass seine Arbeit moralisch gerechtfertigt war. Er betrachtete den internationalen Kommunismus als Feind des Landes und dessen britischen Ableger als Feind im eigenen Lager. Kein einziger britischer Kommunist, den ich jemals kennengelernt habe, hätte dieser Ansicht zugestimmt. Das britische Establishment tat dies sehr wohl; für Harry war das Grund genug.
27
Die Jagd auf Warlords
Der Roman hatte alles, sogar einen Titel: Geheime Melodie. Er spielte in London und im östlichen Kongo und drehte sich um eine Hauptfigur namens Salvo, kurz für Salvador, Sohn eines sündigen irischen Missionars und der Tochter eines kongolesischen Stammesführers. Salvo war von Kindesbeinen an durch übereifrige christliche Missionare einer Gehirnwäsche unterzogen und zugleich für die angeblichen Sünden seines Vaters zum Außenseiter gestempelt worden, es fiel mir also nicht schwer, mein Herzblut in diese Figur zu stecken und mich mit ihr zu identifizieren.
Ich hatte drei kongolesische Warlords erfunden, jeder von ihnen Bannerträger des Stammes oder der gesellschaftlichen Gruppe, die ihn hervorgebracht hatte. Ich hatte getrennt voneinander ein ganzes Aufgebot an britischen und südafrikanischen Söldnern beköstigt und einen Plot entwickelt, der offen genug angelegt war, um den Bedürfnissen und Eigenheiten der Charaktere angepasst zu werden, je weiter er sich entwickelte.
Es gab da eine wunderhübsche kongolesische Krankenschwester, mit Wurzeln in Kivu, die in einem Krankenhaus im Osten von London arbeitete und sich danach sehnte, zu ihrem Volk zurückzukehren. Ich war durch die Gänge ihres Krankenhauses gestrichen, hatte in den Wartebereichen gesessen und die Ärzte und Krankenschwestern kommen und gehen gesehen. Ich hatte die Schichtwechsel beobachtet und war in respektvollem Abstand den Gruppen müder Krankenschwestern gefolgt, die in ihre Wohnviertel und Unterkünfte zurückkehrten. In London und Ostende hatte ich viele intensive Stunden mit einer ganzen Schar heimlicher kongolesischer Exilanten verbracht und mir ihre Geschichten über Massenvergewaltigungen und Verfolgungen angehört.
Die Sache hatte nur einen Haken. Ich selbst war noch nie in dem Land gewesen, das ich da beschrieb, und ich wusste so gut wie nichts über die einheimische Bevölkerung. Die drei kongolesischen Warlords, die Maxie, mein oberster Söldner, in einen Einsatz verwickelt hatte, um die Macht in Kivu zu übernehmen, waren keine echten Figuren, nur Phantombilder, die aus Hörensagen und meiner eigenen um keinerlei Wissen ergänzten Vorstellungskraft resultierten. Und was die große Provinz Kivu selbst und deren Hauptstadt Bukavu anging, waren das für mich Phantasieorte, zusammengeschustert aus alten Reiseführern und dem Internet. Das ganze Konstrukt hatte ich zu einem Zeitpunkt in meinem Leben entwickelt, als ich aus familiären Gründen nicht reisen konnte. Erst später war ich in der Lage zu tun, was ich schon ein Jahr zuvor hätte tun sollen: hinfahren.
Die Verlockung war unwiderstehlich. Bukavu, zu Beginn des 20. Jahrhunderts von belgischen Kolonialisten am südlichen Ufer des Kivusees angelegt, dem höchstgelegenen und kühlsten der großen Seen Afrikas, mutete an wie das verlorene Paradies. Ich hatte wilde Vorstellungen von einem nebligen Shangri-La aus breiten, von Bougainvilleen gesäumten Straßen und Villen mit üppigen Gärten an den Hängen zum Seeufer. Die Vulkanerde der umliegenden Hügel ist so fruchtbar, verrieten mir die Reiseführer, das Klima so günstig, dass sich kaum eine Pflanze, ob Frucht, Blume oder Gemüse, finden lässt, die dort nicht gedeiht.
Der Osten des Kongo ist aber zugleich eine Todesfalle. Auch das hatte ich mir angelesen. Über Jahrhunderte hinweg hatten die Reichtümer alle möglichen Arten von menschlichen Beutegreifern angelockt, von marodierenden ruandischen Milizen bis hin zu betrügerischen Firmenvertretern mit Hochglanzbüros in London, Houston, Sankt Petersburg oder Peking. Seit dem Völkermord in Ruanda bildete Bukavu das Zentrum der Flüchtlingskrise. Hutu-Rebellen, die aus Ruanda über die Grenze flohen, hatten die Stadt als Basis genutzt, um an jener Regierung Rache zu üben, die sie hinausgejagt hatte. Im Ersten Kongokrieg wurde die Stadt in Schutt und Asche gelegt.
Wie sah es also jetzt dort aus? Und wie fühlte es sich an, dort zu sein? Bukavu war die Geburtsstadt meines Helden Salvo. Irgendwo im Busch in der Nähe lag das katholische Seminar, wo Salvos Vater gewohnt hatte, der sündige irische Priester mit dem großen Herzen, der den Reizen einer Stammesfrau erlegen war. Es wäre doch nett, auch das Seminar zu finden.
Ich hatte Auf den Spuren von Mr. Kurtz von Michela Wrong gelesen und schätzte das Buch. Wrong hatte in Kinshasa gelebt, der Hauptstadt des Kongo, und insgesamt zwanzig Jahre auf dem afrikanischen Kontinent verbracht. Sie hatte in der Zeit nach dem Völkermord für Reuters und die BBC aus Ruanda berichtet. Ich lud sie zum Essen ein. Ob sie mir weiterhelfen könne? Vielleicht. Ob sie mich vielleicht sogar nach Bukavu begleiten würde? Vielleicht, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Jason Stearns müsse ebenfalls mitkommen.
Mit neunundzwanzig war Jason Stearns, polyglotter Afrikakenner, Senior Analyst bei der International Crisis Group. Ich konnte es kaum glauben, aber Stearne hatte tatsächlich drei Jahre lang als politischer Berater für die Vereinten Nationen in Bukavu gedient. Er sprach perfekt Französisch, Suaheli und eine ganze Reihe weiterer afrikanischer Sprachen. Stearne war einer der führenden Kongo-Experten im Westen.
Wie sich herausstellte, verfolgten Jason und Michela ihre eigenen professionellen Ziele im östlichen Kongo. Sie willigten ein, ihre Besuche mit meinen abzustimmen. Sie kämpften sich durch einen peinlichen frühen Entwurf meines Romans und wiesen mich auf die zahlreichen Fehler hin. Dennoch vermittelte die Lektüre ihnen eine Vorstellung von den Personen, die ich kennenlernen, von den Orten, die ich aufsuchen wollte. Oben auf meiner Liste standen die drei Warlords, dann kamen die katholischen Missionare, Seminare und Schulen aus Salvos Kindheit.
Der Rat des britischen Außenministeriums war eindeutig: keine Reiseempfehlung für den östlichen Kongo. Jason hatte sich allerdings selbst umgehört und berichtete, dass es in Bukavu relativ ruhig war, wenn man bedachte, dass die Demokratische Republik Kongo die ersten Mehrparteienwahlen seit einundvierzig Jahren abhalten wollte und eine gewisse Nervosität in der Luft lag. Für meine beiden Begleiter war dies die beste Reisezeit, für mich und meine Figuren ebenfalls, denn der Roman spielte genau im Vorfeld dieser Wahlen. Es war 2006, zwölf Jahre nach dem Völkermord in Ruanda.
Im Rückblick schäme ich mich ein wenig dafür, die beiden dazu überredet zu haben, mich überhaupt mitzunehmen. Wenn etwas schiefgegangen wäre, und damit war in Kivu praktisch zwingend zu rechnen, dann hätten sie außerdem noch die Verantwortung für einen nicht sehr agilen, weißhaarigen Mittsiebziger zu schultern gehabt.
Lange bevor unser Jeep Kigali, die Hauptstadt Ruandas, verlassen hatte und die Grenze zum Kongo erreichte, war meine Phantasiewelt verblasst und der Wirklichkeit gewichen. Das Hôtel des Mille Collines in Kigali, das Hotel Ruanda im gleichnamigen Film, wirkte bedrückend alltäglich. Vergeblich sah ich mich nach einem Erinnerungsfoto des Schauspielers Don Cheadle oder seiner Filmfigur Paul Rusesabagina um, die auf dem realen Hoteldirektor basierte, der 1994 das Mille Collines in einen heimlichen Zufluchtsort für Tutsis verwandelt hatte, die vor dem Schrecken der Pangas und der Gewehre flohen.
Doch in den Köpfen derer, die nun an der Macht waren, wirkte diese Geschichte nicht mehr nach. Schon nach zehn Minuten im Land konnte man mühelos erkennen, dass die von Tutsis geführte Regierung alles fest im Griff hatte. Durch die Scheiben unseres Wagens, der sich über die Hügel in Richtung Bukavu schlängelte, erhaschten wir Blicke auf die ruandische Justiz bei der Arbeit. Auf gepflegten Almen, die man in ähnlicher Form in einem Tal in der Schweiz hätte finden können, saßen Dorfbewohner im Kreis wie Schulkinder an einem Sommertag. In ihrer Mitte, dort wo der Lehrer stehen würde, waren hier in Gefängnisrosa gekleidete Männer, die gestikulierten oder die Köpfe gesenkt hielten. Um dem Rückstau an des Völkermords Verdächtigen beizukommen, hatte Kigali die traditionellen Dorfgerichte wieder eingesetzt. Jeder konnte klagen, jeder sich verteidigen. Die Richter wurden allerdings von der neuen Regierung bestimmt.
Eine Stunde von der kongolesischen Grenze entfernt verließen wir die Straße und stiegen auf einen Hügel, um einen Blick auf einige Opfer der génocidaires zu werfen. Eine ehemalige weiterführende Schule lag hoch über liebevoll gepflegten Tälern. Der Kurator dort, selbst einer der wenigen Überlebenden, führte uns von einem Klassenzimmer ins nächste. Die Toten – Hunderte, ganze Familien, die sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, nämlich angeblich zu ihrem eigenen Schutz, dort versammelt hatten und einer nach dem anderen getötet worden waren – lagen in Vierer- und Sechsergruppen auf Holzpaletten und waren mit einer Paste eingestrichen worden, die an mit Wasser verrührtes, verklumptes Mehl erinnerte. Eine Frau mit Mundschutz und Eimer trug immer neue Schichten auf. Wie lange würde sie die Körper noch bestreichen? Wie lange würden die Leichen bestehen können? Viele der Toten waren Kinder. In einem Land, in dem die Bauern selbst schlachten, war die Tötungstechnik ganz selbstverständlich gewesen: Erst durchtrennt man die Sehnen, dann lässt man sich Zeit. Hände, Arme und Füße lagerten getrennt in Körben. Zerrissene, vor getrocknetem Blut braune Kleidung, meist in Kindergröße, hing von den Traufen einer riesigen Versammlungshalle.
»Wann begraben Sie sie?«
»Wenn sie ihr Werk getan haben.«
Ihr Werk war ein Beweis dafür, dass dies alles tatsächlich geschehen war.
Es gibt niemanden, der den Opfern Namen geben oder um sie trauern kann, keinen, der sie beerdigen kann, erklärte der Kurator. Auch die Trauernden sind tot. Wir lassen die ausgestellten Leichen zurück, auf dass sie die Zweifler und Leugner zum Schweigen bringen.
Entlang der Straße tauchen ruandische Truppen in grünen, den amerikanischen nachempfundenen Uniformen auf. Der kongolesische Grenzposten ist nur eine baufällige Hütte auf der anderen Seite einer Eisenbrücke, die über einen Mündungsarm des Ruzizi führt. Eine Gruppe weiblicher Beamter betrachtet stirnrunzelnd unsere Pässe und Impfausweise, sie schütteln die Köpfe und beraten sich. Je chaotischer das Land, desto unnachgiebiger dessen Bürokratie.
Aber wir haben ja Jason.
Eine Tür der Hütte wird aufgeschlagen, Freudenschreie sind zu hören. Jason verschwindet. Unter fröhlichen Willkommensgrüßen erhalten wir unsere Dokumente zurück. Wir verabschieden uns von der makellosen Asphaltierung in Ruanda und hüpfen fünf Minuten lang über riesige Schlaglöcher im roten Schlamm von Kivu bis zu unserem Hotel. Jason ist ein Meister der afrikanischen Dialekte, genau wie mein Salvo. Bei leidenschaftlichen Diskussionen macht er erst mit und besänftigt die Beteiligten dann mit seinen Worten. Das ist keine Taktik, sondern geschieht ganz instinktiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass Salvo – Kind des Konflikts, geborener Schlichter – genauso agiert.
In jedem Krisengebiet, in dem ich gewesen bin, hat es immer ein Hotel gegeben, in dessen Bar sich, wie auf ein geheimes Zeichen hin, die Schmierfinken, Spione, Entwicklungshelfer und Schwindler treffen. In Saigon war es das Continental, in Phnom Penh das Phnom, in Vientiane das Constellation, in Beirut das Commodore. Hier in Bukavu ist es das Orchid, eine niedrige Kolonialvilla hinter Toren am Ufer gelegen, umgeben von einigen unauffälligen Hütten. Der Besitzer ist ein welterfahrener belgischer colon, der wohl in einer der kriegerischen Auseinandersetzungen in Kivu verblutet wäre, wenn ihn sein mittlerweile verstorbener Bruder nicht hinausgeschmuggelt hätte. In einer Ecke des Speisesaals sitzt eine ältere deutsche Dame, die sich wehmütig mit den anwesenden Fremdlingen über die Zeit unterhält, als Bukavu noch ganz weiß war und sie mit ihrem Alfa mit hundert Sachen über den Boulevard bretterte. Am nächsten Morgen folgen wir ihrer Route, wenn auch nicht mit hundert Sachen.
Der Boulevard ist breit und verläuft gerade, doch wie alle Straßen in Bukavu ist er zerfurcht von dem Regenwasser, das die Hügelflanken hinunterströmt. Die Häuser weisen die zerfallene Pracht des Art Noveau auf, gerundete Ecken, hohe Fenster und Veranden, die an alte Kinoorgeln erinnern. Die Stadt steht auf fünf Halbinseln, »eine grüne, in den See getauchte Hand«, wie es in der schwärmerischeren Sorte von Reiseführern heißt. Die größte und einst die eleganteste der Halbinseln ist La Botte, wo Mobutu, der verrückte Herrscher von Zaire, eine seiner vielen Villen hatte. Den Soldaten zufolge, die uns den Zugang verwehren, wird die Villa gerade für den neuen kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila eingerichtet, in Kivu geborener Sohn eines marxistisch-maoistischen Revolutionärs. 1997 hatte Kabilas Vater Mobutu aus dem Amt gejagt, nur um vier Jahre später von der eigenen Leibwache umgebracht zu werden.
Eine leichte Schwüle hüllt den See ein. Dieser wird der Länge nach durch die Grenze zu Ruanda geteilt. Die Spitze von La Botte zeigt ostwärts. Die Fische hier sind recht klein. Das Seeungeheuer heißt mamba mutu und ist halb Frau, halb Krokodil. Am liebsten frisst es Menschenhirn. Ich lausche meinem Fremdenführer und schreibe alles mit, obwohl ich weiß, dass ich nichts davon verwenden werde. Fotoapparate sind nichts für mich. Wenn ich mir etwas notiere, dann speichert mein Gedächtnis den Gedanken. Mache ich Fotos, bringt mich der Apparat um meine Erinnerung.
Wir betreten ein katholisches Seminar. Salvos Vater war hier einer der Brüder. Die fensterlosen Mauern heben sich von den Gebäuden ringsherum deutlich ab. Hinter den Mauern liegt eine Welt voller Gärten, Satellitenschüsseln, Gästezimmern, Konferenzräumen, Computern, Bibliotheken und stummen Dienern. Im Speiseraum schlurft ein alter weißer Priester in Jeans zum Kaffeespender, wirft uns einen langen, weltabgewandten Blick zu und verschwindet. Wenn Salvos Vater noch leben würde, denke ich, dann könnte er heute vielleicht so aussehen.
Ein kongolesischer Priester in braunem Habit klagt darüber, dass seine afrikanischen Mitbrüder Büßern ausgesetzt sind, die ihren ethnischen Hass nur allzu redegewandt verbreiten. In ihrem Eifer, sagt er, neigen seine Brüder dazu, sich zu den schlimmsten Extremisten von allen zu entwickeln. So war es möglich, dass es in Ruanda Priester gab, die alle Tutsis der Gemeinde in die Kirche riefen, um dann das Gebäude mit dem Segen des leitenden Priesters in Brand zu stecken oder von Bulldozern plattwalzen zu lassen.
Er spricht, ich schreibe mit, nicht seine goldenen Worte, wie er wohl vermutet, sondern wie er spricht: die langsame kehlige Eleganz seines gebildeten afrikanischen Französisch und die Traurigkeit, mit der er uns die Sünden seiner Mitbrüder schildert.
Thomas ähnelt meiner Version von ihm so gar nicht, dass ich wieder mal gezwungen bin, alle meine Vorurteile über Bord zu werfen. Er ist groß und charmant und trägt einen gut geschnittenen blauen Anzug. Er empfängt uns mit vollendeter diplomatischer Leichtigkeit. Sein von Männern mit halbautomatischen Waffen bewachtes Haus ist groß und repräsentativ. Während wir uns unterhalten, läuft auf dem riesigen Fernseher stumm Fußball. In meinen von keinerlei echtem Wissen getrübten Vorstellungen sieht ein Warlord anders aus.
Thomas ist Banyamulenge. Sein Volk hat in den vergangenen zwanzig Jahren unaufhörlich Krieg geführt. Eigentlich sind sie Viehhüter, die ursprünglich aus Ruanda kamen und sich in den letzten Jahrhunderten auf dem Hochplateau der Mulenge-Berge in Süd-Kivu ansiedelten. Sie sind bekannt für ihre Kampfkunst und ein Leben in Zurückgezogenheit, werden für ihre angebliche Nähe zu Ruanda gehasst und sind die Ersten, auf die man sich in unruhigen Zeiten stürzt.
Ich frage ihn, ob sich seines Erachtens nach den kommenden Mehrparteienwahlen die Lage für sie verbessern wird. Seine Antwort fällt nicht gerade vielversprechend aus. Die Verlierer werden sagen, dass die Wahl gefälscht ist, und sie werden recht haben. Die Gewinner werden alles an sich reißen, und den Banyamulenge wird mal wieder die ganze Schuld zugeschoben. Nicht ohne Grund nennt man sie die Juden Westafrikas. Wenn etwas verkehrt läuft, dann ist das die Schuld der Banyamulenge. Ähnlich unbeeindruckt zeigt sich Thomas gegenüber Kinshasas Bemühungen, die Milizen im Kongo zu einer Nationalarmee zu verschmelzen:
»Viele unserer jungen Männer sind zur Armee gegangen und dann in die Berge abgehauen. In der Armee beleidigen und töten sie uns, obwohl wir viele Schlachten für sie geschlagen und gewonnen haben.«
Es gibt allerdings einen Hoffnungsschimmer, räumt Thomas ein. Die Mai-Mai, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kongo von allen ›Fremden‹ zu befreien – vor allem den Banyamulenge –, erfahren gerade, wie hoch der Preis dafür ist, Soldat in Kinshasa zu werden. Thomas führt das nicht näher aus.
»Wenn die Mai-Mai anfangen, Kinshasa zu misstrauen, werden sie sich uns vielleicht annähern.«
Das werden wir herausfinden, denn Jason hat ein Treffen mit meinem zweiten Warlord arrangiert, einem Colonel der Mai-Mai, der größten und berüchtigtsten der vielen Milizen im Kongo.
Genau wie Thomas ist der Colonel einwandfrei gekleidet, doch trägt er keinen gut geschnittenen blauen Anzug, sondern die von Kinshasa ausgegebene Ausgehuniform der vielgescholtenen Nationalarmee des Kongo. Sein Drillich ist gebügelt und gestärkt, seine Rangabzeichen glitzern in der Mittagssonne, Goldringe an allen Fingern der rechten Hand. Auf dem Tisch vor ihm liegen zwei Handys. Wir sitzen in einem Straßencafé. Von einer mit Sandsäcken geschützten Stellung auf der anderen Straßenseite beobachten uns pakistanische Blauhelme der Vereinten Nationen über ihre Gewehrläufe hinweg. Kämpfen, das war mein Leben, berichtet der Colonel. Zu seiner Zeit befehligte er Kämpfer, von denen manche erst acht gewesen waren. Heute sind es nur noch Erwachsene.
»In meinem Land gibt es ethnische Gruppen, die kein Recht haben, hier zu sein. Wir bekämpfen sie, weil wir befürchten, dass sie unser heiliges kongolesisches Land für sich beanspruchen. Diese Aufgabe kann man keiner Regierung in Kinshasa überlassen, das machen wir lieber selbst. Als Mobutu scheiterte, da standen wir mit Pangas, Pfeil und Bogen in der Bresche. Die Mai-Mai sind eine Macht, die von unseren Vorfahren geschaffen wurde. Unser dawa ist unser Schild.«
Mit dawa meint er die Zauberkräfte der Mai-Mai, die es ihnen ermöglichen, Kugeln abzulenken oder in Wasser zu verwandeln: in Mai.
»Wenn man einer AK-47 gegenübersteht und direkt beschossen wird und nichts passiert, dann weiß man, dass unser dawa wirkt.«
Wenn das so ist, frage ich so vorsichtig wie nur möglich, wie erklären die Mai-Mai dann ihre Toten und Verwundeten?
»Wenn einer unserer Krieger niedergestreckt wird, dann, weil er ein Dieb oder Vergewaltiger ist oder unsere Rituale missachtet oder böse Gedanken gegenüber einem Kameraden gehegt hat, als er in den Kampf zog. Unsere Toten sind unsere Sünder. Sie werden von unseren Medizinmännern ohne Zeremonie begraben.«
Und die Banyamulenge? Was hält der Colonel im gegenwärtigen politischen Klima von ihnen?
»Wenn sie wieder einen Krieg anzetteln, werden wir sie töten.«
Doch als er seinem Hass auf Kinshasa Ausdruck verleiht, kommt er den Ansichten, die sein erklärter Erzfeind Thomas am Abend zuvor vertreten hat, näher, als er wissen kann:
»Die salauds in Kinshasa haben die Mai-Mai an den Rand gedrängt. Sie vergessen, dass wir für sie gekämpft und ihnen die fetten Ärsche gerettet haben. Sie bezahlen uns nicht, und sie hören nicht auf uns. Solange wir Soldaten sind, lassen sie uns nicht zur Wahl. Besser, wir gehen in den Busch zurück. Was kostet ein Computer?«
Es war an der Zeit, mit Blick auf die Actionszene am Ende meines Romans zum Flughafen Bukavu hinauszufahren. Im Laufe der Woche hatte es Unruhen und ein paar Schießereien gegeben. Noch immer galt die Ausgangssperre. Die Straße zum Flughafen wurde von den Mai-Mai kontrolliert, aber Jason meinte, die Route sei ungefährlich, er hatte wohl mit dem Colonel eine sichere Durchfahrt vereinbart, nahm ich an. Wir wollten gerade aufbrechen, da bekamen wir mit, dass das Stadtzentrum trotz der Ausgangssperre durch Demonstranten und brennende Reifen blockiert wurde. Wir hörten, dass ein Mann sein Haus mit vierhundert Dollar beliehen hatte, um seiner Frau eine Operation zu ermöglichen, doch als Kinshasas Soldaten, die auf ihr Geld warteten, davon erfuhren, brachen sie bei ihm ein, töteten ihn und raubten das Geld. Wutentbrannte Nachbarn hatten sich die Soldaten vorgenommen und sie eingesperrt, doch deren Kameraden hatten Verstärkung geschickt, um sie zu befreien. Dabei war eine Fünfzehnjährige erschossen worden, und die Menge tobte.
Nach einer schwindelerregenden Fahrt über holprige Nebenstraßen kamen wir zur Straße nach Goma und fuhren nordwärts am Westufer des Kivusees entlang. Der Flughafen war in letzter Zeit schwer umkämpft gewesen. Eine ruandische Miliz hatte ihn besetzt gehalten und konnte sich dort mehrere Monate halten, bevor die Vertreibung gelang. Jetzt stand der Flughafen unter der gemeinsamen Kontrolle von indischen und uruguayischen UN-Truppen. Die Uruguayer bewirteten uns fürstlich und drängten uns, doch bald zu einer richtigen Party wieder vorbeizuschauen.
»Was würden Sie tun«, fragte ich unseren uruguayischen Gastgeber, »wenn die Ruander zurückkommen?«
»Vamos«, antwortete er ohne Zögern: nichts wie weg.
Eigentlich wollte ich wissen, was seine Kameraden und er wohl tun würden, wenn ein Haufen schwerbewaffneter weißer Söldner unangekündigt landete, wie es in meinem Roman geschieht. Ich zögere zwar, meine Vermutung rundheraus auszusprechen, aber eigentlich hatte ich keine Zweifel, dass auch in dem Fall seine Antwort nicht anders gelautet hätte.
Wir besichtigten den Flughafen und fuhren zurück in die Stadt. Die rote Schotterstraße erlebte einen tropischen Sturzregen. Hinter einem Hügel stießen wir auf einen sich schnell bildenden See, wo vor ein paar Stunden noch ein Parkplatz gewesen war. Ein Mann in einem schwarzen Anzug stand auf dem Dach seines absaufenden Wagens und fuchtelte hilfesuchend mit den Armen, sehr zum Vergnügen der sich rasch einfindenden Gaffer. Die Ankunft unseres mit zwei weißen Männern und einer weißen Frau besetzten Jeeps trug noch zur Belustigung bei. In null Komma nichts hatte sich eine Schar von Kindern darangemacht, uns von einer Seite zur andern zu schaukeln. In ihrem Übermut hätten sie uns bald in den See geschaukelt, wenn Jason nicht hinausgesprungen wäre und, da er deren Sprache beherrschte, mitlachte und sie besänftigte.
Für Michela war diese Szene so normal, dass sie sich im Nachhinein nicht mehr daran erinnert. Ich mich aber schon.
Meine letzte, bewegendste Erinnerung an Bukavu ist die an einen Nachtclub. In meinem Buch gehört er dem in Frankreich ausgebildeten Erben eines ostkongolesischen Handelsimperiums, der später zu Salvos Retter wird. Auch er ist eine Art Warlord, doch seine Machtbasis liegt bei den jungen Intellektuellen und Geschäftsleuten von Bukavu: In seinem Club treffen sie sich alle.
Wieder gilt die Ausgangssperre, und in der Stadt ist es totenstill. Es regnet. Ich kann mich an keine blinkende Leuchtreklame, keine bulligen Männer erinnern, die uns am Eingang zum Nachtclub durchsuchten, nur an eine Reihe von kleinen Kinos, die im Dunkeln verschwinden, und ein Tau als Treppengeländer neben einer schwach erleuchteten Treppe nach unten. Wir tasten uns voran. Musik und Stroboskoplichter verschlucken uns. Stimmen: »Jason!«, und schon verschwindet er in einem Meer von ihn willkommen heißenden schwarzen Armen.
Der Kongolese, so verriet man mir, weiß besser als jeder andere, wie man Spaß haben kann, und hier haben sie Spaß. Neben der Tanzfläche ist ein Poolbillardspiel im Gang, und ich schließe mich den Zuschauern an. Atemlose Stille begleitet jeden Stoß. Die letzte Kugel wird versenkt. Unter Freudengeschrei wird der Sieger in die Höhe gehoben und johlend durch den Raum getragen. An der Bar sitzen hübsche Mädchen, unterhalten sich und lachen. An unserem Tisch höre ich jemandem zu, der uns seine Ansichten zu Voltaire – oder war es Proust? – mitteilt. Michela wimmelt höflich einen Betrunkenen ab. Jason hat sich zu den Männern auf der Tanzfläche gesellt. Ich überlasse ihm das letzte Wort:
»Der Kongo hat ja jede Menge Probleme, aber auf den Straßen von Bukavu begegnet man weniger deprimierten Leuten als in New York.«
Ich hoffe, der Satz ist in meinem Roman, aber es ist schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Der östliche Kongo steht für meine letzte Expedition auf die Schlachtfelder dieser Welt. Wird der Roman der Erfahrung dort gerecht? Natürlich nicht. Doch was ich dort lernte, war fesselnder, als ein Buch sein kann.
28
Richard Burton braucht mich
Jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, an meine erste Begegnung mit Martin Ritt zu denken, den bewährten amerikanischen Filmregisseur, der Der Spion, der aus der Kälte kam drehte, werde ich rot, kaum dass ich mir den albernen Aufzug vor Augen halte, in dem ich zu unserem Treffen kam.
1963. Mein Roman war noch gar nicht erschienen. Ritt hatte die Filmrechte daran aber schon aufgrund eines irrlaufenden Typoskripts gekauft, das er von meinem Agenten oder Verleger oder vielleicht von einem cleveren Mitarbeiter in irgendeinem Kopierbüro hatte, der jemanden im Paramount-Filmstudio kannte. Später prahlte Ritt damit, dass er die Rechte praktisch geklaut hätte. Ich gab ihm recht. Damals jedoch betrachtete ich ihn als ungeheuer großzügigen Menschen, der mit einer Gruppe Gleichgesinnter den Weg von Los Angeles auf sich genommen hatte, um mich im Connaught Hotel, jenem Tempel an edwardianischem Luxus, zum Essen einzuladen und mein Buch zu loben.
Ich wiederum war extra auf Kosten Ihrer Majestät der Queen aus Bonn angereist. Ich war zweiunddreißig, diente als Diplomat und kannte niemanden aus dem Filmgeschäft. In meiner Kindheit war ich, wie alle Jungs in meinem Alter, in Deanna Durbin verknallt gewesen und hatte mich bei den Three Stooges vor Lachen gekugelt. In den Kinos zu Kriegszeiten hatte ich deutsche Flugzeuge abgeschossen, die Eric Portman steuerte, und mit Leslie Howard über die Gestapo triumphiert. (Mein Vater war davon überzeugt, dass Portman ein Nazi war, der dringend eingesperrt gehörte.) Doch nun war ich verheiratet, Vater kleiner Kinder, verfügte nur über sehr wenig Geld und war somit kein großer Kinogänger mehr. Ich hatte einen liebenswürdigen Literaturagenten in London, dessen Traum es war, Schlagzeuger in einer Jazzband zu werden, wenn er sich nur getraut hätte. Was das Filmgeschäft betraf, so wusste er wohl mehr als ich, wenn auch nicht sehr viel mehr, nehme ich an. Immerhin hatte er das Geschäft eingefädelt, und ich hatte den Vertrag nach einem netten Essen mit ihm unterzeichnet.
Wie schon berichtet, gehörte es zu meinen Aufgaben als Zweiter Sekretär an der britischen Botschaft in Bonn, deutsche Würdenträger auf ihren Stippvisiten bei der britischen Regierung und der parlamentarischen Opposition zu begleiten, darum war ich nach London gekommen. Das erklärt, warum ich ein enges schwarzes Jackett, dazu eine schwarze Weste, silberne Krawatte und gestreifte grauschwarze Hose trug, also einen Stresemann, benannt nach dem preußischen Staatsmann, den der Tod ereilte, als er für kurze Zeit Präsident der Weimarer Republik war. In diesem Aufzug verdrückte ich mich von meinen eigentlichen Aufgaben, um mit Martin Ritt im Connaught zu essen. Das erklärt auch, warum sich Ritt in lärmender Heiterkeit bei mir erkundigte, während wir uns die Hände schüttelten, warum zum Teufel ich mich wie ein maître d’hôtel angezogen hätte.
Und was trug Ritt selbst, dass er meinte, sich das Recht herausnehmen zu können, mich derart zu provozieren? Im Restaurant des Connaught herrschten strenge Kleidervorschriften. Im Grill Room jedoch war man bis 1963, wenn auch nur widerwillig, dazu übergegangen, ein Auge zuzudrücken. Martin Ritt, siebzehn Jahre älter und mehrere Jahrhunderte erfahrener als ich, hockte in einer Ecke des Grill Room, flankiert von vier ergrauten Vasallen der Filmindustrie, trug das schwarze Hemd eines Revolutionärs, zugeknöpft bis zum Kragen, und eine ausgebeulte, an den Knöcheln endende Hose mit Hosenträgern. Das Ungewöhnlichste an ihm aber war die Schiebermütze auf seinem Kopf, deren Schirm nach oben, nicht nach unten gebogen war. Im Grill Room, wohlgemerkt, wo ein solcher Aufzug in meinem diplomatischen England jener Zeit ebenso wenig akzeptabel war, wie Erbsen mit dem Messer zu essen. All dies am bärenhaften Körper eines alten Fußballers, der etwas Fett angesetzt hatte, mit einem breiten, braunen, von den Jahren gezeichneten osteuropäischen Gesicht, nach hinten gekämmten grauen Haaren und umschatteten, aufmerksam um sich blickenden Augen, die von einem schwarzen Brillengestell eingerahmt wurden.
»Und, hab ich nicht gesagt, er ist noch jung?«, sagte er zu seinen Vasallen, während ich mich damit abmühte zu erklären, warum zum Teufel ich mich wie ein maître d’hôtel kleidete.
Hast du, hast du, versicherten sie ihm, denn Filmregisseure, wie ich mittlerweile weiß, haben immer recht.
Marty Ritt hat sogar noch mehr recht als die meisten anderen. Er war ein versierter Regisseur mit großem Herzen und einer geradezu beängstigenden Bandbreite an Lebenserfahrung. Er hatte im Zweiten Weltkrieg in der US Army gedient. Er war zwar kein Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen, gehörte aber zu den entschlosseneren Sympathisanten. Seine unerschütterliche Bewunderung für Karl Marx hatte ihn auf die Schwarze Liste der Fernsehbranche gebracht, in der er zuvor einen hohen Ruf als Schauspieler und Regisseur genossen hatte. Er führte in einer ganzen Reihe von Theatern Regie, die meisten davon waren links orientiert, darunter auch bei einer Show im Madison Square Garden zugunsten des Russian War Relief. Er hatte nacheinander zehn Kinofilme gedreht, erst ein Jahr zuvor Der Wildeste unter Tausend mit Paul Newman. Kaum hatten wir Platz genommen, machte er keinen Hehl aus der Tatsache, dass mein Roman für ihn einen Scheidepunkt darstellte. Einen Scheidepunkt zwischen seinen früheren Überzeugungen und seiner jetzigen ohnmächtigen Abscheu gegenüber McCarthys Regime, gegenüber der Feigheit zahlreicher seiner Kollegen und Genossen im Zeugenstand, sowie des Scheiterns des Kommunismus und des widerlichen unkreativen Klimas des Kalten Kriegs.
Ritt, wie er mir sofort mitteilte, war im tiefsten Inneren Jude. Vielleicht hatte seine Familie nicht direkt unter dem Holocaust gelitten – obwohl ich das vermute –, aber er persönlich hatte für seine Leute gelitten und tat dies immer noch. Seine jüdische Identität war für ihn ein ausgesprochen wichtiges Thema. Und er wurde noch leidenschaftlicher, als wir über den Film sprachen, den er aus meinem Roman zu machen gedachte. In Der Spion, der aus der Kälte kam werden zwei idealistische Kommunisten, die eine unschuldige Bibliothekarin aus London und der andere Mitglied der ostdeutschen Intelligentsia, kaltherzig zum größeren (kapitalistischen) Wohl der Sache des Westens geopfert. Beide sind Juden.
Für Marty Ritt sollte das ein persönlicher Film werden.
Und ich? Welche Abschlüsse an der Schule des Lebens konnte ich vorweisen? Meinen Stresemann? Meine, wenn auch abgebrochene, Privatschulausbildung? Einen Roman, den ich mir aus Bruchstücken nachempfundener Erfahrungen zusammengereimt hatte? Oder die nervenaufreibende Tatsache, die ich ihm gegenüber Gott sei Dank nicht enthüllen durfte, dass ich einen Großteil meiner letzten Jahre damit verbracht hatte, in den geschützten Weinbergen des britischen Geheimdiensts zu arbeiten und gegen jene Sache zu kämpfen, der er sich, wie er offenherzig zugab, verschrieben hatte?
Aber das fand ich erst im Laufe der Zeit heraus. Ich selbst stellte ja ebenfalls die leicht dahingesagten Treueschwüre meiner Jugend in Frage. Einen Film zu drehen heißt immer, unversöhnliche Gegensätze mit Gewalt aneinanderzubinden. Das war nie so deutlich wie in dem Moment, als Richard Burton die Hauptrolle des Alec Leamas übernahm.
Ich weiß nicht mehr, wann genau ich erfuhr, dass Richard Burton für die Rolle ausgewählt worden war. Bei unserem Lunch im Connaught Grill Room hatte Martin Ritt mich gefragt, wen ich mir denn als Leamas vorstellen könne, und ich hatte Trevor Howard vorgeschlagen; vielleicht auch Peter Finch, unter der Voraussetzung, dass Finch einen Engländer spielen wollte, keinen Australier, weil ich doch den starken Eindruck hatte, dass es sich um eine sehr britische Geschichte über sehr britische Geheimdienstmethoden handelte. Ritt, der gut zuhören konnte, meinte, er könne meinen Standpunkt verstehen, würde beide Schauspieler mögen, fürchte aber, dass keiner von ihnen groß genug sei, um das Budget zu rechtfertigen. Ein paar Wochen später, als ich auf Kosten von Paramount wieder in London war, um an einer Besichtigung der möglichen Drehorte teilzunehmen, erzählte er mir, dass er Burt Lancaster die Rolle angeboten habe.
Um einen Engländer zu spielen, Marty?
Kanadier. Burt ist ein toller Schauspieler. Er wird einen Kanadier spielen, David.
Darauf hatte ich nichts Nützliches zu erwidern. Lancaster war wirklich ein großartiger Schauspieler, aber mein Leamas war kein großartiger Kanadier. Doch dann setzte die Große Unerklärliche Stille ein.
Jeder Weg zu einem Film nach meinen Romanen – auch die, zu denen es nie kam – ging mit einem ersten Schwall an Aufregung einher, gefolgt von der Großen Unerklärlichen Stille. Diese Stille kann ein paar Monate andauern, ein paar Jahre oder auch für immer. Hat das Projekt keine Chance, oder sprühen die Funken und es hat mir nur niemand Bescheid gesagt? Den Blicken der Uneingeweihten entzogen, wird mit riesigen Summen nur so um sich geworfen, werden Skripts in Auftrag gegeben, geschrieben und verworfen, Agenten rivalisieren und lügen. Hinter verschlossenen Türen bemühen sich bartlose Bubis, einander gegenseitig mit Perlen jugendlicher Kreativität zu übertrumpfen. Doch außerhalb der Mauern von Camp Hollywood sind keine Fakten zu bekommen. Aus einem guten Grund. Wie der unsterbliche William Goldmann schon sagte: Niemand weiß Bescheid.
Richard Burton tauchte einfach auf, mehr kann ich dazu nicht sagen. Keine tausend Geigen kündigten seine Ankunft an, nur eine ehrfürchtige Stimme am Telefon: »David, ich habe Neuigkeiten. Richard Burton hat den Vertrag unterschrieben und wird Leamas spielen.« Und das war nicht mal Martin Ritt am Telefon, sondern mein amerikanischer Verleger Jack Geoghegan in einem Anflug schier religiöser Verzückung. »Und du, David, wirst dich mit ihm treffen!« Geoghegan war ein Veteran des knallharten Buchgeschäfts. Er hatte als Schuhsohlenverkäufer angefangen und war bis zum Chef der Vertriebsabteilung von Doubleday aufgestiegen. Kurz vor dem Ruhestand hatte er seinen eigenen kleinen Verlag übernommen, Coward-McCann. Für ihn wurde ein Traum wahr: erst der unerwartete Erfolg meines Romans, dann als Dreingabe noch Richard Burton dazu.
Das muss wohl gegen Ende 1964 gewesen sein, denn ich war aus dem Staatsdienst ausgeschieden und versuchte mich erst in Griechenland, dann in Wien als hauptberuflicher Schriftsteller. Ich bereitete mich auf meinen ersten Besuch in den Vereinigten Staaten vor; wie es der Zufall so wollte, spielte Burton am Broadway den Hamlet, Gielgud führte zusammen mit Alexander Cohen Regie und sprach auch die Rolle des Geistes. Das Stück war wie eine Kostümprobe angelegt und sollte in ausgewählten Kinos übertragen werden. Geoghegan wollte mit mir eine Aufführung besuchen, um mich nach der Vorstellung mit Burton in dessen Garderobe bekannt zu machen. Wenn wir eine Audienz beim Papst gehabt hätten, hätte Geoghegan nicht aufgeregter sein können.
Burtons Darbietung war phänomenal. Wir hatten die besten Plätze. Burton war sehr charmant und meinte, mein Buch sei das größte seit ewigen Zeiten. Ich meinte, sein Hamlet sei besser als der von Laurence Olivier – ja sogar besser als der von Gielgud, was mutig von mir war, denn der hätte uns ja hören können –, besser als alles, was ich je gesehen hätte. Insgeheim jedoch fragte ich mich im Tumult der gegenseitigen Lobhudeleien, wie um alles in der Welt dieser wunderschöne, donnernde Bariton und dieses überwältigende Alphatier nur in die Figur eines abgewrackten britischen Spions mittleren Alters passen sollten, der nicht gerade für sein Charisma, seine feine Aussprache oder das Aussehen eines pockennarbigen griechischen Gottes steht?
Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass diese Frage wohl auch an Ritt nagte, denn einer der ersten Kämpfe in dem nun ausbrechenden Krieg zwischen den beiden drehte sich um die Überlegung, wie man Burtons Stimme bändigen sollte, was nun gar nicht in dessen Sinne war.
Es ist 1965, und ich bekomme per Zufall mit – ich hatte noch immer keinen Filmagenten, also musste ich wohl über einen Spitzel verfügen –, dass der von Burton darzustellende Alec Leamas in der neuesten Fassung des Filmskripts keinen Lebensmittelhändler niederschlägt und dafür ins Gefängnis kommt, sondern in einer Nervenheilanstalt landet und durch ein Schlafraumfenster im ersten Stock entflieht. Der Leamas in meinem Roman hätte sich niemals auch nur in der Nähe einer Nervenheilanstalt aufgehalten, und wenn es um sein Leben gegangen wäre, wozu das also? Die Antwort lautete wohl, dass aus der Perspektive Hollywoods eine Psychiatrie sexier war als ein Gefängnis.
Ein paar Wochen später sickerte die Nachricht durch, dass der Drehbuchautor, der zu seiner Zeit ebenso auf der Schwarzen Liste gestanden hatte wie Ritt, krank geworden war und man die Aufgabe an Paul Dehn übertragen hatte. Es tat mir für den Autor leid, aber ich war auch erleichtert. Dehn war selbst Brite. Er hatte schon einen eigenen Film geschrieben, für den ich ihn sehr bewunderte: Der lautlose Krieg. Außerdem gehörte er zur Familie: Während des Krieges hatte er Agenten der Alliierten beigebracht, wie man lautlos tötet, und selbst an verdeckten Einsätzen in Frankreich und Norwegen teilgenommen.
Dehn und ich trafen uns in London. Er konnte mit der Idee der Psychiatrie nichts anfangen und sah kein Problem darin, Lebensmittelhändler niederzuschlagen. Er steckte Leamas gern wieder ins Gefängnis. Ein paar Monate später erreichte mich tatsächlich Dehns Filmskript mit der Post, zusammen mit einem höflichen Anschreiben von Ritt, was ich denn davon halten würde.
Zu dem Zeitpunkt war ich bereits nach Wien gezogen, und ganz in der Tradition eines Schriftstellers, der völlig unerwartet zu Ruhm gelangt, hatte ich mit einem Roman zu kämpfen, mit dem ich gar nicht zufrieden war, besaß Geld, von dem ich nie zu träumen gewagt hatte, und aus Gründen, die ich mir ganz allein zuzuschreiben habe, ging meine Ehe in die Brüche. Ich las das Drehbuch, es gefiel mir, ich schrieb Ritt, dass es mir gefiel, und machte mich wieder an mein eigenes Buch und meine eigenen Trümmer. Ein paar Tage später klingelte nachts das Telefon. Ritt rief aus den Ardmore Studios in Irland an, wo die Dreharbeiten schon längst laufen sollten. Er hörte sich an wie jemand, den man als Geisel genommen hatte und der noch ein letztes Mal telefonieren darf.
Richard braucht dich, David. Richard braucht dich so dringend, dass er seinen Text erst sprechen wird, wenn du ihn umgeschrieben hast.
Aber was stimmte denn nicht mit Richards Text, Marty, ich fand nichts daran auszusetzen.
Das ist nicht der Punkt, David. Richard braucht dich, und er hält die ganze Produktion auf, bis du hier bist. Wir zahlen das Ticket erster Klasse und besorgen dir eine Suite. Was willst du noch?
Wenn es denn wirklich stimmte, dass Burton nur meinetwegen die Produktion aufhielt, dann hätte ich alles verlangen können, was ich wollte, und ich hätte es auch bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, wollte ich nichts. Das ist nun ein halbes Jahrhundert her, und vielleicht erzählen die Unterlagen bei Paramount eine andere Geschichte, aber das bezweifle ich. Vielleicht war ich so sehr darauf erpicht, dass mein Film gedreht wurde, das es mir egal war oder ich mich nicht traute, etwas zu verlangen. Vielleicht wollte ich auch nur dem Chaos entfliehen, das ich in Wien rings um mich herum angerichtet hatte.
Vielleicht war ich aber auch nur zu naiv und wusste nicht, dass dies die einmalige Gelegenheit war, für die ein Filmagent seine eigene Mutter verkauft hätte: Die Dreharbeiten hatten begonnen, das gesamte Paramount-Pictures-Team war im Einsatz, allein sechzig Elektriker hingen am Drehort herum und hatten nichts zu tun, außer Gratis-Hamburger zu essen, und einer der größten Filmstars seiner Zeit weigerte sich aufzutreten, wenn nicht dieses am meisten verachtete Geschöpf im gesamten Filmzirkus – der Autor der Vorlage, um Himmels willen! – endlich eingeflogen wurde, um Händchen zu halten.
Ich weiß nur eins: Ich legte auf und flog am nächsten Morgen nach Dublin, weil Richard mich brauchte.
Aber stimmte das denn überhaupt?
Oder brauchte Marty mich noch mehr?
Rein theoretisch war ich in Dublin, um Burtons Text umzuschreiben, also die Szenen so umzustellen, dass sie seinen Vorstellungen entsprachen. Doch Burtons Vorstellungen deckten sich nicht mit denen von Ritt, also wurde ich in dieser kurzen Zeit zum Vermittler zwischen den beiden. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mich mit Ritt zusammensetzte und eine Szene schrieb, um mich dann mit Burton zusammenzusetzen und sie wieder umzuschreiben, nur um dann zu Ritt zurückzueilen. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals mit beiden zugleich zusammengesessen zu haben. Die Angelegenheit dauerte nur ein paar Tage, bis Ritt erklärte, er sei mit den Umbauarbeiten zufrieden, und Burton seinen Kampf eingestellt hatte, zumindest mit mir. Als ich Ritt jedoch erklärte, ich würde nach Wien zurückfliegen, da wurde er so vorwurfsvoll wie kein Zweiter.
Jemand muss auf Richard aufpassen, David. Richard trinkt zu viel. Richard braucht einen Freund.
Richard braucht einen Freund? Hatte er nicht gerade Elizabeth Taylor geheiratet? War sie denn nicht seine Freundin? War sie denn nicht an seiner Seite und hielt jedes Mal den ganzen Dreh auf, wenn sie in einem weißen Rolls-Royce angerauscht kam, umgeben von weiteren Freunden wie Yul Brynner und Franco Zeffirelli? Und was war mit den Agenten und Rechtsanwälten, die hereinschneiten, mit dem gesamten, angeblich siebzehnköpfigen Haushalt von Burton, der eine ganze Etage in Dublins vornehmsten Hotel belegte, bestehend aus, wenn ich recht verstand, den Kindern aus verschiedenen Ehen, den Lehrern der besagten Kinder, Friseuren, Sekretären und, in den Worten eines unhöflichen Mitglieds des Teams, dem Typen, der dem Papagei die Krallen schnitt? Und Richard brauchte ausgerechnet mich?
Natürlich. Er war ja Alec Leamas.
Und in dieser Rolle war er ein herumstreunender Einzelgänger, der dabei war, vor die Hunde zu gehen, seine Karriere war am Ende, und die Einzigen, mit denen er reden konnte, waren Fremde wie ich. Zu dem Zeitpunkt erkannte ich nur allmählich, dass ich gerade in den Prozess eingeweiht wurde, wie ein Schauspieler in den dunkleren Ecken seines Lebens nach Bausteinen für die Rolle kramt, die er spielen wird. Und der erste Baustein, wenn man Leamas sein wollte, der vor die Hunde ging, war Einsamkeit. Und solange Burton Leamas war, war der gesamte Hofstaat von König Burton sein erklärter Feind. Wenn Leamas allein durchs Leben ging, dann musste Burton das auch. Wenn Leamas eine halbe Flasche Johnny Walker in der Tasche seines Regenmantels herumtrug, dann tat Burton das auch. Und wann immer die Einsamkeit zu viel für ihn wurde, nahm er einen ordentlichen Schluck, auch wenn – und das wurde schnell klar – Leamas ordentlich was vertragen konnte und Burton nicht.
Wie das sein privates Leben beeinflusste, weiß ich nicht zu sagen, mal abgesehen von den gelegentlichen Unterhaltungen unter Männern bei einem Drink. Er sei in Ungnade gefallen, Elizabeth sei nicht leicht zufriedenzustellen. Allerdings schenkte ich diesen Beichten nicht allzu viel Glauben. Burton gab, wie so viele Schauspieler, keine Ruhe, bis er sich irgendjemanden zum Freund gemacht hatte, was ich daran erkannte, wie er seinen Charme bei jedem spielen ließ, vom Beleuchter zum Teemädchen, was unseren Regisseur sichtlich verärgerte.
Elizabeth Taylor mag durchaus Gründe dafür gehabt haben, nicht so leicht zufriedenzustellen zu sein. Burton hatte Ritt bedrängt, ihr die weibliche Hauptrolle zu geben, doch Ritt hatte sich für Claire Bloom entschieden, mit der, so die Gerüchteküche, Burton mal eine Affäre gehabt hatte. Und obwohl Claire Bloom sich außerhalb der Dreharbeiten strikt in ihrem Wohnwagen aufhielt, dürfte die betrogene Taylor wohl kein Vergnügen daran gehabt haben zu sehen, wie die beiden am Set flirteten.
Stellen Sie sich einen hell ausgeleuchteten Platz in Dublin vor; die Berliner Mauer – graue Gasbetonblöcke und Stacheldraht – teilt ihn in ihrer geballten Scheußlichkeit. Die Pubs sind geschlossen, und ganz Dublin hat sich versammelt, um sich das Spektakel anzuschauen. Endlich regnet es mal nicht, also steht ein Trupp der Dubliner Feuerwehr bereit. Oswald Morris, unser Kameramann, mag seine nächtlichen Straßen gern nass. Ein letztes Mal fummeln Kulissenbauer und Techniker an der Mauer herum. An einer Stelle bilden Eisenbolzen eine grobe, kaum sichtbare Leiter. Oswald Morris und Ritt schauen sie sich genau an.
Jeden Augenblick wird Leamas diese Leiter hinaufklettern, den Stacheldraht beiseiteschieben, auf der Mauer liegen und voller Entsetzen auf die Leiche der armen Frau hinunterstarren, die er mit List dazu gebracht hat, Betrug zu begehen. Im Roman heißt diese Frau Liz, doch im Film wird sie verständlicherweise umgetauft in Nan.
Jeden Augenblick wird der Regieassistent oder irgendein anderes Teammitglied die Treppe vor dem Fenster des tristen Zimmers im Souterrain hinuntersteigen, in dem Burton und ich die letzten paar Stunden verbracht haben. Alec Leamas wird sich in einem abgetragenen Regenmantel hinausbegeben, seine Position an der Mauer einnehmen und auf Ritts Kommando hin den schicksalhaften Aufstieg beginnen.
Nur wird das in der Realität leider nicht so ablaufen. Die halbe Flasche Johnny Walker ist schon lange geleert. Ich habe es zwar geschafft, den Großteil davon zu trinken, und Leamas mag noch immer in der Lage sein, die Leiter hinaufzuklettern, aber Burton ist es sicherlich nicht.
In der Zwischenzeit ist zur Freude der Menge der weiße Rolls-Royce mit dem französischen Chauffeur vorgefahren, Burton, der etwas verspätet auf den Lärm draußen reagiert, brüllt: »Verflucht! Elizabeth, du dummes Ding!«, und stürmt über die Treppe hinaus auf den Platz. Mit all der Wucht des Baritons, die Ritt zu unterdrücken sucht, brüllt er den Chauffeur in schlechtem Französisch an, obwohl der eigentlich perfekt Englisch spricht, wie er es wagen kann, Elizabeth diesem Dubliner Mob auszuliefern: Allerdings ist die Situation nicht sonderlich bedrohlich, da ja auch die gesamte Dubliner Polizei angetreten ist, um sich das Spektakel anzuschauen.
Doch gegen Burtons dramatische Wut ist nichts auszurichten. Elizabeth betrachtet ihn mürrisch durch die Scheiben, der Chauffeur setzt den Wagen zurück und fährt wieder ins Hotel, Martin Ritt steht mit seiner Schiebermütze neben der Mauer und wirkt wie der einsamste, wütendste Mensch der Welt.
Damals habe ich mich gefragt und habe das zwischenzeitlich immer mal wieder getan, wenn ich die Zusammenarbeit von Schauspielern und Regisseuren bei anderen Filmen beobachtete, was wohl der Grund für die immer offenere Feindseligkeit zwischen Burton und Ritt gewesen sein mag; ich bin dabei zu dem Schluss gekommen, dass sie wohl vorherbestimmt gewesen ist. Da gab es natürlich die Sache, dass Ritt Elizabeth Taylor für die Rolle der Nan abgelehnt und stattdessen Claire Bloom genommen hatte. Ich glaube allerdings, dass der eigentliche Grund weiter zurückliegt, bis zu den Tagen reicht, als Ritt als Radikaler auf der Schwarzen Liste stand, verletzt und wütend war. Sein soziales Bewusstsein war nicht nur eine Haltung, er hatte sie mit der Muttermilch aufgesogen.
In einer der wenigen tiefergehenden Unterhaltungen, die ich in der kurzen gemeinsamen Zeit mit Burton führte, prahlte er fast ein wenig mit dem Verweis, wie sehr er den Showmann in sich verachten würde; wie sehr er sich wünschte, sich wie Paul Scofield geben zu können, die Helden auf der großen Leinwand und das dicke Geld der Filmindustrie auszuschlagen und nur die Rollen anzunehmen, die einen echten künstlerischen Wert versprachen. Ritt hätte ihm darin aus ganzem Herzen zugestimmt.
Doch damit war Burton noch nicht aus dem Schneider. In den Augen des puritanischen, entschlossenen, mit der Sache verheirateten Linksaktivisten Ritt verkörperte Burton nahezu alles, was Ritt instinktiv verdammte. Unter seinen Zitaten lässt sich eines finden, das es sehr gut auf den Punkt bringt: »Ich habe nicht sonderlich viel Achtung vor dem Talent. Talent liegt in den Genen. Was zählt, ist, was man daraus macht.« Schlimm genug, dass einem Geld vor Kunst ging, oder Sex vor Familie, oder dass man mit Geld und Frau protzte oder sich demonstrativ betrank oder auf der Welt wandelte wie ein Gott, während die Massen nach Gerechtigkeit schrien. Aber sein Talent zu verschwenden, das war eine Sünde vor den Göttern und den Menschen. Und je größer das Talent – und Burtons Talent war unermesslich und außergewöhnlich –, desto größer die Sünde, so Ritt.
Als Ritt 1952 auf der Schwarzen Liste landete, stand Burton, das sechsundzwanzigjährige walisische Ausnahmetalent mit der goldenen Stimme, gerade am Anfang seiner Karriere in Hollywood. Kein Zufall, dass mehrere Schauspieler in Der Spion, der aus der Kälte kam – Claire Bloom und Sam Wanamaker, um nur zwei zu nennen – ebenfalls auf der Schwarzen Liste gestanden hatten. Man musste nur einen Namen aus jener Zeit nennen, schon lautete Ritts erste Frage: »Wo war er, als wir ihn brauchten?« Was er damit meinte: Hat er oder sie sich für uns oder gegen uns ausgesprochen oder aus Feigheit geschwiegen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieselbe beharrliche Frage, bewusst oder unbewusst, auch sein Verhältnis zu Richard Burton überschattete.
Wir hocken in einem vom Wind umtosten Strandhaus in Scheveningen an der holländischen Küste. Es ist der letzte Drehtag, eine angespannte Innenszene. Leamas wählt seinen eigenen Untergang, als er einwilligt, sich nach Ostdeutschland einschleusen zu lassen und den Feinden seines Landes wichtige Informationen zu verraten. Ich drücke mich hinter Oswald Morris und Martin Ritt herum, bin bemüht, nicht im Weg zu stehen. Die Spannung zwischen Burton und Ritt ist mit Händen zu greifen. Ritts Anweisungen fallen kurz und einsilbig aus. Burton reagiert kaum darauf. Wie immer bei solchen Innenszenen sprechen die Filmschauspieler so leise und beiläufig, dass es den Unbeteiligten scheint, als würden sie noch proben, nicht spielen. Und so kommt es überraschend, als Ritt sagt: »Im Kasten!«, und die Szene zu Ende ist.
Doch sie ist noch nicht zu Ende. Erwartungsvolle Stille macht sich breit, so als würden alle wissen, was kommt, nur ich nicht. Dann sagt Ritt, der ja selbst ein angesehener Schauspieler ist und ein wenig Ahnung vom Timing hat, den Satz, den er wohl für diesen Augenblick vorbereitet hat:
»Richard, das war die letzte gute Nummer, die ich aus einer alten Hure rausgeholt habe, und das ausgerechnet vor dem Spiegel.«
Wahr? Fair?
Sicher nicht wahr und auf keinen Fall fair. Richard Burton war ein vielseitig gebildeter, ernsthafter Künstler mit Vorlieben und Fehlern, die wir in der einen oder anderen Form alle haben. Zwar mag er Gefangener seiner eigenen Schwächen gewesen sein, aber der Schuss rechtschaffenen Eifers seines walisischen Puritanismus war gar nicht so weit entfernt vom Eifer eines Martin Ritt. Er neigte zu Respektlosigkeit, hatte den Schalk im Nacken, war großherzig, konnte aber auch manipulieren. Manipulation gehört bei den Weltberühmten zwangsläufig zum Beruf. Ich hätte Burton gern mal in einer ruhigeren Stunde erlebt. Als Alec Leamas war er ausgezeichnet, und auch in jedem anderen Jahr hätte ihm seine Darbietung einen Oscar einbringen können, der ihm sein ganzes Leben vorenthalten blieb. Der Film war düster und in Schwarzweiß. 1965 waren das nicht die Farben der Saison.
Wenn Regisseur und Hauptdarsteller nicht so großartig gewesen wären, dann wäre wohl auch der Film nicht so großartig geworden. Damals, glaube ich, hätte ich mich eher schützend vor den untersetzten, unerschütterlichen und verbitterten Ritt gestellt als vor den extravaganten und launenhaften Burton. Ein Regisseur trägt die ganze Last des Films, dazu gehören auch die Eigenarten seines Stars. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass Burton alles in seiner Macht Stehende tat, um Ritt herabzusetzen, doch inzwischen glaube ich, dass die beiden einander ebenbürtig waren. Und Ritt hatte grundsätzlich das letzte Wort. Ritt war ein brillanter, leidenschaftlicher Regisseur, dessen gerechter Zorn niemals verebbte.
29
Alec Guinness
Noch im Sterben liegend wahrte Alec Guinness die für ihn typische Zurückhaltung. Eine Woche vor seinem Tod hatte er mir geschrieben und seine Sorge über die Krankheit seiner Frau Merula zum Ausdruck gebracht. Seine eigene Gesundheit hatte er wie üblich mit kaum einem Wort erwähnt.
Nie durfte man Alec sagen, wie großartig er war. Und war man so dumm, es auch nur zu versuchen, dann kassierte man seinen bösen Blick unter den buschigen Augenbrauen. 1994 aber führte eine erfolgreiche Geheimoperation unter Leitung des Verlegers Christopher Sinclair-Stevenson zu einem hübsch gebundenen Buch mit dem Tiel ›Alec‹, das ihm zu seinem achtzigsten Geburtstag überreicht wurde. Darin fanden sich Erinnerungen, Gedichte, Zuneigungsbezeugungen und Dankesworte, zumeist von alten Freunden. Ich war bei der Übergabe nicht anwesend, doch bin ich mir sicher, dass Alec entsprechend knurrig darauf reagiert haben wird. Vielleicht hat er sich auch ein wenig gefreut, denn er schätzte Freundschaft so sehr, wie er Lob verabscheute, und hier fand sich zwischen zwei Buchdeckeln gleich ein ganzes Aufgebot an Freunden.
Im Vergleich zu den meisten Verfassern in diesem Band war ich eher als Nachzügler in Alecs Leben getreten, aber wir hatten über fünf Jahre lang immer wieder eng miteinander gearbeitet und waren seither in freundlichem Kontakt geblieben. Ich war immer sehr stolz auf unsere Bekanntschaft; mein großer Augenblick aber kam, als er den Text, den ich zu seinem achtzigsten Geburtstag geschrieben hatte, als Geleitwort zum letzten Band seiner Erinnerungen verwendete.
Alec bestand darauf, dass es keinen Gedenkgottesdienst geben sollte, keinen Leichenschmaus mit alten Freunden, keine Gefühlsausbrüche. Doch kann ich zu meiner Entschuldigung vorbringen, dass dieser Mann, der das Private so ungeheuer schätzte, mit meinem kleinen Porträt zufrieden genug war, um es noch einmal in die Welt hinauszutragen.
Folgendes stammt auszugsweise aus meinem Geleitwort zu seinen autobiographischen Erinnerungen, ergänzt um ein paar Nachträge:
Er ist kein angenehmer Mitmensch. Und warum sollte er das auch sein? Das beobachtende Kind in diesem achtzigjährigen Mann hat noch immer keinen sicheren Hafen, keine einfachen Antworten gefunden. Die Entbehrungen und Erniedrigungen, liegen sie auch ein Dreivierteljahrhundert zurück, sind bis heute ungeklärt geblieben. Es scheint, als verlange es ihn noch immer danach, die Welt der Erwachsenen um sich herum zu beschwichtigen, ihr Liebe abzutrotzen, ein Lächeln zu erbetteln, ihre Gräuel abzuwenden oder zu bändigen.
Er verachtet Schmeicheleien und misstraut Lob. Sein Argwohn ist der eines erfahrenen Kindes. Sein Vertrauen schenkt er nur zögerlich und mit allergrößter Vorsicht. Und er ist jederzeit darauf gefasst, es wieder zurückzunehmen. Ist man, wie ich, unheilbar angetan von ihm, dann tut man gut daran, das für sich zu behalten.
Die äußere Form ist für ihn ungeheuer wichtig. Als einer, der mit dem Chaos nur allzu vertraut ist, schätzt er gute Manieren und Ordnung. Er ist den Gutaussehenden zugeneigt, liebt aber auch die Clowns, die wilden und schrägen Gestalten auf der Straße, die er als eine Art natürliche Verbündete betrachtet.
Tag und Nacht studiert und speichert er die Eigenarten des erwachsenen Feindes, passt sein eigenes Gesicht, seine Stimme, seinen Körper an zahllose Versionen an, die er bei seinen Mitmenschen vorfindet, während er gleichzeitig die Möglichkeiten seiner eigenen Natur erkundet – Gefalle ich Ihnen so besser – oder so – oder so? – immerfort. Und wenn er eine Persönlichkeit auf diese Weise zurechtkomponiert, dann bedient er sich ohne Scham bei allen, die in seiner Nähe sind.
Den Prozess zu beobachten, wie Alec Guinness eine Identität annimmt, heißt, einen Mann zu beobachten, der auf eine Mission in Feindesland zieht. Ist diese Verkleidung die richtige für ihn? (Wobei er damit sich selbst in seiner neuen Rolle meint.) Ist das die richtige Brille? Nein, versuchen wir eine andere. Die Schuhe, sind sie zu gut, zu neu, werden sie ihn verraten? Und sein Gang, also, was er da mit dem Knie macht, dieser Blick, diese Körperhaltung – nicht zu dick aufgetragen, oder? Und wenn er wie ein Einheimischer aussieht, spricht er auch wie einer – beherrscht er den Dialekt?
Und wenn die Show vorüber ist und die Szene abgedreht, und er ist wieder Alec – das wandlungsfähige Gesicht glänzt noch vom Make-up, die dünne Zigarre zittert leicht in seiner großen Hand –, dann hat man den Eindruck, dass er, nach all den Abenteuern, die er dort draußen erlebt hat, in eine öde Welt zurückgekehrt ist.
Er mag ein Einzelgänger sein, aber der ehemalige Marineoffizier ist ungeheuer gerne aktiver Teil eines Teams. Nichts ist ihm lieber, als gut angeleitet zu werden, so dass er die Bedeutung der Anweisungen, die Fähigkeiten seiner Mitspieler überblicken kann. Wenn er mit ihnen spielt, dann kennt er deren Text ebenso gut wie den eigenen. Bei aller Selbstbetrachtung schätzt er am meisten die kollektive Illusion, die Show, diese kostbare andere Welt, in der das Leben Bedeutung, Form und Vorsatz hat und Ereignisse sich an feste Regeln halten.
Mit ihm am Drehbuch zu arbeiten ist das, was man wohl eine Lernerfahrung nennt. Da mag die eine Szene ein Dutzend verschiedene Versionen durchlaufen, bis er überzeugt ist, und eine andere wird ohne weitere Diskussion abgenickt. Erst später, wenn man sieht, was er daraus macht, begreift man, warum.
Er unterwirft sich selbst einer strengen Diziplin und erwartet dies auch von anderen. Ich war dabei, als ein Schauspieler, der seitdem zum Abstinenzler geworden ist, betrunken zum Dreh erschien – unter anderem wohl deshalb, weil er Angst davor hatte, mit Guinness zu arbeiten. Das war in Alecs Augen ein ungeheures Vergehen; genauso gut hätte der arme Mann beim Wacheschieben einschlafen können. Zehn Minuten später war Alecs Wut allerdings schon einer beinah verzweifelten Freundlichkeit gewichen. Der Dreh am nächsten Tag gestaltete sich als reinster Traum.
Wenn Sie Alec zum Dinner einladen, dann wird er geschniegelt und gestriegelt vor Ihrer Tür stehen, genau in dem Moment, wenn die Uhr zur vereinbarten Stunde schlägt, ganz gleich, ob womöglich gerade ein Schneesturm London zum völligen Erliegen gebracht hat. Und ist man bei ihm zu Gast – was ein wahrscheinlicheres Szenario ist, da er ein geradezu zwanghaft spendabler Gastgeber ist –, dann wird eine Postkarte in seiner gut lesbaren, elegant nach Südosten geneigten Schönschrift die Verabredung bestätigen, die am Vortag telefonisch getroffen wurde.
Ich kann Ihnen nur raten, diese Geste der Pünktlichkeit zu erwidern. Solche Dinge bedeuten ihm sehr viel. Sie sind zwingender Bestandteil im Drehbuch des Lebens, und sie sind es, die ihm den Kontrast aufzeigen zu der Demütigung und Unordnung seiner elenden Anfangsjahre.
Doch will ich ihn keineswegs als ernsten Zeitgenossen darstellen, Gott bewahre!
Alecs lebhaftes Lachen und sein kameradschaftliches Verhalten, wenn man sie erfahren darf, sind angesichts ihrer Unvorhersehbarkeit umso wunderbarer. Und während ich schreibe, sehe ich sein Gesicht vor mir, das so unvermittelt vor Freude strahlen kann, die wunderbar pointierten Anekdoten, das Funkensprühen, wenn er jemanden in Körperhaltung und Stimme nachahmt, das schelmische Delphinlächeln, wie es aufflammt und wieder verschwindet. Sie sollten ihn mal in der Gesellschaft von Schauspielerkollegen unterschiedlichsten Alters und verschiedenster Herkunft erleben, wie er sich unter sie mischt wie ein Mann, der endlich seinen Platz zum Leben gefunden hat. Das Neue schreckt ihn nicht ab. Er liebt es, junge Talente zu entdecken und ihnen auf dem steinigen Weg, den er selbst zurückgelegt hat, eine helfende Hand zu reichen.
Und er ist ein Leser.
Manche Schauspieler, die eine Rolle angeboten bekommen, zählen ab, wie viele Zeilen ihr Test hat, um einschätzen zu können, wie bedeutend ihre Rolle ist. Nichts läge Alec ferner, als das zu tun. Kein mir bekannter Regisseur, kein Produzent oder Drehbuchautor hat ein besseres Gespür für Struktur und Dialog, für dieses gewisse Etwas, nach dem Alec beständig Ausschau hält; nach dem McGuffin, dem Moment der Magie, der ein Stück aus der breiten Masse hervorhebt.
Alecs Karriere ist gespickt von brillanten, unwahrscheinlichen Rollen. Sein Talent, exakt diese auszuwählen, zeugt von ebenso großer Genialität wie sein Talent, sie zu spielen. Ich habe auch gehört – besteht darin vielleicht eins von Alecs gut gehüteten Geheimnissen? –, dass seine Frau Merula großen Einfluss auf seine Entscheidungen hat. Das würde mich nicht im Mindesten überraschen. Sie ist eine weise, ruhige Frau, eine äußerst feinfühlige Künstlerin und verfügt über Weitblick.
Was verbindet also diejenigen, die das Glück hatten, ein Stück des langen Lebenswegs von Alec mitgegangen zu sein? Die völlige Verwirrung, was wir für ihn wohl sein könnten. Man will ihm Zuneigung schenken, ihm gleichzeitig aber auch den Raum lassen, den er benötigt. Sein Talent ist so greifbar, dass man ganz instinktiv das Bedürfnis hat, es vor den Unbilden des Lebens zu schützen. Andererseits ist er bislang auch ganz gut allein zurechtgekommen, vielen Dank.
Und so mischen wir uns unter all die anderen in seinem großen Publikum: entmutigte Gebende, niemals imstande, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, die sich damit zufriedengeben müssen, von dem Genie zu profitieren, das anzuerkennen er sich so beharrlich weigert.
Mittagszeit im obersten Stock des BBC-Gebäudes, ein Tag im Sommer 1979. Schauspieler, Produzenten, Regisseur und Autor von Dame, König, As, Spion haben sich in Schale geworfen und versammelt, nippen an ihrem warmen Weißwein, jeder nur ein Glas, bevor wir dann in den Speisesaal überwechseln, wo der Festschmaus aus kaltem Hühnchen auf uns wartet.
Es gibt allerdings eine kleine Verzögerung. Der Gong ist ertönt, die Granden der BBC sind im Anmarsch. Autor, Produzenten und Regisseur sind schon lange anwesend und angemessen gekleidet. Die Granden lassen sich Zeit. Auch die Schauspieler sind pünktlich eingetroffen, Alec überpünktlich wie immer. Doch wo bleibt nur Bernard Hepton, unsere Nebenrolle, unser Toby Esterhase?
Unser Wein wird immer wärmer, alle Augen sind auf die Doppeltüren gerichtet. Ist Bernard krank? Hat er den Termin vergessen? Schmollt er? Es geht das Gerücht, dass es am Set zwischen Alex und Bernard zu Reibereien gekommen sein soll.
Die Türen öffnen sich. Mit gespieltem Desinteresse tritt Bernard ein, aber nicht in langweiligem Grau und Marineblau wie alle anderen, sondern in einem Dreiteiler aus grellgrün kariertem Stoff, noch betont durch orangefarbene Lackschuhe.
Und wie er lächelnd den Raum betritt, ruft die schmelzende Stimme von George Smiley zum Willkommen:
»Ach, Bernard. Du hast dich als Frosch verkleidet.«
30
Verlorene Meisterwerke
Ich fürchte, eines Tages wird man feststellen, dass die besten Verfilmungen meiner Romane jene sind, die nie gedreht wurden.
1965, das Jahr, in dem Der Spion, der aus der Kälte kam als Film startete, ließ ich mich von meinem britischen Verleger dazu überreden, die Frankfurter Buchmesse zu besuchen (wovor es mir grauste), um einen Roman zu bewerben, in den ich keine großen Hoffnungen setzte, und mich vor der Presse unkompliziert und interessant zu präsentieren. Als ich genug von meiner eigenen Stimme hatte – und davon, unter den ausländischen Journalisten herumgereicht zu werden –, zog ich mich schlechtgelaunt in meine Suite im Frankfurter Hof zurück.
So war ich also gerade eines späten Nachmittags mit meiner schlechten Laune beschäftigt, als das Telefon klingelte und mir eine Dame mit rauchiger Stimme und starkem Akzent mitteilte, dass Fritz Lang unten im Foyer auf mich warten würde, ob ich bitte nach unten kommen könnte?
Diese Aufforderung beeindruckte mich nicht sonderlich. In Deutschland gibt es Langs wie Sand am Meer und etliche, die Fritz heißen. Handelte es sich vielleicht um jenen widerlichen Gerüchteschmierfink, den ich schon früher am Tag abgewimmelt hatte? Ich befürchtete es, und auch, dass er die Telefonfrau als Köder auswarf. Ich fragte nach der Art von Herrn Langs Geschäften.
»Fritz Lang, der Regisseur«, stellte sie mit Nachdruck klar, »er möchte Ihnen gern einen Vorschlag unterbreiten.«
Ich hätte nicht überraschter sein können, wenn sie mir mitgeteilt hätte, Goethe würde unten in der Hotelhalle warten. Als ich Ende der 40er in Bern Germanistik studiert hatte, hatten wir ganze Nächte damit verbracht, über das Genie von Fritz Lang zu debattieren, den großen Filmregisseur der Weimarer Zeit.
Wir wussten auch ein paar Dinge zu seinem Leben: in Österreich geborener Jude, katholisch aufgewachsen, im Ersten Weltkrieg drei Mal verwundet, danach in schneller Folge Schauspieler, Autor und Regisseur in den goldenen Tagen der UFA, dem berühmten Berliner Filmunternehmen der 20er Jahre. Als Studenten hatten wir uns tiefgründig über solche expressionistischen Klassiker ausgelassen wie Metropolis, hatten uns die ganzen fünf Stunden lang Die Nibelungen und vier Stunden Dr. Mabuse, der Spieler angeschaut. Vielleicht weil ich mir die Gauner gern als Helden vorstellte, mochte ich M besonders, mit Peter Lorre als Kindsmörder, der von der Unterwelt zur Strecke gebracht wird.
Aber nach 1933? Fritz Lang? Dreißig Jahre später? Ich hatte gelesen, dass er in Hollywood ein paar Filme produziert hatte, konnte mich aber nicht erinnern, irgendeinen davon gesehen zu haben. Für mich war er der Mann der Weimarer Zeit, und Punkt. Um ehrlich zu sein, war mir nicht mal klar gewesen, dass er überhaupt noch lebte. Noch immer hielt ich es für möglich, der Anruf könnte ein Scherz sein.
»Sie wollen mir also sagen, dass Dr. Mabuse unten wartet?«, fragte ich die betörende weibliche Stimme mit hoffentlich durchscheinender stolzer Skepsis.
»Es handelt sich um den Filmregisseur Fritz Lang, und er möchte sich wirklich mit Ihnen unterhalten«, wiederholt sie, beharrlich wie zuvor.
Wenn es sich um den echten Lang handelt, dann wird er die Augenklappe tragen, sage ich mir, ziehe ein frisches Hemd an und wähle eine Krawatte aus.
Er trug tatsächlich die Augenklappe. Er hatte auch eine Brille auf, was mich verwirrte: Wozu zwei Gläser für ein Auge? Er war ein kräftiger Mann mit einschüchternder Ausstrahlung und einem markanten Gesicht. Das kräftige Kinn eines Boxers, ein nicht sehr freundliches Lächeln. Hoher, grauer Hut, dessen Krempe sein gutes Auge vor dem Deckenlicht schützte. Er saß aufrecht auf seinem Stuhl wie ein alter Pirat. Den Kopf im Nacken, so als würde er etwas hören, von dem er nicht sicher war, ob es ihm gefiel. Kräftige Hände lagen auf dem Griff seines Gehstocks, den er zwischen die Knie geklemmt hatte. Das also war der Mann, der, so erzählt die Legende, Peter Lorre während der Dreharbeiten zu M in einem Anfall kreativer Leidenschaft die Treppe hinuntergeworfen hatte.
Die Frau mit der rauchigen Stimme saß neben ihm; ich habe nie herausgefunden, ob sie seine Geliebte, seine neue junge Frau oder seine Managerin war. Sie war eher in meinem Alter, und sie war entschlossen, unser Gespräch zu einem Erfolg zu führen. Sie bestellte englischen Tee und fragte mich, ob mir die Buchmesse gefallen würde. Ich log, ja sehr. Lang lächelte weiter mürrisch ins Leere. Als wir genügend Phrasen gewechselt hatten, ließ er uns eine Weile schweigen und verkündete dann in seinem Deutsch-Amerikanisch:
»Ich möchte aus Ihrem kleinen Buch Ein Mord erster Klasse einen Film machen«, daraufhin legte er mir eine schwere Hand auf den Unterarm und beließ sie dort. »Sie kommen nach Kalifornien. Wir schreiben ein Drehbuch zusammen, wir machen einen Film. Möchten Sie das?«
›Kleines Buch‹ brachte es ganz gut auf den Punkt, dachte ich, als ich wieder zu mir kam. Ich hatte es kurz nach meiner Versetzung an die britische Botschaft in Bonn in wenigen Wochen geschrieben. Die Geschichte handelt von dem Direktor eines Internats, der kurz vor der Pensionierung steht und einen seiner Schüler umbringt, um ein altes Verbrechen zu vertuschen. George Smiley wird eingeschaltet und kommt ihm auf die Schliche. Wenn ich heute so darüber nachdenke, leuchtet mir ein, dass die Geschichte, trotz all ihrer Schwächen, den Regisseur von M durchaus interessiert haben könnte. Das einzige Problem war George Smiley. Nach den Bedingungen eines Filmvertrags, den ich nicht hätte unterschreiben dürfen, hatte ich die Figur bei einem großen Filmstudio verpflichtet. Lang störte das nicht weiter.
»Hören Sie, ich kenne diese Leute. Das sind meine Freunde. Vielleicht lassen wir sie den Film finanzieren. Das ist ein gutes Geschäft für das Studio. Ihre Figur gehört ihnen, also müssen sie auch einen Film machen. Das ist ein gutes Geschäft für sie. Mögen Sie Kalifornien?«
Ich mag Kalifornien sehr.
»Sie kommen nach Kalifornien. Wir arbeiten zusammen, wir schreiben ein Drehbuch, wir machen einen Film. Schwarzweiß, wie Ihr Spion, der aus der Kälte kam. Haben Sie ein Problem mit Schwarzweiß?«
Überhaupt kein Problem.
»Haben Sie einen Filmagenten?«
Ich nenne ihm seinen Namen.
»Hören Sie, ich habe dem Kerl die Türen geöffnet. Ich rede mit Ihrem Agenten, wir machen einen Deal aus, nach Weihnachten setzen wir uns in Kalifornien zusammen und schreiben ein Drehbuch. Wäre nach Weihnachten okay für Sie?« – und noch immer lächelt er vor sich hin, und seine Hand liegt weiter auf meinem Unterarm.
Nach Weihnachten passt prima.
In der Zwischenzeit ist mir aufgefallen, dass die Frau neben ihm seine freie Hand leicht führt, wenn er nach der Teetasse greifen möchte. Er trinkt einen Schluck. Mit ihrer Hilfe stellt er die Tasse wieder ab. Er legt die Hand auf den Griff des Gehstocks. Dann greift er wieder nach der Tasse, und sie unterstützt ihn wieder dabei.
Ich habe nie wieder von Fritz Lang gehört. Das würde ich auch nicht, meinte mein Filmagent. Er verlor kein Wort zu Langs einsetzender Blindheit, doch das Urteil, das er aussprach, war nicht minder vernichtend: Fritz Lang war nicht mehr profitabel.
1968 inspirierte mein Roman Eine kleine Stadt in Deutschland für kurze Zeit auch Sydney Pollack. Unsere Zusammenarbeit, die noch dadurch verkompliziert wurde, dass Pollack das Skifahren in den Schweizer Bergen für sich entdeckt hatte, war nicht von Erfolg gekrönt gewesen, und die Filmgesellschaft, die die Rechte gekauft hatte, war nicht mehr im Geschäft, so dass die Rechte in einem juristischen Hickhack feststeckten. Falls ich überhaupt etwas über das Filmgeschäft gelernt hatte, dann die Notwendigkeit, mich nie wieder von Sydneys stürmischen, aber kurzlebigen Ausbrüchen der Begeisterung mitreißen lassen zu dürfen.
Verständlich also, dass ich sofort alles stehen und liegen ließ und den nächsten Flug nach New York nahm, als er mich zwanzig Jahre später mitten in der Nacht anrief und mir seine melodiöse Stimme lauthals verkündete, dass er aus meinem neuen Roman Der Nachtmanager den größten Film seiner Karriere machen wolle. Diesmal, so kamen Sydney und ich überein, würden wir uns reifer und weiser benehmen. Keine Schweizer Bergdörfer, kein verlockender Neuschnee, kein Martin Epp, keine Eiger-Nordwand. Diesmal sollte Robert Towne, damals der größte und sicherlich der teuerste Stern am Himmel der Drehbuchautoren, uns das Skript liefern. Paramount willigte ein, die Rechte zu kaufen.
In einem Unterschlupf in Santa Monica, wo uns ganz sicher niemand stören würde, wurden Sydney, Bob Towne und ich nicht müde, abwechselnd hin und her zu tigern und uns gegenseitig in Brillanz zu übertrumpfen, bis eine ungeheure Explosion unseren Überlegungen ein abruptes Ende setzte. Towne, der davon überzeugt war, dass Terroristen angegriffen hatten, warf sich zu Boden. Sydney, ganz der furchtlose Mann der Tat, rief über eine Telefonnummer, die wohl nur den Top-Regisseuren zur Verfügung stand, wie ich mir einrede, die Polizei von Los Angeles an. Ich hingegen schaute in meiner üblichen Geistesgegenwart wohl nur dumm.
Die Polizei beruhigt uns: Nur eine kleine Erderschütterung, Sydney, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Ach, übrigens, was für einen Film strickt ihr Jungs da unten eigentlich gerade zusammen? Wir brillierten weiter mit unseren Einfällen, wenn auch nicht mehr ganz so strahlend wie zuvor, und trennten uns bald. Towne würde eine erste Fassung erstellen, kamen wir überein. Sydney würde dann mit ihm daran arbeiten. Ich sollte mich im Hintergrund zur Verfügung halten.
»Falls Sie mal Hilfe brauchen, Bob, rufen Sie ruhig an«, sagte ich großherzig und gab ihm meine Telefonnummer in Cornwall.
Towne und ich wechselten nie wieder ein Wort miteinander. Als mein Flugzeug in Los Angeles abhob, meldete man uns über Lautsprecher, dass eine Warnung vor einem ausgewachsenen Erdbeben herausgegeben worden sei. Sydney hatte erklärt, nach Cornwall kommen zu wollen, sobald er Townes Erstfassung hätte. Damals hatte ich ein Gäste-Cottage in der Nähe unseres Hauses. Wir bereiteten alles vor. Pollack war, wie er sagte, gerade mit dem Schnitt eines John-Grisham-Thrillers beschäftigt, den er mit Tom Cruise in der Hauptrolle gedreht hatte. Unser Projekt sei als nächstes an der Reihe. Bob sitzt schon an der Arbeit. Er ist ganz aus dem Häuschen über dein Buch, David. Er liebt die Herausforderung. Er steht schon in den Startlöchern. Erst muss er noch ein paar andere Drehbücher zu Ende bringen. Weitere Neuigkeiten erreichen mich nur noch tröpfelnd, und der zeitliche Abstand zwischen ihnen wird immer größer. Towne hat Probleme mit dem Schluss, und Himmel, David, warum schreibst du auch so komplizierte Bücher?
Schließlich – wie immer mitten in der Nacht – der Anruf, auf den ich so geduldig gewartet habe: Treffen wir uns Freitag in Venedig. Der Film mit Cruise scheint wohl alle Rekorde zu brechen, fügt Sydney hinzu. Die Previews liefen phantastisch. Das Studio ist ganz aus dem Häuschen. Toll, sage ich, großartig, und wie geht’s Bob? Bis Freitag, David, meine Leute buchen dir eine Suite im Hotel. Ich lasse alles stehen und liegen und fliege nach Venedig. Sydney isst gern, aber er schlingt zu sehr, vor allem, wenn er abgelenkt ist. Bob geht’s prima, meint er vage, so als ginge es um den Gesundheitszustand eines abwesenden Freundes. Steckt ein wenig im Mittelteil fest. Er wird sich bald wieder darum kümmern. Mittelteil, Sydney? Ich dachte, er hätte mit dem Schluss so seine Probleme. Hängt miteinander zusammen, sagt Sydney. Und die ganze Zeit über trifft ein atemloser Bote nach dem anderen ein: Tolle Besprechungen, Sydney – schau hier, fünf Sterne und zwei Daumen hoch! – wir schreiben Unterhaltungsgeschichte, um Himmels willen! Sydney hat eine Idee. Warum fliege ich nicht einfach morgen mit ihm nach Deauville? Da zeigen sie den Film ebenfalls. Wir können uns ja im Flieger unterhalten. Da werden wir nicht gestört.
Am nächsten Morgen fliegen wir in Sydneys Learjet nach Deauville. Wir sind zu viert: Sydney und sein Kopilot, beide mit Kopfhörern und Mikrofonen ausgestattet, sitzen mit einem Ersatzpiloten im Cockpit, ich bin hinten in der Kabine. Sydneys Freund John Calley, zu dem Zeitpunkt Chef von Sony Columbia, und Stanley Kubrick, noch so ein Freak, wenn es um Flugsicherheit geht, haben mich davor gewarnt, mit Sydney zu fliegen. Rechne dir mal das statistische Risiko aus, mit einem Hobby-Jetpiloten zu fliegen, der faktisch null Meilen Flugerfahrung hat. Tu’s nicht. Nach einem unwahrscheinlich kurzen Flug landen wir in Deauville, und Sydney wird sofort von Studiomitarbeitern, Schauspieleragenten und PR-Leuten umschwirrt. Er verschwindet in der einen Limousine, ich werde zu einer anderen gebracht. In unserem Grandhotel wartet wieder eine riesige Suite auf mich, Blumen und Champagner von der Hotelleitung, eine Willkommenskarte adressiert an Monsieur David Carr. Ich rufe den Concierge und lasse mir einen Abfahrtsplan der Fähren bringen. Nach mehreren Versuchen werde ich endlich zu Sydneys Suite durchgestellt. Sydney, das ist ja alles ganz toll, aber du hast so viel zu tun, und ich glaube, dein Augenmerk ist im Augenblick nicht auf unser Projekt gerichtet. Ich glaube, ich verschwinde nach Hause, und wir reden weiter, wenn Bob sein Skript abgeliefert hat, okay?
Ganz besorgt fragt mich Sydney, wie ich denn von Deauville nach England kommen will. Mit der verfluchten Fähre, David? Ja, spinn ich? Nimm den verfluchten Learjet, um Himmels willen! Sydney, ehrlich, die Fähre ist prima, danke. Es fahren dauernd welche. Ich liebe Schiffe. Ich nehme den verfluchten Learjet. Diesmal sind wir zu dritt: Sydneys zwei Piloten vorn, ich allein in der Kabine. Der Flughafen Newquay ist groß genug, gehört zum Teil aber der Royal Air Force, wir dürfen also dort nicht landen. Wir fliegen nach Exeter. Ruck, zuck stehe ich mit dem Koffer in der Hand auf dem leeren Rollfeld des dortigen Flughafens, und der Learjet ist schon wieder auf halber Strecke nach Deauville. Ich schaue mich nach der Passkontrolle oder der Zollabfertigung um, finde aber nichts. Ein einsamer Arbeiter in einer orangen Warnweste macht sich an der Seite des Rollfelds an irgendetwas mit einer Kreuzhacke zu schaffen. Entschuldigung, ich bin gerade mit einem Privatflugzeug angekommen, können Sie mir sagen, wo ich den Zoll und die Passkontrolle finde? Von wo ich denn gekommen sei, will er diensteifrig wissen und stützt sich auf die Hacke. Frankreich? Das ist doch in der EU, Herrgott noch mal! Er schüttelt den Kopf über meine Unwissenheit und macht sich wieder an die Arbeit. Ich klettere über einen nicht sonderlich stabilen Zaun zum Parkplatz hinüber, wo schon meine Frau auf mich wartet.
Erst ein Jahr später, als Towne beim Edinburgh International Film Festival auftauchte und meinen Gewährsleuten zufolge von den unlösbaren Problemen sprach, meinen Roman für die große Leinwand umzuschreiben, wusste ich, dass das Spiel aus war. Himmel, David, Bob hat einfach diesen Schluss nicht hinbekommen.
Als Francis Ford Coppola anrief und mich auf sein Weingut im Napa Valley einlud, um mit ihm an einer Filmbearbeitung meines Romans Unser Spiel zu arbeiten, war ich mir sicher, dass es diesmal wirklich etwas werden würde. Ich flog nach San Francisco. Coppola schickte einen Wagen. Wie nicht anders zu erwarten, war es ein Traum, mit ihm zu arbeiten: schnell, präzise, kreativ, konstruktiv. In fünf Tagen, versicherte er mir, haben wir die Erstfassung fertig, wenn wir so weitermachen. Was wir taten. Die Zusammenarbeit lief erstklassig. Ich hatte auf dem Grundstück meine eigene Hütte, stand bei Sonnenaufgang auf und schrieb bis Mittag durch. Idyllisches Mittagessen im Kreis der Familie am großen Tisch, Coppola hat selbst gekocht. Ein Spaziergang am See, vielleicht ein kurzes Bad, dann arbeiteten wir für den Rest des Nachmittags gemeinsam weiter.
Nach fünf Tagen haben wir alles in trockenen Tüchern. Harrison wird es lieben, sagt Coppola. Er meint Harrison Ford. In Hollywood sind Nachnamen nur was für die, die nicht dazugehören. Es gibt einen kurzen gereizten Augenblick, als Coppola unser Skript an seinen Redakteur im Haus weiterreicht und es mit zahlreichen Markierungen und Randbemerkungen zurückkommt wie: »MIST! NICHT SAGEN, ZEIGEN!«, doch Coppola tut diese Bemerkungen mit einem Lachen ab. So sei sein Redakteur nun mal, sagt er. Nicht umsonst nennen sie ihn den Schnitter. Das Drehbuch würde am Montag an Harrison rausgehen. Ich könne nach England zurückfliegen und alles Weitere abwarten.
Also kehre ich nach England zurück und warte alles Weitere ab. Wochen vergehen. Ich rufe Coppola an, kriege aber nur seine Assistenz an die Strippe. Francis ist gerade sehr beschäftigt, David, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Nein, David, Harrison hat sich noch nicht gemeldet. Und das hat Harrison bis heute nicht, soweit ich das beurteilen kann. Funkstille einhalten kann niemand besser als Hollywood.
Erst als er mich anrief und wissen wollte, warum ich sein Angebot für die Filmrechte ausgeschlagen hätte, erfuhr ich von Stanley Kubricks Interesse, meinen Roman Ein blendender Spion zu verfilmen. Ich hatte Stanley Kubrick abgewiesen? Ich war erstaunt, ja entsetzt. Wir kennen uns, um Himmels willen! Nicht sehr gut, aber immerhin. Warum hatte er mich nicht angerufen und gesagt, dass er interessiert ist? Und was noch viel auffälliger war: Was glaubte denn mein Filmagent, was er da machte, mir nichts davon zu sagen, dass ihm ein Angebot von Kubrick vorliegen würde, nur um dann einen Vertrag mit BBC Television abzuschließen? Stanley, sagte ich, ich prüfe das sofort nach und melde mich dann wieder bei Ihnen. Wissen Sie noch, wann Sie das Angebot gemacht haben? Sofort, nachdem ich das Buch gelesen hatte, David. Wozu lange zögern?
Mein Agent war so perplex wie ich. Abgesehen von der BBC hatte es nur ein weiteres Angebot für Ein blendender Spion gegeben. Ein gewisser Dr. Feldman aus Genf, so hieß er, glaube ich, hatte die Option auf die Filmrechte erwerben wollen, um das Buch als Unterrichtsmaterial in einem Kurs zur Drehbucherstellung zu verwenden. Es sollte eine Art Wettbewerb werden. Dem Studenten mit dem besten Drehbuch winkte das Vergnügen, ein, zwei Minuten seiner Arbeit auf der großen Leinwand verwirklicht zu sehen. Für eine Zwei-Jahres-Option auf die Filmrechte von Ein blendender Spion könnten Dr. Feldman und seine Kollegen ein Honorar von fünftausend Dollar anbieten.
Ich wollte schon Kubrick anrufen und beteuern, dass seine Anfrage niemals bei mir eingetroffen sei, doch zögerte ich; stattdessen kontaktierte ich eine große Nummer in dem Studio, mit dem Kubrick manchmal arbeitete: meinen Freund John Calley. Calley kicherte. Also, das hört sich hundertprozentig nach unserem Stanley an. Immer auf der Hut, dass sein Name den Preis nicht nach oben treibt.
Ich rief Kubrick an und sagte rundheraus, wenn ich gewusst hätte, dass Dr. Feldman in seinem Namen gehandelt hätte, dann hätte ich es mir wohl anders überlegt und die Option nicht der BBC überlassen. Kubrick ließ sich nicht entmutigen und erwiderte, er würde sich freuen, die Regie bei der BBC-Serie zu übernehmen. Ich rief Jonathan Powell an, den Produzenten bei der BBC. Powell hatte schon für die Fernsehfassungen von Dame, König, As, Spion und Agent in eigener Sache verantwortlich gezeichnet. Er kämpfte gerade darum, für die Fassung von Ein blendender Spion alles zusammenzubringen. Und wie wäre es denn, wenn Stanley Kubrick die Regie führt, fragte ich ihn.
Stille. Powell, ein Mann, der nicht gerade zu emotionalen Ausbrüchen neigt, brauchte einen Augenblick, um sich zu sammeln.
»Nur damit das Budget um ein paar Millionen Pfund überschritten wird, meinen Sie?«, entgegnete er. »Und die Serie ein paar Jahre zu spät abgeliefert wird? Nein danke, ich glaube, wir lassen alles so, wie es ist.«
* Später von Kubrick verfilmt als Eyes Wide Shut, mit Tom Cruise und Nicole Kidman.
Kubricks nächster Vorschlag folgte auf dem Fuß: Ich sollte ihm einen Spionagefilm schreiben, der im Zweiten Weltkrieg in Frankreich spielen und sich um die Rivalität zwischen MI6 und Special Operations Executive (SOE) drehen sollte. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken, dachte darüber nach, es gefiel mir nicht, und ich sagte ab. Also gut, und wie wäre es, wenn ich eine erotische Novelle von Arthur Schnitzler* für den Film bearbeiten würde? Er habe die Rechte, sagte er, und ich fragte nicht, ob Dr. Feldman aus Genf sie als Unterrichtsmaterial erworben hatte. Ich sagte, mir seien Schnitzlers Werke bekannt und ich sei daran interessiert, die Novelle zu bearbeiten. Kaum hatte ich den Hörer aus der Hand gelegt, da hielt schon ein roter Mercedes vor meinem Haus, Kubricks italienischer Chauffeur sprang heraus, bewaffnet mit einer kopierten Übersetzung von Schnitzlers Traumnovelle, die ich nicht brauchte, und einem Haufen literarischer Kommentarbände.
Ein paar Tage später brachte mich derselbe Mercedes zu Kubricks riesigem Landhaus bei St. Albans. Ich war bereits mehrfach dort gewesen, dennoch war ich nicht darauf gefasst, in der Eingangshalle zwei riesigen Metallkäfigen gegenüberzustehen, einer mit Katzen besetzt, der andere mit Hunden. Falltüren und eiserne Laufgänge verbanden einen Käfig mit dem anderen. War einem Insassen danach, sich zur anderen Tierart zu gesellen, stand ihm das frei. Manche Tiere taten es, andere nicht, erklärte Kubrick. Es würde eine Weile dauern. Katzen und Hunde hatten eine lange gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten.
Verfolgt von Hunden, aber nicht von Katzen, schlendern Kubrick und ich über das Gelände, während ich auf seine Aufforderung hin darüber doziere, wie Schnitzlers Novelle als Film aussehen könnte. Der erotische Hintergrund der Novelle, deute ich an, wird durch die Befangenheiten und den Standesdünkel noch verstärkt. Das Wien der 20er mag ein Eldorado sexueller Freizügigkeit gewesen sein, zugleich herrschte aber auch gesellschaftliche und religiöse Bigotterie, es gab chronischen Antisemitismus und jede Menge Vorurteile. Jeder, der sich in der Wiener Gesellschaft bewegte – wie zum Beispiel unser junger Held, der sexbesessene Arzt –, setzte sich auf eigenes Risiko über die Konventionen hinweg. Die erotische Reise unseres Helden, die damit beginnt, dass er es nicht schafft, mit seiner wunderschönen jungen Frau zu schlafen, und seinen Höhepunkt in seinem verzweifelten Versuch findet, an einer Orgie im Haus eines österreichischen Adligen teilzunehmen, steckte voller gesellschaftlicher, aber auch physischer Gefahren.
Unser Film, sagte ich, als ich mich langsam für das Thema zu erwärmen begann, während wir in Begleitung einer Hundemeute über das Gelände wanderten, muss diese repressive Atmosphäre widerspiegeln und in den Kontrast zur Suche unseres Helden nach sexueller Identität stellen.
»Und wie sollen wir das anstellen?«, wollte Kubrick wissen, als ich mich gerade fragte, ob die Hunde wohl seine gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen.
Nun, Stanley, ich habe darüber nachgedacht, und ich finde, am besten nehmen wir eine mittelalterliche Stadt mit Stadtmauern oder ein Dorf, das sichtbar beengt ist.
Keine Reaktion.
Avignon, zum Beispiel – oder Wells in Somerset. Hohe Mauern – Festungsmauern – enge Gassen – dunkle Durchgänge.
Keine Reaktion.
Eine von der Kirche geprägte Stadt, Stanley, vielleicht katholisch wie Schnitzlers Wien, warum eigentlich nicht? Mit einem Bischofssitz, einem Kloster, einem Theologischen Institut. Hübsche junge Männer in Amtstracht, die an jungen Nonnen vorbeihuschen, ohne den Blick ganz abzuwenden. Kirchenglocken. Man kann den Weihrauch schon regelrecht riechen, Stanley.
Hört er mir zu? Ist er fasziniert oder nur zu Tode gelangweilt?
Und die großen Damen der Stadt, Stanley – nach außen hin streng religiös und so geübt heuchlerisch, dass man nicht mehr weiß ob man die Lady zur Rechten bei der Orgie letzte Nacht gevögelt hat oder ob sie daheim war, um mit den Kinderlein zu beten.
Ich habe meine Arie zu Ende gesungen, ich bin durchaus zufrieden mit mir, und wir gehen eine Weile schweigend weiter. Selbst die Hunde, so scheint mir, genießen stumm meine Redegewandtheit. Endlich sagt Stanley etwas.
»Ich glaube, wir werden ihn in New York spielen lassen«, und damit gehen wir zum Haus zurück.
31
Bernard Pivots Krawatte
Interviews sind selten angenehm. Meistens sogar anstrengend, langweilig, manchmal ausgesprochen furchtbar, vor allem dann, wenn der Interviewpartner ein Landsmann ist: der routinierte, komplexbehaftete Zeilenschinder, der seine Hausaufgaben nicht erledigt und das Buch nicht gelesen hat und glaubt, er würde einem einen Gefallen damit tun, die Reise auf sich genommen zu haben, aber jetzt braucht er was zu trinken; der aufstrebende Autor, der einen für zweitklassig hält und trotzdem erwartet, dass man sein work in progress liest; die Feministin, die davon ausgeht, dass man es nur geschafft hat, weil man ein sympathischer bürgerlicher, weißer männlicher Mistkerl ist, und man selbst schon fast fürchtet, sie könnte recht haben.
Im Gegensatz dazu sind meiner unmaßgeblichen Meinung nach Journalisten aus dem Ausland nüchtern, sorgfältig, haben das Buch in- und auswendig gelernt und kennen die Liste deiner Veröffentlichungen besser als du selbst – mit Ausnahme des gelegentlichen Querdenkers, wie dem jungen Franzosen von L’Evénement du jeudi, der sich von meiner Weigerung, ihm ein Interview zu geben, nicht abschrecken ließ, mein Haus in Cornwall observierte, es in seinem kleinen Leichtflugzeug in geringer Höhe überflog und ein weiteres Mal von einem küstennahen Fischerboot aus auskundschaftete, um dann über seine Eskapaden einen Artikel zu schreiben, der seinem Einfallsreichtum durchaus gerecht wurde.
Oder der Fotograf – ebenfalls Franzose, ebenfalls jung, aber von einem anderen Magazin –, der darauf bestand, dass ich mir Beispiele seiner Arbeiten anschaute, bevor er mich porträtieren wollte. Er schlug ein schmutziges Taschenalbum auf und zeigte mir Aufnahmen von solchen Berühmtheiten wie Saul Bellow, Margaret Atwood und Philip Roth, und nachdem ich sie alle pflichtbewusst bewundert und gelobt hatte, wie das meine Art ist, blätterte er zum nächsten Bild weiter, das die Rückansicht einer Katze zeigte, die gerade weglief und den Schwanz in die Höhe reckte.
»Sie mögen Arschloch von Katze?«, wollte er wissen und beobachtete sorgfältig meine Reaktion.
»Nettes Foto. Gut ausgeleuchtet«, erwiderte ich und brachte damit so viel Kaltblütigkeit auf, wie ich nur konnte.
Er zog die Brauen zusammen, und ein breites, hinterlistig wirkendes Grinsen huschte über sein ungeheuer junges Gesicht.
»Das Arschloch von Katze ist mein Test«, erklärte er stolz. »Wenn mein Modell schockiert ist, dann weiß ich, es ist nicht kultiviert.«
»Und, bin ich?«, fragte ich.
Für sein Porträt brauchte er eine Tür. Die Außenansicht einer Tür. Keine besondere Form oder Farbe, aber zurückgesetzt im Hintergrund, unscharf. Ich sollte hinzufügen, dass der Fotograf von sehr kleiner Statur war, fast elfenhaft, so dass ich beinahe versucht war, ihm anzubieten, seine große Kameratasche für ihn zu tragen.
»Ich möchte nicht für ein Spionagefoto posieren«, erkärte ich mit für mich untypischer Bestimmtheit.
Er wischte meine Bedenken beiseite. Die Tür hatte nichts mit Spionage zu tun, sondern mit Tiefsinn. Nach einer Weile taten wir eine auf, die seinen strengen Maßstäben genügte. Ich stellte mich davor und schaute auf Anweisung direkt in die Linse. So eine Linse hatte ich noch nie gesehen: eine Halbkugel, fünfundzwanzig Zentimeter Durchmesser. Der Fotograf hockte auf ein Knie abgestützt da, ein Auge am Sucher, als zwei sehr große, arabisch aussehende Männer hinter ihm stehen blieben und mich über seinen Rücken hinweg ansprachen.
»Entschuldigen Sie, bitte«, sagte der eine. »Können Sie uns den Weg sagen, bitte, zur U-Bahn Hampstead?«
Ich wollte ihn gerade Richtung Flask Walk schicken, als mein Fotograf, in Rage, aus seiner Konzentration gerissen worden zu sein, herumwirbelte und noch immer auf einem Knie aufgestützt lauthals schrie: »Verpisst euch!« Erstaunlicherweise gehorchten sie.
Von solchen Zwischenfällen mal abgesehen, haben meine französischen Interviewpartner in all den Jahren ein Feingefühl bewiesen, dem nachzueifern ihren britischen Kollegen gut zu Gesicht gestanden hätte. Das ist wohl auch der Grund, warum ich 1987 auf Capri mein Leben ganz in die Hände von Bernard Pivot gelegt habe, dem großen Star des französischen Kulturfernsehens, Gründer, Schöpfer und Moderator von Apostrophes, einer wöchentlichen literarischen Talkshow, die zu jenem Zeitpunkt schon seit dreizehn Jahren jeden Freitagabend zur besten Sendezeit la France entière in ihren Bann schlug.
Ich war nach Capri gekommen, um einen Preis entgegenzunehmen. Pivot ebenfalls. Ich im Bereich Literatur, Pivot in Journalismus. Stellen Sie sich Capri an einem perfekten Herbstabend vor. Zweihundert gutaussehende Dinnergäste haben sich unter einem sternenklaren Himmel versammelt. Das Essen ist göttlich, der Wein Ambrosia. An einem höher gelegenen Ehrentisch wechseln Pivot und ich ein paar beschwingte Worte. Pivot ist ein Mann in den besten Jahren – Anfang fünfzig, lebhaft, voller Energie, authentisch. Als er bemerkt, dass er der einzige Mann ist, der eine Krawatte trägt, reißt er einen Witz auf eigene Kosten, nimmt sie ab, rollt sie zusammen und stopft sie sich in die Tasche. Die Krawatte ist bedeutsam.
Im Laufe des Abends tadelt er mich, dass ich auf seine Einladungen, in seiner Sendung aufzutreten, nicht reagiert habe. Ich heuchle peinliche Verlegenheit. Ich müsse wohl gerade eine meiner Ablehnungsphasen durchmachen, sage ich zu ihm – was stimmte –, deshalb hätte ich die Sache schlicht vor mir hergeschoben.
Gegen Mittag am folgenden Tag erscheinen wir zur offiziellen Preisverleihung im Rathaus von Capri. Der ehemalige Diplomat in mir mahnt zu Anzug und Krawatte. Pivot kleidet sich ganz informell und stellt fest, dass er am Vorabend eine Krawatte getragen habe, als er keine brauchte, und nun keine hätte, wo doch alle anderen um ihn herum eine tragen würden. In seiner Dankesrede beklagt er seine mangelnden gesellschaftlichen Umgangsformen und verweist auf mich als Mann, der alles richtig macht, sich aber weigert, in seiner Sendung aufzutreten.
Ich lasse mich von seiner perfekt platzierten Charmeoffensive hinreißen, springe auf, nehme die Krawatte ab und sage – um der Dramatik willen – in einem vollen Saal voller begeisterter Zeugen, er könne die Krawatte haben, und er müsse nur mit ihr winken, dann würde ich auch in seiner Fernsehsendung auftreten. Am nächsten Morgen frage ich mich auf dem Rückflug nach London, ob Versprechen, die man auf Capri gibt, auch rechtlich bindend sind. Nach ein paar Tagen stelle ich fest: ja.
Ich habe mich dazu verpflichtet, ein Live-Interview zu geben, auf Französisch, fünfundsiebzig Minuten lang, geführt von Bernard Pivot und drei weiteren hochrangigen französischen Journalisten. Es wird kein Vorgespräch geben, mir werden im Vorfeld keine Fragen zugehen. Doch seien Sie gewarnt – so mein französischer Verleger –, das Gespräch wird ein breites Spektrum umfassen und auf alle möglichen Themen eingehen, Politik und Kultur, Literatur und Sex und was Bernard Pivot sonst noch alles in den lebendigen Sinn kommt.
Dabei habe ich kaum noch ein Wort Französisch gesprochen, seit ich diese Sprache dreißig Jahre zuvor unterrichtet habe.
Die Alliance Française sitzt in einem hübschen Eckhaus am Dorset Square. Ich holte tief Luft und trat ein. Am Empfangsschalter finde ich eine junge Frau mit kurzen Haaren und großen braunen Augen vor.
»Hallo«, sagte ich. »Ich wollte fragen, ob ich hier wohl mein Französisch ein wenig auffrischen könnte?«
Sie schaute mich in strenger Verwunderung an.
»Quoi?«, fragte sie, und danach sahen wir erst mal weiter.
Als Erstes sprach ich mit allem Französisch, das ich noch aufbringen konnte, mit Rita, dann mit Roland und schließlich mit Jacqueline, so die richtige Reihenfolge, glaube ich. Als ich Apostrophes erwähne, werden sie aktiv. Rita und Jacqueline werden sich mit dem Unterricht abwechseln. Das Ganze soll ein Aufbaukurs werden. Rita – oder war es Jacqueline? – wollte sich auf die Aussprache konzentrieren und mir dabei helfen, die Antworten auf mögliche Fragen zu formulieren. Jacqueline wollte, zusammen mit Roland, unseren Schlachtplan entwerfen. »Kenne deinen Feind«, sollte unser Prinzip lauten, deshalb studierten sie Pivots Psyche, dokumentierten sein Handwerkszeug und seine bevorzugten Diskussionsfelder und achteten genau auf den Einfluss des Tagesgeschehens. Offenbar legten die Produzenten von Apostrophes großen Wert auf die Aktualität der Sendung.
Dazu stellte Roland ein Archiv aus alten Ausgaben zusammen. Ich war entsetzt von der Schnelligkeit und Gewitztheit der Dialoge. Ohne meinen Tutoren etwas davon zu verraten, erkundigte ich mich heimlich, ob ich nicht vielleicht doch auf einem Dolmetscher bestehen könnte. Pivots Antwort kam prompt: Nach unseren Unterhaltungen auf Capri war er davon überzeugt, dass wir das auch ohne Hilfe schaffen würden. Als weitere Interviewpartner waren vorgesehen: Edward Behr, polyglotter Journalist und gefeierter Auslandskorrespondent, Philippe Labro, bekannter Autor, Journalist und Filmregisseur, und Catherine David, angesehene Literaturredakteurin.
Mein Widerwillen gegen Interviews jeglicher Art ist keine Heuchelei, doch ab und an gebe ich der Versuchung nach oder beuge mich dem Drängen meiner Verleger. Das Promispiel hat so gar nichts mit dem Schreiben zu tun und gehört in eine völlig andere Kategorie. Das war mir immer klar. Das Ganze ist reines Theater. Eine Übung in Selbstdarstellung. Und aus Sicht des Verlegers allerfeinste PR ohne weitere Kosten. Doch kann diese Öffentlichkeit Talent so schnell zerstören, wie sie es befördert. Ich kenne mindestens einen Schriftsteller, der nach einem ganzen Jahr auf weltweiter Werbetour das Gefühl hat, alle Kreativität für immer verloren zu haben, und ich fürchte, das kann ich nachvollziehen.
Persönlich hatte ich vom ersten Tag meiner Schriftstellerei an mit zwei offenkundigen Schwierigkeiten zu kämpfen: dem verworrenen Werdegang meines Vaters, der für jeden einsehbar war, der sich die Mühe machte und Nachforschungen anstellte, und mit meinen Verbindungen zum Geheimdienst, über die ich nach dem Gesetz nicht reden durfte und aus eigener Haltung nicht reden wollte. Schon vor meiner Karriere als Schriftsteller hatte ich den deutlichen Eindruck, dass Interviews sich ebenso um das drehen, was verschwiegen wird, wie um das, was gesagt wird.
All dies nur nebenbei, denn nun nehme ich auf der Bühne in einem vollbesetzten Studio in Paris Platz und tauche ein in das Land der heiteren Irrealität, das gleich neben dem Lampenfieber angesiedelt ist. Pivot trägt meine Krawatte, nimmt sie ab und will sie mir zurückgeben, dann erzählt er voller Verve die Geschichte, wie er in ihren Besitz kam. Die Zuschauer sind begeistert. Wir sprechen über die Berliner Mauer und den Kalten Krieg. Ein Ausschnitt aus Der Spion, der aus der Kälte kam verschafft mir etwas Atempause. Ebenso die längeren Beiträge der anderen Studiogäste, die eher an Leitlinien denken lassen, als dass sie nach Fragen klingen. Wir sprechen über Kim Philby, Oleg Penkowski, Perestroika, Glasnost. Offenbar hat mein Beraterstab bei der Alliance Française bei den Vorbereitungen all diese Themen erfasst, denn wenn ich mir die Aufnahmen so anschaue, zitiere ich fließend aus dem Gedächtnis. Wir sprechen voller Bewunderung über Joseph Conrad, Somerset Maugham, Graham Greene und Honoré de Balzac. Wir widmen uns Margaret Thatcher. War es Jacqueline, die mir den Aufbau der französischen rhetorischen Rede beigebracht hat – These, Antithese, Ausführung und eigene Zusammenfassung? Doch ganz gleich, ob nun Jacqueline, Rita oder Roland, ich spreche allen dreien meinen Dank aus, und wieder applaudiert das Publikum.
Wenn man Pivot so beobachtet, wie er live und vor Publikum agiert, das ganz in seinem Bann steht, dann begreift man sofort, dass es niemanden im Fernsehen weltweit gibt, der ihm auch nur im Ansatz das Wasser reichen kann. Es geht nicht nur um Charisma. Es geht nicht nur um Energie, Charme, Gewandtheit, Belesenheit. Pivot verfügt über die am wenigsten zu greifende Qualität von allen, ebenjene Qualität, für die Filmproduzenten und Casting-Direktoren auf der ganzen Welt alles geben würden: eine natürliche Offenheit der Seele, Herz. In einem Land, das berühmt dafür ist, aus dem Spott eine Kunst zu machen, signalisiert Pivot seinem Gegenüber vom ersten Augenblick an, dass schon alles gutgehen wird. Das spüren auch die Zuschauer. Sie sind seine Familie. Von den wenigen, an die ich mich noch erinnere, hat kein anderer Interviewer, kein anderer Journalist derart tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
Die Sendung ist vorüber. Ich darf das Studio verlassen. Pivot bleibt noch auf der Bühne und verliest die Abkündigungen der kommenden Woche. Robert Laffont, mein französischer Verleger, führt mich hinaus auf die leere Straße. Nicht ein Auto, nicht ein Passant, nicht ein Polizist. An diesem ungetrübten Sommerabend hat sich ganz Paris dem Schlummer ergeben.
»Wo sind denn alle?«, frage ich Robert.
»Die schauen noch Pivot, ist doch klar«, antwortet er zufrieden.
Warum ich diese Geschichte erzähle? Vielleicht, weil ich mich selbst daran erinnern möchte, dass es sich all des Reklamerummels zum Trotz um einen unvergesslichen Abend handelte. Von allen Interviews, die ich gegeben, und den vielen, die ich bereut habe, ist dies das einzige, das ich niemals zurücknehmen wollte.
32
Essen mit Gefangenen
* Le Portail, Versilio, 2001.
An jenem Sommertag in Paris zu Beginn des neuen Jahrtausends saßen wir zu sechst um den Esstisch. Unser Gastgeber war ein französischer Verleger, und wir hatten uns zusammengefunden, um den Erfolg meines Freundes François Bizot zu feiern, der gerade seine preisgekrönten Memoiren veröffentlicht hatte.*
Der Buddhismus-Forscher Bizot, der fließend Khmer spricht, ist der einzige westliche Ausländer, der von Pol Pots Roten Khmer gefangen genommen wurde und mit dem Leben davonkam. Während seiner Arbeit im Restaurierungszentrum von Angkor geriet er im Oktober 1971 in die Gefangenschaft der Roten Khmer, wurde unter barbarischen Umständen festgehalten und drei Monate lang intensiven Verhören durch den berüchtigten Douch unterzogen, der von Bizot das Geständnis forderte, Agent des CIA zu sein.
Irgendwie aber entwickelten Vernehmender und Gefangener eine mysteriöse Beziehung zueinander, wohl wegen Bizots grundlegender Kenntnisse in alter buddhistischer Kultur, vor allem aber auch, so nehme ich an, wegen der starken Anziehungskraft seiner Persönlichkeit. Douch schrieb daraufhin in einem Akt außergewöhnlichen Mutes einen Bericht an das Oberkommando der Roten Khmer und sprach Bizot vom Vorwurf der Spionage frei. Ebenso außergewöhnlich war die Tatsache, dass Bizot freikam; Douch leitete später eines der größten Folter- und Hinrichtungszentren Pol Pots. In meinem Roman Der heimliche Gefährte gibt es eine Figur namens Hansen, mit der ich um mehrere Ecken versuche, Bizots Erfahrungen gerecht zu werden – ohne Erfolg, wie ich befürchte.
Als wir uns am Tisch niederließen, lag Bizots Martyrium ganze dreißig Jahre zurück, doch Douchs Schicksal hing noch in der Schwebe, da sein Prozess infolge politischer Lethargie und Ränkespielerei immer wieder verschoben worden war. Bizot, so erfuhren wir nun, hatte sich in der Zwischenzeit schützend vor ihn gestellt. Bizots Argument, so lebhaft vorgetragen wie üblich, lautete, dass viele von Douchs Anklägern in der gegenwärtigen Khmer-Regierung ebenfalls Blut an den Händen hatten und nur darauf aus waren, Douch für all ihre Sünden verantwortlich zu machen.
Bizot führte also eine Ein-Mann-Kampagne, aber nicht zur Verteidigung von Douch, sondern um zu zeigen, dass er nicht schuldiger oder unschuldiger war als jene, die sich anmaßten, über ihn zu urteilen.
Bizot trug seinen Fall vor, und wir alle hörten aufmerksam zu, bis auf einen Gast, der auffällig ungerührt blieb. Er saß mir direkt gegenüber. Es handelte sich um einen kleinen gefühlstiefen Mann mit markanten Augenbrauen und einem dunklen, wachen Blick, der den meinen immer wieder traf. Er war mir als Jean-Paul Kauffmann vorgestellt worden, und ich hatte sein neuestes Buch, Die dunkle Kammer von Longwood, mit Vergnügen gelesen. Longwood war das Haus auf St. Helena, in dem Napoleon seine letzten demütigenden Jahre des Exils verbracht hatte. Kauffmann hatte die lange Seereise nach St. Helena unternommen und beschrieb mit beeindruckendem Einfühlungsvermögen Einsamkeit, Beengtheit und systematischen Verfall des berühmtesten, am meisten verehrten wie verachteten Gefangenen der Welt.
Ich hatte im Vorhinein nicht gewusst, dass ich den Autor treffen würde, und brachte spontan meine freudige Überraschung darüber zum Ausdruck. Warum aber schaute er mich weiter so ungnädig an? Hatte ich etwas Falsches gesagt? Wusste er etwas Skandalöses über mich, was ja durchaus im Bereich des Möglichen war? Oder waren wir uns schon einmal begegnet und ich hatte es schlicht vergessen, auch das nicht ausgeschlossen?
Entweder habe ich ihn direkt gefragt, oder meine Körpersprache drückte es aus. Plötzlich kehrte sich die Szene um, und ich war es nun, der ihn anstarrte.
Im Mai 1985 war Jean-Paul Kauffmann als französischer Auslandskorrespondent in Beirut von der Hisbollah als Geisel genommen worden und blieb drei Jahre lang deren heimlicher Gefangener. Wenn seine Kidnapper ihn von einem sicheren Unterschlupf zum anderen transportieren mussten, knebelten sie ihn, fesselten ihn von Kopf bis Fuß und rollten ihn in einen Orientteppich ein, worin er beinahe erstickt wäre. Er hatte mich derart intensiv angestarrt, weil er in einem der Verstecke auf eine zerlesene Taschenbuchausgabe eines meiner Romane gestoßen war und diesen immer und immer wieder verschlungen hatte. Ich bin mir sicher, dass er erheblich mehr Tiefgang in diesem Buch gesehen hatte, als überhaupt darin steckte. All das erzählte er mir in dem sachlichen Ton, den ich schon von anderen Folteropfern kannte, für die die noch immer lebendige Erfahrung Teil des Alltags geworden war.
Ich war sprachlos, denn was gab es da auch zu sagen? »Danke, dass Sie mein Buch gelesen haben?«, »Tut mir leid, wenn der Anspruch etwas zu kurz gekommen ist?«
Wahrscheinlich bemühte ich mich, so bescheiden zu klingen, wie ich mich fühlte; wahrscheinlich schlug ich nach unserer Begegnung noch einmal Die dunkle Kammer von Longwood auf und stieß auf die Verbindung, die ich schon bei der ersten Lektüre hätte finden sollen: Hier schrieb ein ruheloser Gefangener über einen anderen – über den womöglich größten Gefangenen aller Zeiten.
Obwohl das Essen zu Anfang dieses Jahrhunderts stattfand, ist die Erinnerung daran bis heute frisch geblieben, auch wenn ich Kauffmann seitdem nicht wieder begegnet bin und auch nicht mit ihm korrespondiert habe. Während ich also an diesem Buch hier saß, suchte ich im Internet nach ihm, stellte fest, dass er noch lebte, und erhielt nach einigem Herumfragen auch seine E-Mail-Adresse, wenn auch mit der Einschränkung, dass er möglicherweise nicht antworten würde.
Ich war bei meinen Recherchen ebenfalls auf den Hinweis gestoßen, wie ich zu meiner Überraschung gestehen muss, dass das Buch, das ihn durch einen glücklichen Zufall vor Verzweiflung und Wahnsinn bewahrt hatte, Leo Tolstois Krieg und Frieden gewesen war; er hatte es ebenso verschlungen wie meinen Roman; sicherlich hatte er aus diesem Buch erheblich mehr seelische und geistige Nahrung ziehen können als aus allem, was ich zu bieten hatte. Handelte es sich also um zwei Zufallsfunde? Oder spielte einem von uns beiden das Gedächtnis einen Streich?
Mit Bedacht formulierte ich meine E-Mail an ihn und erhielt ein paar Wochen später folgende wohlwollende Antwort:
Während meiner Gefangenschaft vermisste ich am schmerzlichsten Bücher. Ab und zu brachten die Wärter uns welche. Ein neues Buch war eine unbeschreibliche Freude. Ich las es nicht nur einmal, zweimal, zigmal, sondern auch von hinten nach vorn oder von der Mitte aus. Meine Absicht war, mit diesem Spiel vielleicht zwei Monate auszufüllen. In den drei leidvollen Jahren erlebte ich intensive Augenblicke der Freude. Der Spion, der aus der Kälte kam war ein solcher Augenblick. Ich betrachtete es als einen Wink des Schicksals; unsere Wärter gaben uns alles Mögliche: Groschenromane, den zweiten Band von Tolstois Krieg und Frieden, vollkommen unverständliche Traktate. Doch diesmal handelte es sich um einen Autor, den ich bewunderte … Ich hatte alle Ihre Romane gelesen, auch den Spion, doch unter den damaligen Umständen war es nicht mehr dasselbe Buch. Es schien noch nicht mal meinen Erinnerungen daran zu entsprechen. Alles war anders. Jede Zeile war bedeutungsschwer. Unter den Umständen, in denen ich mich befand, wurde das Lesen zu einer ernsten, ja gefährlichen Angelegenheit, denn schon das kleinste Detail schien mit diesem Spiel des Alles oder Nichts zu tun zu haben, auf dem die ganze Existenz einer Geisel basiert. Öffnete sich die Zellentür und tauchte ein offizieller Vertreter der Hisbollah auf, dann konnte das Freiheit oder Tod bedeuten. Jedes Zeichen, jede Anspielung wurde zu einem Omen, einem Symbol, einer Parabel. Und im Spion finden sich davon viele.
Durch dieses Buch spürte ich das Klima des Verheimlichens und der Manipulation (das schiitische Taqiyya) mit meinem ganzen Wesen. Unsere Kidnapper waren weit entfernt von der Professionalität der Männer des KGB oder der CIA, aber genau wie jene waren auch sie eingebildete Dummköpfe und brutale Zyniker, die den Glauben und die Leichtgläubigkeit der jungen Militanten dazu benutzten, um ihren eigenen Machthunger zu stillen.
Wie Ihre Figuren waren auch meine Kidnapper Experten, wenn es um Paranoia ging: pathologisches Misstrauen, manische Wut, Fehlurteile, Täuschungen, systematische Aggression, pathologische Lügensucht. Leamas’ ausgedörrte, absurde Welt, in der Menschen nur Schachfiguren sind, war unsere Welt. Wie oft habe ich mich gefühlt, als habe die Welt mich meinem Schicksal überlassen, mich verstoßen. Vor allem aber war ich erschöpft. In dieser heuchlerischen Welt begann ich auch, über meinen Beruf als Journalist nachzudenken. Eigentlich sind wir alle Doppelagenten. Womöglich Dreifachagenten. Wir fühlen mit anderen, um sie zu verstehen und selbst akzeptiert zu werden, dann betrügen wir sie.
Ihr Bild vom Menschen ist pessimistisch. Wir sind bedauernswerte Geschöpfe; als Individuen gelten wir nichts. Zum Glück trifft dies nicht auf alle zu (wie man an Liz sieht).
In dem Buch fand ich Grund zur Hoffnung. Das Wichtigste ist doch eine Stimme, eine Präsenz. Ihre. Die unbändige Freude eines Autors, der eine grausame, graue Welt beschreibt und sich daran ergötzt, sie so grau und hoffnungslos wie möglich zu zeigen. Das spürt man beinah körperlich. Jemand spricht mit dir, du bist nicht mehr allein. Ich war in meinem Gefängnis nicht länger verlassen. In meine Zelle trat ein Mann mit seinen Worten und seiner Vision von der Welt. Jemand verlieh mir Kraft. Ich würde es schaffen …
Und da hätten wir es, so funktioniert das Gedächtnis des Menschen, Kauffmanns, meins, unser beider. Ich hätte schwören können, und das stimmt mit der Erinnerung meiner Frau überein, dass es sich bei dem Buch, über das er beim Essen sprach, um Eine Art Held gehandelt hatte, nicht um Der Spion, der aus der Kälte kam.
33
Der Sohn des Vaters des Autors
Ich habe lange gebraucht, bis ich über Ronnie schreiben konnte, Hochstapler, Phantast, immer wieder mal Knastbruder und mein Vater.
Vom ersten Tag meiner zaghaften Versuche an, einen Roman zu verfassen, war eigentlich er derjenige, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte, doch war ich noch Lichtjahre davon entfernt, dieser Aufgabe auch gewachsen zu sein. Meine frühesten Entwürfe zu Ein blendender Spion troffen nur so vor Selbstmitleid: Wirf einen Blick, werter Leser, auf diesen emotional verkrüppelten Jungen, wie er vor seinem tyrannischen Vater zerstört am Boden liegt. Erst als er tot war und ich den Roman wieder in die Hand nahm, tat ich das, was ich schon am Anfang hätte tun sollen: Ich stellte die Sünden des Sohnes als erheblich verwerflicher dar als die des Vaters.
Erst nachdem das geklärt war, konnte ich das Erbe seines stürmischen Lebens anerkennen: einen Figurenstab, bei dem noch dem eingebildetsten Autor der Mund wässrig geworden wäre, von bedeutenden Rechtsgelehrten der damaligen Zeit und Stars aus Sport und Film bis hin zu dem Erlesensten, was die Londoner Unterwelt zu bieten hatte, und den wunderschönen Geschöpfen, die ihnen folgten. Wohin Ronnie auch ging, stets war das Unerwartete an seiner Seite. Geht es uns gut oder schlecht? Können wir an der örtlichen Tankstelle auf Pump volltanken? Ist er ins Ausland geflohen, oder wird er heute Abend stolz mit dem Bentley in der Einfahrt vorfahren? Wird er ihn im Hintergarten verstecken, alle Lichter im Haus löschen, Türen und Fenster kontrollieren und ins Telefon flüstern, falls das noch nicht abgestellt worden ist? Oder genießt er Sicherheit und Trost bei einer seiner Nebenfrauen?
Über Ronnies Machenschaften mit dem organisierten Verbrechen weiß ich bedauernswert wenig. Ja, er hatte Kontakt mit den berüchtigten Kray-Zwillingen, aber das mag vielleicht nur Promijagd gewesen sein. Ja, er machte irgendwelche Geschäfte mit Peter Rachman, dem schlimmsten Hausbesitzer, den London je gesehen hat, und ich vermute stark, dass Rachmans Schlägertypen die Mieter vergraulten, Ronnie die Häuser verkaufte und Rachman seinen Anteil bekam.
Aber eine waschechte kriminelle Komplizenschaft? Nicht der Ronnie, den ich kannte. Hochstapler sind Ästheten. Sie tragen gutsitzende Anzüge, haben saubere Fingernägel und sind allzeit sprachgewandt. Ronnies Vorstellungen nach waren Polizisten ausgezeichnete Kerle, mit denen man verhandeln konnte. Dasselbe ließ sich über die ›Jungs‹, wie er sie nannte, nicht sagen; mit denen legte man sich auf eigene Gefahr an.
Spannung? Sein ganzes Leben lang bewegte Ronnie sich auf dem dünnsten, glattesten Eis, das man sich nur vorstellen kann. Er empfand es nicht als Widerspruch, wegen Betrugs gesucht zu werden und sich zeitgleich auf dem Pferderennplatz in Ascot mit einem grauen Zylinder im exklusiven Bereich der Rennstallbesitzer zu zeigen. Ein Empfang bei Claridge’s zur Feier seiner zweiten Heirat musste unterbrochen werden; er überredete zwei Beamte von Scotland Yard, die Verhaftung doch bitte auf das Ende der Party zu verschieben – in der Zwischenzeit könnten sie gern hereinkommen und mitfeiern, was die zwei Männer auch taten.
Ich glaube nicht, dass Ronnie ein anderes Leben hätte führen können. Ich glaube auch nicht, dass er das gewollt hätte. Er war süchtig nach Krisen, nach Auftritten, war ein schamloser Kanzelredner und stand immer im Rampenlicht. Er war ein geradezu wahnhafter Charmeur und Überredungskünstler, der sich selbst als Günstling der Götter sah und das Leben vieler Menschen ruinierte.
Graham Greene schreibt, das Guthaben eines Schriftstellers sei seine Kindheit. Nach dieser Rechnung zumindest bin ich als Millionär auf die Welt gekommen.
Im letzten Drittel seines Lebens – Ronnie starb ganz plötzlich mit neunundsechzig – hatten wir uns entfremdet oder lagen uns in den Haaren. Schon fast in beiderseitigem Einvernehmen kam es zwangsläufig zu fürchterlichen Szenen, und wenn wir das Kriegsbeil begruben, vergaßen wir nie, wo genau es lag. Bin ich ihm heute wohlgesinnter als damals? Manchmal verdränge ich die Gedanken an ihn, manchmal ist er noch immer der Berg, den es zu bezwingen gilt. So oder so ist er immer anwesend. Über meine Mutter kann ich das nicht sagen, denn bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, was für eine Art Mensch sie war. Was ich von denen, die ihr nahestanden und sie liebten, über ihre verschiedenen Seiten gehört habe, hat mich nicht weitergebracht. Vielleicht wollte ich das auch gar nicht. Ich lernte sie erst kennen, als ich einundzwanzig war, und kümmerte mich danach weitgehend um ihre Bedürfnisse, wenn auch nicht immer sonderlich freundlich. Doch vom Tag unseres Wiedersehens bis zu ihrem Tode zeigte das eingefrorene Kind in mir nicht die kleinsten Anzeichen des Auftauens. Liebte sie Tiere? Die Natur? Das Meer, an dessen Küste sie lebte? Musik? Malerei? Mich? Hat sie gelesen? Von meinen Büchern hatte sie keine hohe Meinung, aber was war mit denen anderer?
In dem Pflegeheim, in dem sie in ihren letzten Jahren lebte, verbrachten wir viel Zeit damit, über die Untaten meines Vaters zu jammern oder zu lachen. Im Laufe der Zeit ging mir auf, dass sie sich – und mir – eine glückliche Mutter-Sohn-Beziehung zurechtgebastelt hatte, die von meiner Geburt an bis in die Gegenwart reichte.
Im Rückblick auf meine Kindheit erinnere ich mich an keinerlei Gefühl der Zuneigung, außer zu meinem älteren Bruder, der eine Zeitlang mein Elternersatz war. Ich erinnere mich an eine große innere Anspannung, die selbst im hohen Alter nicht nachgelassen hat. Ich erinnere mich nur an wenig aus der Zeit, als ich sehr klein war. Ich erinnere mich an die Heucheleien, als wir älter wurden, und an mein Bedürfnis, mir eine Identität zusammenzuschustern, und um das zu tun, bediente ich mich an den Verhaltensmustern und der Lebensweise von Gleichaltrigen und Respektspersonen, bis ich irgendwann tatsächlich ein stabiles Zuhause mit richtigen Eltern und Ponys vortäuschte. Wenn ich mir heute zuhöre oder zuschaue, dann entdecke ich noch immer Spuren der verschollenen Originale, vor allem natürlich meines Vaters.
Das alles machte mich natürlich zum geeigneten Rekruten der geheimen Flagge. Doch nichts hielt für lange: nicht der Lehrer in Eton, nicht der Mann beim MI5, nicht der Mann beim MI6. Nur der Schriftsteller in mir hat seinen Kurs beibehalten. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann sehe ich es als eine Abfolge aus Verpflichtungen und Fluchten, und ich bin heilfroh, dass das Schreiben mich halbwegs auf der Höhe und bei Verstand gehalten hat. Die Weigerung meines Vaters, auch nur die offenkundigste Wahrheit über sich zu akzeptieren, hat mich auf einen Weg des Zweifelns geführt, von dem ich nie wieder abgewichen bin. Ohne Mutter oder Schwestern lernte ich die Frauen erst spät kennen, wenn überhaupt, und sie und ich zahlten einen hohen Preis dafür.
In meiner Kindheit versuchten alle um mich herum, mir den christlichen Gott in der einen oder anderen Form unterzujubeln. Die reformierte Kirche lernte ich durch Tanten, Onkel und Großeltern kennen, die Hochkirche durch die Schule. Als ich zur Firmung vor dem Bischof stand, tat ich mein Bestes, um mich fromm zu fühlen, spürte aber nichts. Weitere zehn Jahre lang versuchte ich, irgendeine Form von religiöser Überzeugung zu entwickeln, doch dann gab ich es auf. Heute habe ich keinen Gott neben der Natur, und ich erwarte mir vom Tod nichts außer dem Tod. Ich erfreue mich immer an meiner Familie, an den Menschen, die mich lieben und die auch ich liebe. Wenn ich an den Klippen Cornwalls entlangwandere, überkommen mich Wellen der Dankbarkeit für mein Leben.
Ja, ich kenne das Haus, in dem ich geboren wurde. Gutgelaunte Tanten haben es mir im Vorbeifahren Hunderte Male gezeigt. Doch ich ziehe dem ein anderes Haus vor, eins, das ich in meiner Einbildung gebaut habe. Es ist alt und verlottert und mit roten Ziegeln, steht kurz vor dem Abriss, die Fenster sind kaputt, im Garten stehen ein »Zu Verkaufen«-Schild und eine alte Badewanne; es steht auf einem Grundstück voller Unkraut und Bauschutt, und in der zertrümmerten Haustür ist ein Stück Bleiglas zurückgeblieben – ein Ort, an dem sich Kinder verstecken, aber nicht geboren werden. Und doch bin ich hier zur Welt gekommen, darauf beharrt meine Vorstellungskraft, und dazu noch auf dem Dachboden, inmitten gestapelter brauner Kartons, wie sie mein Vater immer mit sich herumkarrte, wenn er mal wieder auf der Flucht war.
Als ich diese Kartons zum ersten Mal heimlich öffnete, etwa zu der Zeit, als der Zweite Weltkrieg ausbrach – mit acht Jahren war ich schon ein gut ausgebildeter Spion –, fanden sich nur persönliche Gegenstände darin: die Insignien seiner Mitgliedschaft bei den Freimaurern, Perücke und Robe eines Rechtsanwalts, mit denen mein Vater die wartende Welt überraschen würde, sobald er dazu gekommen wäre, Jura zu studieren, und solche äußerst geheimen Dinge wie seine Pläne, dem Aga Khan ganze Flugzeugflotten zu verkaufen. Als der Krieg dann ausbrach, wurden die braunen Kartons mit weit wichtigeren Dingen gefüllt: Mars-Riegel vom Schwarzmarkt, Benzedrin-Inhalatoren, um sich Aufputschmittel in die Nase zu ziehen, und nach dem D-Day Nylonstrümpfe und Kugelschreiber.
Ronnie hatte eine Vorliebe für skurrile Handelsgüter, Hauptsache, sie waren rationiert oder gar nicht zu bekommen. Zwei Jahrzehnte später, als Deutschland noch geteilt war und ich als britischer Diplomat am Rheinufer in Bonn lebte, tauchte er, den massigen Leib in ein stählernes, rundes Boot mit vier Rädern gequetscht, unerwartet in meiner Einfahrt auf. Es würde sich dabei um ein Amphibienfahrzeug handeln, erklärte er. Ein Prototyp. Er habe von den Herstellern in Berlin das britische Patent erworben und sei im Begriff, uns reich zu machen. Er war mit dem Fahrzeug unter den Augen der ostdeutschen Grenzwachen die Transitstrecke hinuntergefahren, und nun beabsichtigte er, den Wagen mit meiner Hilfe im Rhein zu Wasser zu lassen, das zu der Zeit recht hoch stand und eine starke Strömung hatte.
Ich brachte ihn trotz der Begeisterung meiner Kinder davon ab und machte ihm stattdessen etwas zu essen. Wieder gestärkt, brach er unter großem Trara nach Ostende und England auf. Wie weit er kam, weiß ich nicht, denn von dem Fahrzeug war nie wieder die Rede. Ich nehme an, dass seine Gläubiger ihn irgendwo unterwegs aufgehalten und es ihm abgenommen haben.
Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, zwei Jahre später in Berlin aufzutauchen und sich zu meinem ›Professionellen Berater‹ zu erklären, um sich dann in dieser Eigenschaft auf eine VIP-Tour durch Westberlins größtes Filmstudio zu machen, sich auf Kosten des Studios bewirten zu lassen und ein, zwei Starlets zu bezirzen. Dazu kam noch jede Menge Verkaufsjargon über Steuerfreiheiten und Fördermittel für ausländische Filmproduzenten, vor allem für die Macher des Films, der auf meinem neuesten Roman basierte, Der Spion, der aus der Kälte kam.
Selbstredend hatten weder die Paramount Pictures, die ihre Verträge bereits mit den Ardmore Studios in Irland abgeschlossen hatten, noch ich selbst die leiseste Ahnung, was er eigentlich im Schilde führte.
In meinem Geburtshaus gibt es keinen Strom und keine Heizung, und das wenige vorhandene Licht stammt von der Gasbeleuchtung auf dem Constitution Hill, so dass der Dachboden in ein cremiges Licht getaucht ist. Meine Mutter liegt auf einem Feldbett und tut kläglich ihr Bestes, was immer das Beste in solch einem Fall ist – als ich mir diese Szene zum ersten Mal vorstellte, war ich mit den Einzelheiten einer Geburt noch nicht sonderlich vertraut. Ronnie steht ungeduldig in der Tür, er trägt einen eleganten Zweireiher und die braunweißen Brogues, in denen er Golf spielte, behält durch das Fenster die Straße im Auge und ermahnt meine Mutter im stampfenden Takt zu größerer Anstrengung:
»Du meine Güte, Wiggly, warum kannst du dich denn nicht wenigstens einmal beeilen? Das ist eine elende Schande, das ist es, also wirklich. Da draußen hockt der arme alte Humphries im Wagen und holt sich noch den Tod, und alles, was du kannst, ist Trödeln.«
Obwohl meine Mutter mit Vornamen Olive hieß, nannte mein Vater sie Wiggly, was auch geschehen mochte. Später, als ich technisch gesehen erwachsen wurde, gab ich den Frauen ebenfalls alberne Spitznamen, um ihnen etwas von dem zu nehmen, was mir solchen Respekt einflößte.
Als ich klein war, klang Ronnies Aussprache mit den schweren Rs und langen As noch immer nach Dorset. Doch er bügelte seine Sprache bereits glatt, und als ich jugendlich war, konnte er sich schon fast – aber nie perfekt – gewählt ausdrücken. Die Zunge, so sagt man, kennzeichnet den Engländer, und in jenen Tagen konnte einem eine gewählte Aussprache einen Dienstgrad beim Militär einbringen, Kredit bei der Bank, eine respektvolle Behandlung durch die Polizei und eine Stellung in der City of London. Es macht einen Teil der Ironie aus, die Ronnies unstetes Leben kennzeichnet, dass er sich nach den grausamen Maßstäben der damaligen Zeit unter seine Söhne stellte, als er es schaffte, meinen Bruder und mich auf noble Schulen zu schicken. Tony und ich durchstießen mühelos die Klassenschranken, Ronnie blieb auf der anderen Seite zurück.
Nicht, dass er tatsächlich für unsere Ausbildung bezahlte – zumindest nicht immer, soweit ich das feststellen kann –, das regelte er auf seine Weise. Eine Schule, die schon einen Vorgeschmack von seiner Art bekommen hatte, verlangte mutig Vorauszahlungen. Sie erhielt diese dann nach Ronnies Belieben in Form von Mangelware: Trockenfrüchte vom Schwarzmarkt – Feigen, Bananen, Pflaumen – und eine Kiste absolut unerschwinglichen Gins für die Lehrerschaft.
Seiner äußeren Erscheinung nach blieb er stets ein höchst respektabler Mann, und darin zeigte sich sein Genie. Respekt, nicht Geld, war ihm am allerwichtigsten. Tag für Tag suchte er nach Anerkennung. Sein Urteil über andere hing vollständig davon ab, wie sehr diese ihn respektierten. Auf der einfachen Stufe des gewöhnlichen Lebens gibt es in jeder zweiten Straße in London, in jeder Kreisstadt einen Ronnie. Er ist der Rabauke, der einem auf die Schultern klopft, der knallharte, rotzfreche Junge, der gern Süßholz rapselt, der Leuten Champagnerpartys schmeißt, die es nicht gewohnt sind, Champagner spendiert zu bekommen, der seinen Garten für das Gemeindefest der örtlichen Baptistengemeinde öffnet, obwohl er nie einen Fuß in die Kirche setzt, der Ehrenvorsitzender der Jugendfußballmannschaft und des Männer-Kricketteams ist und bei den Meisterschaften die Silberpokale überreicht.
Bis sich eines Tages herausstellt, dass er den Milchmann seit einem Jahr nicht bezahlt hat, auch nicht an der Tankstelle oder im Zeitungsladen, nicht beim Weinlieferanten oder in dem Geschäft mit den Silberpokalen, und vielleicht macht er Pleite oder muss ins Gefängnis, seine Frau nimmt die Kinder, zieht zu ihrer Mutter und lässt sich schließlich scheiden, weil sie herausfindet – dabei wusste ihre Mutter das schon die ganze Zeit –, dass er mit allen Frauen in der Nachbarschaft herumgemacht und Kinder gezeugt hat, die er nie erwähnt hat. Und wenn unser rotzfrecher Junge wieder draußen ist oder sich zusammenreißt, dann wird er für eine Weile ein bescheidenes Leben führen, Gutes tun und sich an den kleinen Dingen erfreuen, bis es ihn wieder packt und er mit den alten Spielchen weitermacht.
Mein Vater war von diesem Schlag, keine Frage. Aber das war nur der Anfang. Der Unterschied liegt im Maßstab, in seiner geradezu bischöflichen Haltung, in seiner alles vereinnahmenden, würdevollen Stimme, seiner Miene verletzter Unantastbarkeit, wenn jemand es wagte, sein Wort, seine unbegrenzte Macht zur Selbsttäuschung in Frage zu stellen. Wenn der durchschnittliche freche Junge den letzten Rest Haushaltsgeld beim Nachmittagsrennen in Newmarket verliert, hängt Ronnie entspannt am großen Tisch in Monte Carlo herum, einen Brandy Ginger vor sich, mit Empfehlung des Hauses. Ich sitze mit meinen siebzehn Jahren neben ihm und mache auf älter, auf der anderen Seite haben wir den etwa fünfzigjährigen Stallmeister von König Farouk. Der Stallmeister ist an diesem Tisch höchst willkommen. Seine Verluste haben den Tisch schon viele Male bezahlt. Der Stallmeister hat sich in Schale geworfen, er hat graue Haare, ist ganz harmlos und sehr müde. Das weiße Telefon neben seinem aufgestützten Arm ist die direkte Verbindung zum ägyptischen König, der von seinen Astrologen umgeben ist. Das Telefon klingelt, der Stallmeister nimmt die Hand vom Kinn, hebt ab, lauscht mit halbgesenkten Augenlidern und setzt folgsam einen weiteren Batzen des Reichtums Ägyptens auf Rot oder Schwarz oder welche Zahl auch immer die astrologischen Zauberer von Alexandria oder Kairo für glückbringend erachten.
Ronnie hat sich das Prozedere schon eine Weile angeschaut, ein kampfeslustiges Lächeln auf den Lippen, das besagt: ›Wenn du es so haben willst, alter Knabe, dann ist das wohl so.‹ Und er erhöht seinen eigenen Einsatz. Entschlossen. Zehner werden zu Zwanzigern. Zwanziger zu Fünfzigern. Und während er mit seinen letzten Chips nicht geizt und herrisch nach weiteren verlangt, erkenne ich, dass er nicht einer Eingebung folgt oder gegen das Haus oder auf bestimmte Zahlen setzt. Er spielt gegen König Farouk. Setzt Farouk auf Schwarz, setzt Ronnie auf Rot. Setzt Farouk auf Ungerade, setzt Ronnie auf Gerade. Jetzt reden wir von Hunderten (heute wären es Tausende). Und was Ronnie dem König von Ägypten damit sagen will – während ein Halbjahr, dann ein ganzes Jahr an Schulgebühren im Schlund des Croupiers verschwinden –, sein, Ronnies, Draht zum Allmächtigen ist erheblich wirkmächtiger als der von irgendeinem unbedeutenden arabischen Potentaten.
Im weichen blauen Zwielicht von Monte Carlo vor der Morgendämmerung schlendern Vater und Sohn nebeneinander die Esplanade entlang und suchen einen Juwelier auf, der rund um die Uhr geöffnet hat, um Ronnies Platin-Zigarettenetui, den goldenen Füllfederhalter und die Armbanduhr zu versetzen. Bucherer? Boucheron? Mir ist warm. »Morgen gewinnen wir alles mit Zinsen zurück, stimmt’s, mein Junge?«, meint Ronnie, als wir uns im Hôtel de Paris zu Bett legen, wo er unsere Zimmerrechnungen gnädigerweise schon vorab bezahlt hat. »Pünktlich zehn Uhr«, fügt er noch streng hinzu, damit ich ja nicht auf den Gedanken komme, später zu simulieren.
Nun bin ich also auf der Welt. Kind meiner Mutter, Olive. Gehorsam, mit der von Ronnie geforderten Eile. Mit einem letzten Pressen, um den Gläubigern zuvorzukommen und zu verhindern, dass sich Mr Humphries den Tod holt, während er draußen in seinem Lanchester hockt. Denn Mr Humphries ist nicht irgendein Taxifahrer, sondern ein wertvoller Verbündeter, bezahltes Mitglied des exotischen Hofstaats, mit dem Ronnie sich umgibt, und ein hervorragender Amateurzauberer, der Tricks mit Seilen und Schlingen draufhat. In besseren Zeiten wird er durch Mr Nutbeam und einen Bentley ersetzt, doch in schlechten Zeiten erweist uns Mr Humphries mit seinem Lanchester stets einen Gefallen.
Ich bin auf der Welt und werde, zusammen mit der überschaubaren Habe meiner Mutter, eingepackt, denn wir haben erst kürzlich wieder mal den Gerichtsvollzieher im Haus gehabt und reisen mit leichtem Gepäck. Ich werde in den Kofferraum von Mr Humphries’ Taxi geladen, wie später einer von Ronnies geschmuggelten Schinken. Dazu kommen noch die braunen Kartons, und der Kofferraum wird von außen verriegelt. Ich schaue mich in der Dunkelheit nach meinem älteren Bruder Tony um. Er ist nirgends zu sehen. Auch Olive, alias Wiggly, nicht. Egal, ich bin auf der Welt, und schon renne ich los wie ein neugeborenes Fohlen. Seit jenem Tag bin ich auf der Flucht.
Ich habe noch eine weitere zurechtgestrickte Kindheitserinnerung, die wohl ebenso falsch ist, wenn es nach meinem Vater geht, der es ja wohl am besten wissen müsste. Vier Jahre später, ich bin in Exeter und überquere einen Streifen Ödland. Ich gehe an der Hand meiner Mutter Olive, alias Wiggly. Da wir beide Handschuhe tragen, gibt es keinen direkten Körperkontakt. Und soweit ich mich erinnern kann, hat es den auch nie gegeben. Ronnie hat mich in den Arm genommen, Olive nie. Sie war die Mutter ohne Geruch; Ronnie wiederum verströmte den Duft von guten Zigarren und dem süßlichen Haaröl von Taylor of Old Bond Street, Hoflieferant, und wenn man die Nase in den Wollstoff von einem von Mr Bermans geschneiderten Anzügen drückte, dann schien es fast so, als könne man Ronnies Frauen ebenfalls riechen. Als ich mit einundzwanzig am Bahnsteig 1 im Bahnhof von Ipswich auf Olive zuging, bei unserem Wiedersehen nach sechzehn berührungslosen Jahren, stellte ich mich sehr ungelenk an, als ich sie umarmte. Sie war so groß, wie ich sie in Erinnerung hatte, ganz knochig und ohne gut zu greifende Kontur. Mit ihrem unsicheren Gang und dem langen, verletzlichen Gesicht hätte sie genauso gut mein Bruder Tony mit Ronnies Anwaltsperücke auf dem Kopf sein können.
Doch noch sind wir in Exeter, und ich halte mich an Olives behandschuhter Hand fest. Am anderen Ende des Ödlands liegt eine Straße, von hier aus kann man eine hohe, rote Ziegelmauer erkennen, die oben mit Stacheldraht und Glas gespickt ist, und hinter der Mauer ein trostloses Gebäude mit unauffälliger Fassade und vergitterten Fenstern, hintern denen kein Licht brennt. An einem dieser vergitterten Fenster steht mein Vater; ich kann ihn von der Schulter aufwärts erkennen, und er sieht genauso aus wie der Häftling im Monopoly-Gefängnis, wenn man direkt ins Gefängnis muss, ohne über Los zu gehen und zweihundert Pfund einzuziehen. Und genau wie der Monopoly-Häftling hält er sich mit den großen Händen an den Stäben fest. Immer haben Frauen ihm gesagt, was für schöne Hände er doch habe, und ständig bearbeitete er sie mit einem Nagelklipser, den er in der Jackentasche bei sich trug. Er drückt die breite, bleiche Stirn gegen die Stäbe. Er hatte nie sonderlich viel Haar, und das wenige, das noch wuchs, zog sich in einem engen, schwarzen, wohlriechenden Kranz um seinen Kopf, was nur noch mehr zu dem Heiligenbild beitrug, das er von sich hegte. Im Alter wurde der Kranz grau und verschwand dann ganz, doch die Falten des Alters und des Verfalls, die er sich so reichlich verdient hatte, blieben aus. Goethes Ewig-Weibliches herrschte in ihm vor bis zum Ende.
Olive zufolge war Ronnie so stolz auf seinen Kopf wie auf seine Hände, und schon bald nach ihrer Hochzeit verpfändete er ihn für fünfzig Pfund an die medizinische Forschung, bar und vorab, Lieferung der Ware nach seinem Tod. Keine Ahnung, wann sie mir das erzählte, aber ich weiß, dass ich von dem Tag an, als ich es erfuhr, Ronnie mit dem distanzierten Blick eines Henkers betrachtete. Er hatte einen sehr kräftigen Hals, der nur in einem schwach erkennbaren Ansatz in den Oberkörper überging. Ich fragte mich, wohin ich mit dem Beil zielen würde, wenn ich den Job machen müsste. Ronnie in Gedanken umzubringen war eine meiner frühen Lieblingsbeschäftigungen, und selbst nach seinem Tod packte mich immer wieder mal diese Vorstellung. Wahrscheinlich ist das nur ein Ausdruck meiner Verzweiflung darüber, dass ich ihn niemals wirklich einordnen konnte.
Noch immer laufe ich an Olives Handschuhhand, winke zu Ronnie hoch, und Ronnie erwidert es auf seine ihm eigene Art: Er lehnt sich zurück, hält den Oberkörper stocksteif, und eine prophetische Hand gebietet über den Himmel in der Höhe. »Daddy, Daddy!«, rufe ich. Meine Stimme klingt wie die eines Riesenfroschs. Später stapfe ich wieder an Olives Hand zurück zum Auto und bin recht zufrieden mit mir. Schließlich hält nicht jeder kleine Junge seinen Vater in einem Käfig und hat seine Mutter für sich allein.
Meinem Vater zufolge hat dies alles aber gar nicht stattgefunden. Die Vorstellung, dass ich ihn jemals in irgendeinem Gefängnis gesehen haben könnte, traf ihn sehr – »Von vorn bis hinten erfunden, Junge«. Ja schon, räumte er ein, er hatte auch mal in Exeter gesessen, aber meistens war er in Winchester oder in Wormwood Scrubs gewesen. Er hatte nichts Kriminelles verbrochen, nichts, was nicht unter vernünftigen Menschen hätte geregelt werden können. Es ging ihm wohl ein wenig so wie dem Laufburschen, der sich ein paar Piepen aus der Portokasse geliehen hatte und ertappt worden war, bevor sich die Chance ergeben hatte, das Geld zurückzulegen. Aber das war nicht der Punkt, beharrte er. Der Punkt war, so vertraute er meiner Halbschwester Charlotte an, Tochter aus einer anderen Ehe, als er sich über mein ganz allgemein respektloses Betragen ihm gegenüber beklagte – das heißt darüber, dass ich ihm nichts von meinen Tantiemen abgab und auch keine paar Hunderttausend vorstreckte, damit er ein nettes Stückchen Grüngürtel erschließen konnte, das er einem Gemeinderat auf Abwegen abgeluchst hatte –, der Punkt war, dass jeder, der schon mal das Gefängnis in Exeter von innen gesehen hatte, wusste, dass man von den Zellen aus die Straße gar nicht sehen kann.
Ich glaube ihm. Noch immer. Ich täusche mich, und er hat recht. Er stand nie an diesem Fenster, ich habe ihm nie zugewinkt. Aber was ist die Wahrheit? Was Erinnerung? Wir sollten ein neues Wort für das erfinden, was wir an Vergangenem sehen, das in uns noch immer lebendig ist. Ich habe ihn in diesem Fenster gesehen, aber ich sehe ihn auch jetzt dort, wie er sich am Gitter festhält, die breite Brust in dieser Sträflingskleidung mit den aufgedruckten Pfeilen, wie man sie aus all den guten Comics aus Schultagen kennt. Ein Teil von mir hat ihn seitdem nie etwas anderes tragen sehen. Ich weiß, dass ich vier Jahre alt war, denn ein Jahr darauf war er wieder auf freiem Fuß, ein paar Wochen oder Monate später verschwand meine Mutter mitten in der Nacht, verschwand für sechzehn Jahre, bis ich sie in Suffolk wiedertraf, als Mutter von weiteren zwei Kindern, die groß geworden waren, ohne zu wissen, dass sie Halbbrüder hatten. Sie hatte nur ihren guten weißen, mit Seide ausgeschlagenen Lederkoffer von Harrods bei sich, den ich nach ihrem Tod in ihrem Cottage fand. Der einzige Gegenstand im ganzen Haus, der von ihrer ersten Ehe zeugte; ich habe ihn noch immer.
Ich sah Ronnie auch, wie er in der Zelle auf der Kante seiner Pritsche hockt, den verpfändeten Kopf in die Hände gestützt, ein stolzer junger Mann, der sein ganzes Leben lang noch nie hat hungern oder seine Socken waschen oder sein Bett hat machen müssen, und er denkt an seine drei frommen, in ihn vernarrten Schwestern und die Eltern, die ihn verehren, an seine Mutter mit dem gebrochenen Herzen, wie sie unentwegt die Hände wringt und sich mit ihrem irischen Akzent an Gott wendet: »Warum, warum?«, und er denkt an seinen Vater, den ehemaligen Bürgermeister von Poole, Stadtrat und Freimaurer. Beide sitzen im Geiste die Zeit mit Ronnie ab, beide warten auf ihn und bekommen darüber vorzeitig graue Haare.
Wie konnte Ronnie nur all die Gedanken ertragen, während er die Wand anstarrte? Wie kam er bei all seinem Stolz, seiner ungeheuren Energie und seinem Tatendrang mit der Enge zurecht? Ich bin so ruhelos, wie er es war. Ich kann keine Stunde stillsitzen. Ich schaffe es nicht, eine Stunde lang ein Buch zu lesen, es sei denn, es ist auf Deutsch. Selbst in einem guten Theaterstück sehne ich mich nach der Pause, um meine Beine zu vertreten. Wenn ich schreibe, muss ich andauernd aufspringen, dann renne ich durch den Garten oder die Straße hinunter. Ich muss nur für drei Sekunden im Klo festsitzen – der Schlüssel ist aus dem Schloss gefallen, und ich versuche linkisch, ihn wieder hineinzubekommen –, und mir bricht der Schweiß aus, und ich schreie, ich will raus. Ronnie aber hat in seinen besten Jahren ziemlich lange Haftstrafen abgesessen – drei, vier Jahre. Er saß noch die eine Strafe ab, während sie ihn schon für etwas anderes anklagten und ihm eine zweite Strafe aufbrummten, diesmal mit Schwerarbeit verbunden, was wir heute wohl Haftverschärfung nennen würden. Die Gefängnisaufenthalte, die später folgten – in Hongkong, Singapur, Djakarta, Zürich –, waren meines Wissens nach nur kurz. Als ich bei meinen Recherchen zu Eine Art Held in Hongkong war, lernte ich im Jardine-Matheson-Zelt auf dem Rennplatz Happy Valley seinen ehemaligen Gefängniswärter kennen.
»Mr Cornwell, Sir, Ihr Vater ist einer der feinsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Es war mir eine Ehre, über ihn zu wachen. Ich gehe bald in den Ruhestand, und wenn ich nach London zurückkehre, wird er mir einen Job besorgen.« Selbst im Gefängnis fütterte Ronnie sich noch seinen Wärter an.
Ich bin in Chicago und nehme an einer recht unmotivierten Kampagne zur Förderung des britischen Absatzmarktes teil. Der britische Generalkonsul, bei dem ich untergebracht bin, übergibt mir ein Telegramm. Unser Botschafter in Djakarta teilt mir mit, dass Ronnie im Gefängnis sitzt, und fragt, ob ich ihn freikaufen möchte. Ich gebe mein Wort, für jede mögliche Summe aufzukommen. Als sich herausstellt, dass es sich nur um ein paar Hundert Pfund handelt, bin ich doch ziemlich alarmiert. Ronnie muss das Glück verlassen haben.
Ronnie ruft mich aus dem Bezirksgefängnis in Zürich an, R-Gespräch. Dort sitzt er wegen offener Hotelrechnungen ein. »Sohn? Hier spricht dein alter Herr.« Was kann ich für dich tun, Vater? »Du kannst mich aus diesem verfluchten Gefängnis rausholen, Sohn. Das Ganze ist nur ein Missverständnis. Die Kerle bringen einfach die Fakten durcheinander.« Wie viel? Keine Antwort. Ein theatralisches Schlucken, dann liefert er mit der Stimme eines Ertrinkenden die Pointe: »Noch mehr Gefängnis schaff ich einfach nicht, Sohn.« Dazu die Schluchzer, die mich wie immer durchdringen wie langsam geführte Messer.
Ich habe meine zwei noch lebenden Tanten gefragt. Sie sprachen so wie Ronnie in jungen Jahren mit einem leichten, unbewussten Dorset-Akzent, den ich sehr gerne höre. Wie hat Ronnie die erste Haftstrafe überstanden? Wie hat es ihn beeinflusst? Wie war er vor dem Gefängnis? Wie danach? Aber meine Tanten sind keine Historikerinnen, sie sind seine Schwestern. Sie lieben Ronnie und ziehen es vor, nicht weiter darüber nachzudenken. Am besten erinnern sie sich an die Szene, wie Ronnie sich am Morgen der Urteilsverkündung am Schwurgericht Winchester rasierte. Er hatte sich am Vortag selbst verteidigt und war sicher, am Abend als freier Mann nach Hause zu kommen. Das war das erste Mal gewesen, dass meine Tanten ihm beim Rasieren zuschauen durften. Die einzige Antwort, die ich aus ihnen herausbekomme, vermitteln mir ihre Blicke und der knappe Kommentar: »Es war furchtbar. Einfach furchtbar.« Sie reden von der Schande, so als sei es gestern gewesen, nicht vor siebzig Jahren.
Vor über sechzig Jahren hatte ich meiner Mutter Olive dieselben Fragen gestellt. Anders als meine Tanten, die es vorzogen, ihre Erinnerungen für sich zu behalten, sprudelte Olive nur so über. Von dem Moment an, als wir uns am Bahnhof in Ipswich gegenüberstanden, sprach sie von nichts anderem als Ronnie. Sie sprach über seine Sexualität, lange bevor ich mit meiner eigenen im Reinen war, und um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern, gab sie mir ein zerfleddertes Exemplar von Krafft-Ebings Psychopathia Sexualis, das mir als Überblick über die Vorlieben ihres Mannes vor und nach dem Gefängnis dienen sollte.
»Verändert, mein Lieber? Im Gefängnis? Nicht im Mindesten. Du warst völlig unverändert. Du hattest natürlich an Gewicht verloren – wie auch nicht. Das Essen im Gefängnis soll ja nicht gerade lecker sein.« Und dann folgte das Bild, das ich nie wieder vergessen werde, vor allem, weil sie nicht zu bemerken schien, was sie da sagte: »Und dann hattest du diese alberne Angewohnheit, vor den Türen stehen zu bleiben und mit gesenktem Kopf strammzustehen, bis ich sie für dich aufmachte. Das waren ganz normale Türen, nicht verschlossen und gar nichts, aber du hast offenbar nicht daran geglaubt, sie allein öffnen zu können.«
Warum sprach Olive zu mir, als sei ich Ronnie gewesen? Du meinte natürlich ihn, doch im Unterbewusstsein hatte sie mich zu seinem Stellvertreter gemacht, und bis zu ihrem Tod war ich zu ihm geworden. Es gibt eine Tonbandaufnahme, die Olive für meinen Bruder Tony gemacht hat und auf der sie von ihrem Leben mit Ronnie berichtet. Noch immer kann ich mir die Aufnahme nicht anhören, ich kenne bisher nur Ausschnitte. Auf dem Band beschreibt sie, wie Ronnie sie geschlagen hat, und deshalb, so Olive, sei sie weggelaufen. Dass Ronnie gewalttätig war, war nichts Neues für mich, denn er schlug auch seine zweite Frau. Das tat er so häufig, vorsätzlich und zu den unmöglichsten Nachtstunden, dass ich es mir aus einem ritterlichen Impuls heraus zur Aufgabe machte, ihren lachhaften Beschützer zu geben. Ich schlief mit einem Golfschläger in der Hand auf einer Matratze vor ihrer Schlafzimmertür, damit Ronnie sich erst mit mir befassen musste, bevor er sich auf sie stürzte.
Hätte ich ihm den Golfschläger wohl wirklich über den beliehenen Schädel gezogen? Hätte ich ihn tatsächlich umbringen können und wäre damit in seine Fußstapfen getreten und im Gefängnis gelandet? Oder hätte ich ihn einfach nur umarmt und ihm eine gute Nacht gewünscht? Das werde ich nie erfahren, aber ich bin diese Möglichkeiten so oft in meinem Kopf durchgegangen, dass sie wohl alle irgendwie wahr sind.
Natürlich hat mich Ronnie ebenfalls geschlagen, aber nur ein paarmal und ohne rechte Überzeugung. Das Erschreckende daran war der Augenblick davor: das Senken und Anspannen der Schultern, wie sich das Kinn verhärtete. Und als ich bereits erwachsen war, versuchte Ronnie mich zu verklagen, was ja wohl auch eine Form von verdeckter Gewalt ist. Er hatte eine Fernsehdokumentation über mein Leben gesehen und verstand den Beitrag wohl als indirekte üble Nachrede von mir, weil ich darin kein Wort darüber verlor, dass ich alles ihm zu verdanken hatte.
Wie hatten sich Olive und Ronnie überhaupt kennengelernt? Das fragte ich meine Mutter während meiner Krafft-Ebing-Phase, nicht lange nach der ersten Umarmung am Bahnhof in Ipswich. »Über deinen Onkel Alec, Liebling«, antwortete sie. Damit meinte sie ihren Bruder, der ihr fremd geworden war, fünfundzwanzig Jahre älter als sie. Die Eltern der beiden waren schon lange tot, Onkel Alec, einer der Granden von Poole, Parlamentsabgeordneter und legendärer örtlicher Prediger, fungierte als Olives eigentlicher Vater. Alec war, wie sie, dürr und knochig und sehr groß, dazu aber noch eitel, er kleidete sich schick und war sich seiner gesellschaftlichen Bedeutung nur allzu bewusst. Als Onkel Alec den Auftrag hatte, einem örtlichen Fußballteam einen Pokal zu überreichen, nahm er Olive zu diesem Ereignis mit, so als wolle er sie auf die Rolle der zukünftigen Prinzessin vorbereiten und sie in Sachen öffentlichen Pflichtbewusstseins schulen.
Ronnie war der Mittelstürmer der Mannschaft. Was denn sonst? Und während Onkel Alec die Reihe der Spieler abschritt und allen die Hand reichte, folgte Olive ihm und steckte jedem ein Abzeichen an die stolze Brust. Doch als sie Ronnie das Abzeichen ansteckte, ließ er sich dramatisch auf die Knie fallen, jammerte, sie habe ihm ins Herz gestochen, und drückte sich beide Hände gegen die Brust. Onkel Alec, der allen überlieferten Hinweisen zufolge ein aufgeblasener Wichtigtuer war, sah stillschweigend über den Unfug hinweg, und Ronnie fragte mit beeindruckender Ehrfurcht, ob er sonntags nachmittags wohl dem großen Haus einen Besuch abstatten und seine Aufwartung machen dürfe – es ginge nicht um Olive, natürlich nicht, die ihm gesellschaftlich weit überlegen sei –, sondern um ein irisches Hausmädchen, das er kennengelernt habe. Onkel Alec gab seine Einwilligung, und Ronnie, unter dem Deckmantel, um ein Hausmädchen zu werben, verführte Olive.
»Ich war so einsam. Liebling. Und du warst Feuer und Flamme.« Das Feuer war natürlich Ronnie, nicht ich.
Onkel Alec war mein erster geheimer Informant, und ich ließ umgehend seine Tarnung auffliegen. An meinem einundzwanzigsten Geburtstag hatte ich Alec heimlich geschrieben – Alec Glassey, MP, c/o House of Commons, Privat –, um herauszufinden, ob seine Schwester, also meine Mutter, noch lebte, und wenn ja, wo man sie finden konnte. Glassey war schon länger kein Abgeordneter mehr, doch wundersamerweise leitete die Poststelle meinen Brief weiter. Als ich jünger war, hatte ich Ronnie dieselben Fragen gestellt, doch er hatte nur die Stirn gerunzelt und den Kopf geschüttelt; nach ein paar weiteren Versuchen hatte ich es aufgegeben. Onkel Alec hatte zwei Zeilen hingekritzelt mit dem Hinweis, ich würde ihre Adresse auf beiliegendem Blatt finden. Bedingung war, dass ich ›der betreffenden Person‹ niemals verraten dürfe, von wem ich die Adresse hätte. Durch diese Anordnung aufgestachelt, platzte ich Olive gegenüber mit der Wahrheit heraus, kaum dass wir uns gegenüberstanden.
»Dafür sollten wir ihm dankbar sein, mein Lieber«, meinte sie nur, und damit war das Thema erledigt.
Zumindest hätte es das sein können, nur dass ich vierzig Jahre später in New Mexico, mehrere Jahre nach dem Tod meiner Mutter, von meinem Bruder Tony erfuhr, dass er ebenfalls an seinem einundzwanzigsten Geburtstag an Alec geschrieben hatte, zwei Jahre vor mir, dass er mit dem Zug zu Olive gefahren war, sie auf Gleis 1 umarmt hatte und sie wahrscheinlich wegen seiner Körpergröße wohl besser zu fassen kriegte. Auch er hatte ihr alles erzählt.
Und warum hatte er mir nichts davon erzählt? Warum hatte ich ihm nichts erzählt? Warum hatte Olive keinem von uns etwas vom jeweils anderen gesagt? Warum hatte Alec versucht, uns alle voneinander fernzuhalten? Die Antwort darauf: aus Angst vor Ronnie, für uns gleichbedeutend mit der Angst vor dem Leben selbst. Seinem Einflussbereich, psychisch und physisch, und seinem entsetzlichen Charme konnte man sich schlecht entziehen. Er war eine wandelnde Rollkartei an Kontakten. Kam heraus, dass eine seiner Frauen sich mit einem Liebhaber tröstete, dann machte sich Ronnie wie eine Einmann-Einsatzzentrale ans Werk. Binnen einer Stunde hatte er den Arbeitgeber des armen Kerls an der Strippe, dessen Bankdirektor, Hausvermieter und Schwiegervater. Und jeder von ihnen fungierte als Agent eines Vernichtungsfeldzugs.
Und was Ronnie einem hilflosen betrügerischen Ehemann antun konnte, das konnte er uns zehnfach antun. Ronnie schuf und zerstörte zugleich. Jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, ihn zu bewundern, fallen mir seine Opfer ein. Seine eigene Mutter, frisch verwitwet, schluchzende Rechtsvertreterin des Erbes seines Vaters; die Mutter seiner zweiten Frau, ebenfalls verwitwet, noch ganz benommen von dem Verlust, ebenfalls im Besitz des Vermögens ihres verstorbenen Gatten. Ronnie betrog sie beide, brachte sie um die Ersparnisse ihrer Männer und die rechtmäßigen Erben um ihre Anteile. Dutzende, zig weitere, alle vertrauten ihm, alle hatten nach Ronnies hohen Ansprüchen seinen Schutz verdient: betrogen, ausgeraubt, abgezockt von ihrem fahrenden Ritter. Wie erklärte er sich das selbst, wenn er das überhaupt tat? Die Rennpferde, die Partys, Frauen und Bentleys, die sein anderes Leben ausstaffierten, während er Menschen um ihr Geld brachte, die aus Zuneigung ihm gegenüber so überfordert waren, dass sie nicht nein sagen konnten? Hat Ronnie jemals die Kosten dafür aufgelistet, von den Göttern begünstigt zu sein?
Ich hebe nur wenige Briefe auf; die meisten, die ich von Ronnie erhalten habe, waren so furchtbar, dass ich sie vernichten musste, noch bevor ich sie überhaupt richtig gelesen hatte: Bettelbriefe aus Amerika, Indien, Singapur und Indonesien; Mahnschreiben, in denen er mir meine Verfehlungen verzieh und mich anflehte, ihn zu lieben, für ihn zu beten, die Vorteile, mit denen er mich überschüttet hatte, zum Besten zu nutzen und ihm Geld zu schicken; Drohbriefe, in denen er forderte, ich solle ihm die Kosten meiner Erziehung zurückerstatten; verhängnisvolle Prophezeiungen seines nahenden Todes. Ich bedaure es nicht, die Briefe weggeworfen zu haben; manchmal wünschte ich mir nur, ich könnte auch die Erinnerung an sie beseitigen. Trotz all meiner Bemühungen taucht doch immer mal wieder ein Fetzen seiner unauslöschlichen Vergangenheit auf und quält mich: eine Seite aus einem seiner auf Luftpostpapier getippten Briefe, zum Beispiel solche, in denen er mir zu irgendeinem verrückten Plan rät, den »Du Deinen Beratern vorlegen solltest im Hinblick auf möglichst baldige Investitionen«. Oder einer seiner alten Geschäftsgegner schreibt mir, stets wohlwollend, stets dankbar dafür, ihn gekannt zu haben, auch wenn diese Erfahrung sich als kostspielig herausgestellt hat.
Als ich vor ein paar Jahren mit dem Gedanken spielte, eine Autobiographie zu schreiben, und mich der Frust packte, weil ich nur so wenige weiterführende Informationen hatte, heuerte ich zwei Detektive an, einen dürren, einen dicken, die mir beide von einem gestandenen Londoner Anwalt empfohlen worden waren; beide waren sie ordentliche Esser. Gehen Sie hinaus in die Welt, forderte ich sie leichthin auf. Reisen Sie auf meine Kosten. Finden Sie lebende Zeugen und die Akten, liefern Sie mir Fakten aus meinem Leben, von meiner Familie, von meinem Vater, und ich werde Sie entsprechend entlohnen. Ich bin ein Lügner, erklärte ich. Ich bin zum Lügen geboren, dazu erzogen worden, von einer Branche darin ausgebildet worden, die das Lügen als Lebensunterhalt betreibt, habe das Lügen als Schriftsteller praktiziert. Als Schöpfer von Fiktionen erfinde ich Versionen meiner selbst, aber niemals die Wahrheit, wenn es denn überhaupt eine gibt.
Ich werde Folgendes tun, sagte ich. Ich werde meinem Gedächtnis auf der linken Buchseite freien Lauf lassen und Ihren Tatsachenbericht auf der rechten Seite entgegensetzen, unverändert, ohne weitere Ausschmückungen. Auf diese Weise kann der Leser selbst erkennen, in welchem Umfang die Erinnerung eines alten Schriftstellers nur die Hure seiner Vorstellungskraft ist. Wir alle erfinden unsere Vergangenheit neu, sagte ich, aber Schriftsteller spielen da in einer ganz eigenen Liga. Selbst wenn sie die Wahrheit kennen, reicht sie ihnen nie. Ich lenkte ihr Augenmerk auf Ronnies persönliche Daten, Namen und Orte und schlug ihnen vor, die Gerichtsakten auszubuddeln. Ich malte mir aus, wie sie wichtige Quellen aufspürten, solange es sie noch gab, frühere Sekretärinnen, Gefängnisbeamte, Polizisten. Ich sagte ihnen, sie sollten dasselbe auch mit meinen Schulunterlagen machen, meinen Dienstakten bei der Armee, und da ich ja mehrere Male Gegenstand offizieller Sicherheitsüberprüfungen gewesen war, mit den Einschätzungen der Einrichtungen, die wir früher mal Geheimdienste genannt hatten. Ich drängte sie, nichts unversucht zu lassen. Ich erzählte ihnen von den Schwindeleien meines Vaters, hier und dort, alles, woran ich mich erinnerte: wie er versuchte, die Premierminister von Singapur und Malaysia in ein zweifelhaftes Fußballwettgeschäft zu verwickeln, und es um ein Haar auch geschafft hätte, zum Abschluss zu kommen. Es handelte sich stets um dasselbe Haar, das ihn auch scheitern ließ.
Ich berichtete ihnen von seinen kleinen ›Nebenfamilien‹, Geliebten (und Müttern seiner Kinder), die die Flamme hochhielten und die, so seine Worte, stets bereit waren, ihm eine Wurst zu braten, wenn er hereinschneite. Ich gab ihnen die Namen von ein paar Frauen, von denen ich wusste, ein oder zwei Anschriften, und die Namen der Kinder – wessen Kinder nun wirklich, lässt sich nur vermuten. Ich erzählte ihnen von Ronnies Kriegsdienst, der darin bestand, jeden nur erdenklichen Trick anzuwenden, um eben nicht eingezogen zu werden, unter anderem auch den, sich zu den parlamentarischen Nachwahlen unter solch mitreißendem Slogan aufstellen zu lassen wie ›Unabhängig Progressiver‹, wodurch die Armee gezwungen war, ihn freizustellen, damit er seine demokratischen Rechte ausüben konnte. Und dass er sogar während der Wehrausbildung ein paar Höflinge und ein, zwei Sekretärinnen auf Abruf bereithielt, die in den Hotels vor Ort untergebracht waren, damit er seine seriösen Geschäfte als Kriegsgewinnler und Händler von Mangelware fortsetzen konnte. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren polierte Ronnie seine vermeintliche Militärzeit dadurch auf, dass er sich das Alias eines Colonel Cornhill verlieh, denn unter diesem Namen war er in den dunkleren Ecken des West End wohlbekannt. Als meine Halbschwester Charlotte in einem Film mit dem Titel The Krays über die gleichnamige berüchtigte Gangsterfamilie aus dem Osten Londons mitspielte, befragte sie den ältesten Bruder Charlie Kray, um Inspiration für die Rolle zu sammeln. Bei einer netten Tasse Tee kramte Charlie Kray das Fotoalbum der Familie hervor, und da war Ronnie, die Arme um die Schultern der beiden jüngeren Brüder Kray.
Ich berichtete ihnen von der Nacht, als ich in Kopenhagen im Royal Hotel eincheckte und umgehend gebeten wurde, zum Direktor zu kommen. Da war mir wohl mein Ruhm vorausgeeilt, nahm ich an. Das nun nicht, aber Ronnies Ruhm durchaus. Er wurde von der dänischen Polizei gesucht. Und da stand sie auch schon in Gestalt von zwei Männern, aufrecht wie Schuljungen, die zur Strafe in die Ecke müssen. Ronnie, so erklärten sie, war aus den Vereinigten Staaten illegal in Kopenhagen eingereist, und zwar mit Hilfe von zwei skandinavischen Piloten, die er in einer Spelunke in New York beim Poker ausgenommen hatte. Statt Bargeld zu verlangen, hatte er vorgeschlagen, sie sollten ihm einen Freiflug nach Dänemark spendieren, was sie auch taten und ihn nach der Landung durch Zoll und Passkontrolle lotsten. Ob ich wohl zufällig wüsste, so die dänischen Beamten, wo sie meinen Vater finden könnten? Gott sei Dank wusste ich es tatsächlich nicht. Das letzte Mal hatte ich ein Jahr zuvor von Ronnie gehört, als er sich aus Großbritannien davongestohlen hatte, um einem Gläubiger oder der Verhaftung oder dem Mob zu entgehen, oder auch all dem auf einmal.
Da gab es noch eine mögliche Spur für die Detektive, verriet ich ihnen: Finden Sie heraus, warum Ronnie Großbritannien verlassen musste und warum er die Staaten ebenfalls auf die harte Tour hinter sich lassen musste. Ich erzählte ihnen von Ronnies Rennpferden, die er immer noch besaß, obwohl er einen nicht entlasteten Konkurs hingelegt hatte: Pferde in Newmarket, in Irland und bei Maisons-Laffitte außerhalb von Paris. Ich nannte ihnen die Namen der Trainer und Jockeys und verriet ihnen, dass Lester Piggott für meinen Vater geritten war, als Lester noch in der Lehre gewesen war, und dass Gordon Richards Ronnie bei den Einkäufen beraten hatte. Einmal war ich auf den jungen Lester Piggott gestoßen, als der hinten in einem Pferdeanhänger saß, in Ronnies Farben gekleidet, und vor dem Rennen einen Jungs-Comic las. Ronnies Pferde waren unter anderem nach seinen geliebten Kindern benannt worden: Dato hieß, Gott helfe mir, nach David und Tony; ein anderes hieß Tummy Tunmers, eine Kombination aus dem Namen seines Hauses und Ausdruck seiner Zuneigung zu seinem eigenen Magen; ein anderes, Prince Rupert – das einzige Pferd das es wirklich zu etwas brachte – war nach meinem Halbbruder Rupert benannt; eines hieß Rose Sang, eine augenzwinkernde Anspielung auf die roten Haare meiner Halbschwester Charlotte. Ich verriet ihnen auch, dass ich mit knapp zwanzig Jahren an Ronnies Stelle zu den Pferderennen gegangen war, nachdem man ihn gewarnt hatte, wegen seiner Spielschulden dort besser nicht aufzutauchen. Und wie ich, nachdem Prince Rupert zur Überraschung aller in – war es das Cesarewitch? – auf Platz eingelaufen war, zusammen mit den Buchmachern, die Ronnie nicht bezahlt hatte, den Zug zurück nach London nahm, mit einem Aktenkoffer voller Geld im Schlepptau, das ich bei den Wetten auf der Rennbahn gewonnen hatte.
Ich erzählte meinen Privatdetektiven von Ronnies Hofstaat, wie ich ihn immer heimlich genannt hatte: ein bunt zusammengewürfelter Haufen vornehmer Exknackis, der den Kern seiner Unternehmensfamilie bildete – ehemalige Lehrer, ehemalige Anwälte, ehemalige alles Mögliche. Und wie einer von ihnen namens Reg mich nach Ronnies Tod beiseitenahm und mir unter Tränen verriet, was unterm Strich dabei herausgekommen war, wie er das nannte. Reg hatte für Ronnie eingesessen. Und da war er nicht der Einzige. Auch George-Percival hatte gesessen, noch so ein Höfling. Und Eric und Arthur. Alle vier hatten für Ronnie den Kopf hingehalten, damit der Hof seinen König nicht verlor. Aber das meinte Reg gar nicht. Er meinte, David – durch einen Tränenschleier –, dass sie ein Haufen verfluchter Dummköpfe gewesen waren, die sich immer wieder von Ronnie hatten reinlegen lassen. Und Dummköpfe waren sie immer noch. Und wenn Ronnie heute von den Toten auferstehen und Reg fragen würde, ob er wieder für ihn in die Bresche springen würde, dann würde Reg das tun, genau wie George-Percival und Eric und Arthur. Denn was Ronnie anging – und das gab Reg ganz offen zu –, also, da hatten sie alle eine Schwäche.
»Wir hatten alle einen Hau«, fügte Reg in einem letzten respektvollen Satz der Trauer über einen Freund an. »Aber dein Dad, also, der hatte einen ganz speziellen Hau.«
Ich erzählte den Detektiven, wie Ronnie sich bei den Parlamentswahlen von 1950 als liberaler Kandidat für Yarmouth hatte aufstellen lassen, mit dem ganzen Hofstaat an seiner Seite, alles Liberale, bis auf den letzten Mann. Und wie ein Vertreter des Kandidaten der Konservativen sich mit Ronnie an einem geheimen Ort verabredete und aus Angst, Ronnies Kandidatur könne eine Stimmenteilung zugunsten des Kandidaten der Labour Party bewirken, ihn warnte, dass die Tories seine Vorstrafen und noch ein oder zwei andere pikante Einzelheiten öffentlich machen würden, falls er nicht zurücktrat. Ronnie berief daraufhin eine Sitzung seines Hofstaats ein, dem ich von Amts wegen angehörte, um sich zu beraten, und trat nicht zurück. War Onkel Alec der verdeckte Informant der Tories? Hatte er ihnen eine seiner Geheimdepeschen geschickt und sie davor gewarnt, die Quelle preiszugeben? Ich habe so etwas immer vermutet. Jedenfalls machten die Tories ihre Drohung wahr. Sie veröffentlichten Ronnies Vorstrafenregister, Ronnies Kandidatur führte zu einer Stimmenteilung, und Labour gewann die Wahlen.
Vielleicht als freundliche Warnung, vielleicht auch um ein wenig damit zu prahlen, machte ich meine Detektive außerdem noch mit dem Ausmaß von Ronnies Verbindungen vertraut, Kontakte, die er zu Personen unterhielt, von denen man das nun wirklich nicht vermutet hätte. In den späten 40ern und frühen 50ern, zu seiner besten Zeit, konnte Ronnie in seinem Haus in Chalfont St. Peter Partys schmeißen, zu denen Präsidenten von Arsenal London erschienen, Staatssekretäre, erfolgreiche Jockeys, Filmstars, Radiosternchen, Snooker-Könige, ehemalige Bürgermeister von London, das gesamte Ensemble der Crazy Gang, die damals im Victoria Palace auftrat, ganz zu schweigen von der handverlesenen Auswahl an Schätzchen, sonst wo aufgegabelt, und die Cricketteams von Australien oder Westindien, wenn sie im Land waren. Don Bradman besuchte die Partys ebenso wie die meisten großen und guten Cricketspieler der Nachkriegsjahre. Dazu tauchte noch eine ganze Schar an führenden Richtern und Anwälten jener Tage auf und ein Trupp an höheren Beamten des Scotland Yard in Freizeitjacketts mit Wappen auf der Brusttasche.
Ronnie, der schon früh Erfahrungen mit den Polizeimethoden gemacht hatte, konnte einen beeinflussbaren Polizisten schon aus einer Meile Entfernung erkennen. Er wusste auf den ersten Blick, was sie aßen und tranken und was sie glücklich machte, wie weit sie nachgaben und wann sie zerbrachen. Eines seiner größten Vergnügen war es, den Schutz der Polizei auch für seine Freunde in Anspruch zu nehmen, und wenn der Sohn eines Freundes sturzbesoffen den Riley der Eltern in den Graben gesetzt hatte, dann war es Ronnie, der als Erster einen aufgeregten Anruf der Mutter erhielt, um dann mit dem Zauberstab zu wedeln und die Blutproben im Polizeilabor durcheinanderzubringen, mit der allergrößten Entschuldigung der Staatsanwaltschaft, Euer Ehren kostbare Zeit vergeudet zu haben. Das wiederum führte dazu, dass Ronnie einen weiteren Gefallen auf seinem Konto bei der großen Bank der Versprechungen verbuchen konnte, wo er das einzige Vermögen hortete, das er hatte.
Meine Detektive derart einzuweisen war natürlich vollkommen nutzlos. Kein Detektiv auf Erden hätte finden können, wonach ich suchte, und zwei Detektive waren auch nicht besser als einer. Zehntausend Pfund und ein paar ausgezeichnete Mahlzeiten später konnten sie mir nicht mehr anbieten als einen Stapel Pressemeldungen über alte Bankrotte und die Wahlen in Yarmouth, dazu einen Haufen wertloser Firmenunterlagen. Keine Gerichtsprotokolle, keine Gefängniswärter im Ruhestand, keine wasserdichten Zeugenaussagen, keine glasklaren Beweise. Keine Spur von Ronnies Prozess vor dem Schwurgericht Winchester, wo er seiner Darstellung nach eine brillante Verteidigung hingelegt hatte gegen einen jungen Anwalt namens Norman, Norman Birkett, später Sir Norman Birkett, danach gar Lord, der als britischer Richter bei den Nürnberger Prozessen fungierte.
Im Gefängnis – so viel verriet mir Ronnie – hatte er an Birkett geschrieben und aus dem Sportsgeist heraus, der beiden so am Herzen lag, dem großen Anwalt zu seiner Leistung gratuliert. Birkett fühlte sich durch den Brief eines armen Gefangenen, der seine Schuld an der Gesellschaft absaß, derart geschmeichelt, dass er tatsächlich antwortete. Daraus entwickelte sich ein Schriftwechsel, im Zuge dessen Ronnie seine lebenslange Entschlossenheit erwähnte, Jura zu studieren. Und kaum hatte er das Gefängnis verlassen, schrieb er sich als Student in Gray’s Inn ein. Nach dieser Heldentat kaufte er sich Perücke und Robe, und noch immer sehe ich beides in den Pappkartons vor mir, und auch, wie sie ihm bei seiner Suche nach Eldorado rings um den Globus folgen.
Meine Mutter Olive schlich sich aus unserem Leben, als ich fünf war und Tony sieben; wir beide schliefen tief und fest. Im holprigen Jargon der Geheimdienste, in die ich später eintrat, war ihr Abgang eine gut geplante Ausschleusung, auf Grundlage der Sicherheitsprinzipien möglichst geringer Kenntnisverbreitung. Die Verschwörer wählten eine Nacht, in der Ronnie erst spät aus London zurückkehren sollte, möglicherweise auch gar nicht. Das war nicht schwierig. Sofort nach den Entbehrungen der Haftstrafe hatte sich Ronnie geschäftlich im West End etabliert und bemühte sich eifrig, verlorene Zeit aufzuholen. Welche Art Geschäft lässt sich nur erahnen, doch ging es dabei recht lebhaft zu.
Kaum hatte Ronnie wieder den Duft der Freiheit geschnuppert, da hatte er schon den Kern seines Hofstaats um sich versammelt. In derselben atemberaubenden Geschwindigkeit ließen wir das bescheidene Ziegelhaus in St. Albans hinter uns, zu dem mein Großvater uns nach Ronnies Freilassung unter Stirnrunzeln und Ermahnungen gefahren hatte, und richteten uns im Vorort Rickmansworth ein, Reitschulen und Limousinen, keine Stunde Fahrt von Londons teuersten Amüsierlokalen entfernt. Wir hatten mit dem Hofstaat im Kulm Hotel in St. Moritz überwintert. In Rickmansworth waren unsere Kinderzimmerschränke in geradezu orientalischem Ausmaß mit neuem Spielzeug gefüllt. Die Wochenenden erwiesen sich als nicht enden wollende, nicht ganz jugendfreie Gelage; Tony und ich überredeten ausgelassene Onkel, mit uns Fußball zu spielen, und starrten die bücherlosen Wände unseres Kinderzimmers an, während wir der Musik lauschten, die unten lief. Zu den Überraschungsgästen gehörte Learie Constantine, später Sir Learie, noch später Lord Constantine, wohl der beste Cricketspieler Westindiens aller Zeiten. Es gehört zu den vielen Widersprüchen in Ronnies Natur, dass er sich gern in Gesellschaft von Menschen mit brauner oder schwarzer Haut sehen ließ, was damals ungewöhnlich war. Learie Constantine spielte mit uns ›French Cricket‹, und wir liebten ihn heiß und innig. Ich habe eine Erinnerung an eine fröhliche Privatfeier, auf der er, ohne Beisein eines Priesters, formell zu meinem Patenonkel eingesetzt wurde, vielleicht auch zu dem von Tony, da sind wir uns beide nicht mehr sicher.
»Und woher kam das Geld?«, fragte ich meine Mutter in einem der vielen Gespräche, die wir nach unserem Wiedersehen führten. Sie hatte keine Ahnung. Geschäfte waren entweder unter ihrer Würde oder zu hoch für sie. Je ruppiger es zuging, desto weiter hielt sie sich davon fern. Ronnie war ein Betrüger, sagte sie, aber waren denn nicht alle Geschäftsleute Betrüger?
Das Haus, aus dem Olive sich so heimlich davonmachte, war ein Anwesen mit dem Namen Hazel Cottage gewesen, nachgeahmter Tudor-Stil. In der Dunkelheit verliehen der langgestreckte, abfallende Garten und die bleiverglasten Rautenfenster dem Gebäude das Aussehen eines Jagdschlösschens im Wald. Ich stelle mir eine schmale Neumondsichel vor, vielleicht auch gar keinen Mond. Den ganzen langen Tag vor ihrer Flucht ist sie mit heimlichen Vorbereitungen beschäftigt und packt das Notwendigste in ihren weißen Lederkoffer von Harrods – einen warmen Pullover, in East Anglia wird es frostig sein; wo um alles in der Welt habe ich meinen Führerschein gelassen? –, wirft nervöse Blicke auf ihre goldene St.-Moritz-Uhr, während sie den Kindern, der Köchin, der Reinemachefrau, dem Gärtner und Annaliese, dem deutschen Kindermädchen, gegenüber Haltung bewahrt.
Olive vertraut keinem mehr von uns. Ihre Söhne sind Ronnies hundertprozentige Zweitunternehmen. Annaliese, nimmt sie an, hat mit dem Feind geschlafen. Olives enge Freundin Mabel wohnt nur ein paar Meilen entfernt bei ihren Eltern, in einer Wohnung mit Blick auf den Moor Park Golf Club, doch Mabel ist so wenig in den Fluchtplan eingeweiht wie Annaliese. Mabel hatte zwei Abtreibungen in den letzten drei Jahren, nachdem sie sich von einem Mann hat schwängern lassen, dessen Namen sie partout nicht preisgeben will, und Olive hat da so langsam eine Ahnung. In dem mit Dachsparren dekorierten Salon, durch den sie auf Zehenspitzen mit ihrem weißen Koffer schleicht, steht einer der ersten Vorkriegsfernseher, ein aufrecht stehender Mahagonisarg mit einer winzigen Mattscheibe, auf der vorbeirasende Pünktchen zu sehen sind und ab und zu mal die unscharfen Umrisse eines Mannes im Smoking. Der Fernseher ist aus. Verstummt. Sie wird nie wieder hineinschauen.
»Warum hast du uns nicht mitgenommen?«, fragte ich sie bei einem unserer Gespräche.
»Weil du uns verfolgt hättest, Liebling«, antwortete sie und meinte wieder mal nicht mich, sondern Ronnie. »Du hättest nicht eher aufgegeben, bis du deine kostbaren Söhne wiederbekommen hättest.«
Außerdem, fuhr sie fort, stand da ja noch die überaus wichtige Frage unserer Ausbildung im Raum. Ronnie war so ehrgeizig, wenn es um seine Söhne ging, dass er uns unter allen Umständen in guten Schulen unterbringen wollte. Olive hätte das niemals geschafft. Oder, Liebling?
Ich kann Olive nicht so recht beschreiben. Als Kind kannte ich sie nicht, als Erwachsener verstand ich sie nicht. Von ihren Fähigkeiten weiß ich so gut wie nichts, von allem anderen ebenso wenig. Hatte sie ein gutes Herz, war aber schwach? Quälte sie die Trennung von ihren beiden heranwachsenden Erstgeborenen, oder war sie eine Frau ohne wirklich tiefgehende Gefühle, die sich ausgerichtet an den Entscheidungen anderer durchs Leben hangelte? Gab es verborgene Talente, die danach schrien, ans Licht zu kommen, es aber nie taten? In all diesen möglichen Versionen würde ich mich nur zu gern wiedererkennen, doch ich habe keine Ahnung, welche ich wählen würde, falls überhaupt eine.
Der weiße Lederkoffer, für mich ein Gegenstand wildester Spekulationen, steht heute in meinem Haus in London. Wie bei allen großen Werken der Kunst steckt seine Reglosigkeit voller Spannung. Wird er plötzlich wieder davonjagen und keine Adresse hinterlassen, wo man ihn erreichen kann? Äußerlich betrachtet, handelt es sich um den Koffer einer namhaften Firma für die Hochzeitsreise einer betuchten Frau. Die beiden Türsteher in Dienstuniform, die in meiner Erinnerung für immer und ewig vor den Glastüren zum Kulm Hotel in St. Moritz stehen und den Gästen mit überzogener Geste den Schnee von den Schuhen fegen, würden die Besitzerin dieses Koffers sofort als Angehörige der gehobenen Trinkgeldklasse erkennen. Doch wenn ich müde bin und mein Gedächtnis unkontrolliert durch die Gegend wildert, dann strahlt das Innere des Koffers etwas zutiefst Sexuelles aus.
Zum einen wäre da das zerschlissene rosa Seidenfutter: ein knapper Pettycoat, der nur darauf wartet, heruntergerissen zu werden. Zum anderen schwirrt mir im Hinterkopf ein undeutliches Bild von hastiger Fleischeslust herum – ein Schlafzimmerscharmützel, in das ich aus Versehen geplatzt bin, als ich noch ganz klein war –, und Rosa ist darin die vorherrschende Farbe. War dies der Moment, als Ronnie und Annaliese miteinander schliefen? Oder Ronnie und Olive? Oder Olive und Annaliese? Oder alle drei gemeinsam? Oder keiner, und es passierte nur in meinen Träumen? Und stellt diese Pseudoerinnerung eine Art kindliches erotisches Paradies dar, aus dem ich vertrieben wurde, als Olive ihre Sachen packte und verschwand?
Als historisches Zeugnis ist er unbezahlbar. Der Koffer ist der einzige bekannte Gegenstand, der Olives Initialen aus der Zeit mit Ronnie trägt: O. M. C., Olive Moore Cornwell, in Schwarz geprägt unter dem schweißgefärbten Ledergriff. Wessen Schweiß? Olives? Oder der ihres Mitverschwörers und Retters, eines aufbrausenden Immobilienmaklers mit roten Haaren, der auch das Fluchtauto fuhr? Ich stelle mir vor, dass auch ihr Retter verheiratet war, genau wie sie, und dass er ebenfalls Kinder hatte. Und wenn, hatten auch diese Kinder damals ganz fest geschlafen? Da ihr Retter beruflichen Umgang mit dem Landadel pflegte, hatte er Klasse, wohingegen Ronnie in Olives Augen nie darüber verfügte. Olive konnte Ronnie nie verzeihen, dass er über seinen Stand hinaus geheiratet hatte.
Ihr gesamtes späteres Leben über ritt sie auf diesem Punkt herum, bis ich begriff, dass Ronnies gesellschaftliche Unterlegenheit das würdevolle Feigenblatt war, an das sie sich klammerte, während sie ihm in den Jahren ihrer angeblichen Entfremdung hilflos hinterlief. Sie ließ sich von ihm im West End zum Essen ausführen, hörte sich die zusammengelogenen Berichte seines außerordentlichen Wohlstands an, auch wenn davon nur wenig, wenn überhaupt, bei ihr ankam, und nach dem Kaffee und dem Brandy – so stelle ich es mir jedenfalls vor – gab sie sich ihm in irgendeinem Unterschlupf hin, bevor er wieder davoneilte, um eine weitere Phantasiemillion zu machen. Indem sie die Wunde offen hielt, die Ronnies mindere Herkunft bei ihr gerissen hatte, indem sie sich heimlich über die Vulgarität seiner Sprache und seine sozialen Schwächen lustig machte, konnte sie ihm an allem die Schuld geben und sich selbst von aller Schuld freisprechen, abgesehen von ihrer dummen Einwilligung.
Doch Olive war alles andere als dumm. Sie hatte eine spitze Zunge und konnte sich geistreich und klar ausdrücken. Ihre langen, perfekt gebauten Sätze waren druckreif, ihre Briefe überzeugend, wohlklingend und amüsant. In meinem Beisein zeigte sie sich äußerst wortgewandt und klang wie Mrs Thatcher in der Zeit ihres Sprechtrainings. In Gegenwart anderer jedoch, wie ich neulich von jemandem erfuhr, der sie besser kannte als ich, verhielt sie sich wie ein Beo und nahm sogleich die sprachlichen Eigenheiten derjenigen an, in deren Gesellschaft sie sich befand, selbst wenn sie dafür die gesellschaftliche Leiter hinabsteigen musste. Und ja, auch ich habe ein Ohr für Stimmen. Vielleicht habe ich das von ihr, von Ronnie sicher nicht. Und ich liebe es, mich in Stimmen hineinzufühlen und sie aufs Papier zu bringen. Aber was Olive las, wenn sie denn überhaupt las, entzieht sich meiner Kenntnis ebenso wie das, was sie mir auf genetischer Ebene mitgegeben hat. Wenn ich so zurückblicke und ihren anderen Kindern zuhöre, dann merke ich, dass da eine Mutter war, von der ich einiges hätte lernen können. Doch dazu kam es nie, und vielleicht wollte ich auch nicht.
Nach Maßstäben einer Online-Partnerbörse passten Ronnie und Olive allerdings erstaunlich gut zueinander, will mir scheinen. Doch während Olive dazu neigte, sich von denen formen zu lassen, die behaupteten, sie zu lieben, war Ronnie ein erstklassiger Betrüger, mit der verhängnisvollen Gabe, bei Männern und Frauen gleichermaßen Zuneigung zu wecken. Olives Verachtung der gesellschaftlichen Wurzeln meines Vaters machte nicht beim Hauptübeltäter halt. Ronnies Vater – mein eigener hochverehrter Großvater Frank, ehemaliger Bürgermeister von Poole, Abstinenzler, Prediger, niemand Geringeres als eine Ikone der Rechtschaffenheit unserer Familie – war Olive zufolge genauso korrupt wie Ronnie. Frank sei es gewesen, der ihn zu seinem ersten Betrug anstiftete, diesen finanzierte, aus der Distanz kontrollierte, den Mund hielt, als Ronnie darüber stürzte. Olive hatte sogar schlechte Worte über Ronnies Großvater übrig, an den ich mich noch als weißbärtigen Doppelgänger von D. H. Lawrence erinnere, der mit neunzig noch Dreirad fuhr. Wo um alles in der Welt ich in dieser allumfassenden Verdammung unserer männlichen Linie stehe, blieb ungesagt. Aber schließlich hatte ich ja meine Ausbildung, nicht wahr, Lieber? Sprache und Benehmen der anständigen Bürger waren mir eingebläut worden.
Es gibt eine Familienanekdote zu Ronnie, die ich nicht verifizieren kann, doch möchte ich sie gern glauben, weil sie von Ronnies gutem Herz kündet, das seinen Kritikern so oft und ausgiebig trotzte.
Ronnie ist wieder mal auf der Flucht, aber noch nicht außer Landes. Die Anklage wegen Betrugs ist so dringend, dass die britische Polizei ihn zur Fahndung ausgeschrieben hat. Inmitten dieses Trubels verstirbt plötzlich ein alter Geschäftspartner von Ronnie. In der Hoffnung, dass Ronnie am Begräbnis teilnimmt, observiert die Polizei die Zeremonie. Beamte in Zivil mischen sich unter die Trauergäste. Doch Ronnie ist nirgends zu sehen. Am folgenden Tag geht ein Mitglied der trauernden Familie auf den Friedhof. Ronnie steht allein am Grab.
Kommen wir zu den 80ern; was jetzt folgt, ist keine Familienanekdote, sondern hat sich in Anwesenheit meines britischen Verlegers, meines Agenten und meiner Frau abgespielt.
Ich bin auf Lesereise in Südaustralien. Mittagessen im großen Zelt. Ich sitze an einem Bocktisch, meine Frau und mein Verleger neben mir, mein Agent hinter mir. Ich signiere mein neuestes Buch, Ein blendender Spion, in dem sich ein nicht allzu verschleiertes Porträt von Ronnie findet; in der Rede nach dem Essen bin ich kurz auf sein Leben zu sprechen gekommen. Eine betagte Dame im Rollstuhl schiebt sich energisch an der Schlange der Wartenden vorbei und teilt mir recht erhitzt mit, ich läge völlig falsch damit, dass Ronnie jemals in Hongkong im Gefängnis gewesen sei. Sie habe die ganze Zeit mit ihm zusammengelebt, als er in der Kolonie war, er kann also gar nicht im Gefängnis gesessen haben, denn das hätte sie ja wohl gemerkt.
Und während ich noch über meine Antwort nachdenke – wie zum Beispiel den Hinweis darauf, dass ich erst kürzlich eine freundliche Unterhaltung mit Ronnies Gefängniswärter in Hongkong geführt hätte –, kommt eine zweite Dame ähnlichen Alters angerauscht.
»Vollkommener Unfug!«, wettert sie. »Er hat mit mir in Bangkok gelebt und ist nur ab und zu nach Hongkong gependelt!«
Ich versichere den Damen, dass sie womöglich beide recht haben.
Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen verrate, dass ich mich, wie viele Söhne vieler Väter, in schwachen Augenblicken frage, welcher Teil von mir noch immer Ronnie gehört und wie viel von mir mein Eigen ist. Liegt da wirklich ein so großer Unterschied zwischen dem Mann, der an seinem Schreibtisch sitzt und sich auf dem leeren Blatt Papier alle möglichen Schwindeleien ausdenkt (ich), und dem Mann, der sich jeden Morgen ein frisches Hemd anzieht und mit nichts in der Tasche als seiner Vorstellungskraft loszieht, um sein Opfer reinzulegen (Ronnie)?
Ronnie, der Schwindler, konnte aus dem Stegreif eine Geschichte zusammenspinnen, darin eine Person auftreten lassen, die nicht existierte, und eine einmalige Gelegenheit in strahlenden Farben ausmalen, wo es gar keine gab. Er konnte einen mit erfundenen Details blenden oder den nicht vorhandenen schwierigen Punkt aufklären, falls man nicht hell genug war, die Feinheiten seiner Schwindelei schon beim ersten Mal zu durchschauen. Er konnte ein Geheimnis unter dem Mantel größter Verschwiegenheit für sich behalten, so lange, bis er es dann nur dir allein ins Ohr flüsterte, weil er beschlossen hatte, dir zu vertrauen.
Und wenn das nicht alles Kernbestandteile der Kunst des Schriftstellers sind, dann weiß ich nicht.
Ronnies Unglück war es, schon zu Lebzeiten ein Anachronismus zu sein. Als er in den 20ern in die Geschäfte einstieg, konnte ein skrupelloser Handelstreibender in der einen Stadt bankrottgehen und am folgenden Tag in einer anderen einen Kredit aufnehmen. Doch im Laufe der Zeit holten die modernen Kommunikationstechniken Ronnie ein, wie das schon bei Butch Cassidy und Sundance Kid der Fall gewesen war. Ich bin mir sicher, dass er ziemlich schockiert gewesen sein muss, als die Staatspolizei in Singapur ihm seine britische Polizeiakte vorlegte. Genauso wie damals, als er nach seiner Ausweisung nach Indonesien wegen Devisenvergehen und Waffenschmuggels eingesperrt wurde. Noch schockierter dürfte er wohl gewesen sein, als ihn ein paar Jahre später die Schweizer Polizei aus seinem Zimmer im Hotel Dolder Grand in Zürich zerrte und ihn einbuchtete. Als ich kürzlich las, wie die Herren der FIFA aus ihren Betten im Baur au Lac in Zürich geholt und auf verschiedene Gefängniszellen in der Stadt verteilt worden waren, da sah ich Ronnie vor mir, wie er vierzig Jahre zuvor dieselbe Demütigung zur selben Uhrzeit erfahren musste, ausgeführt von derselben Schweizer Polizei.
Grandhotels sind Lockmittel für Schwindler. Bis zu jenem Morgen in Zürich hatte Ronnie schon in einer ganzen Reihe von Nobelherbergen übernachtet, und sein System war stets aufgegangen: Du nimmst dir die beste Suite, die das Hotel zu bieten hat, lebst dort in Saus und Braus, machst dich bei Türstehern, Oberkellnern und vor allem den Portiers beliebt, soll heißen, du gibst reichlich und oft Trinkgeld. Telefonierst in der ganzen Welt herum, und wenn das Hotel dir die erste Rechnung präsentiert, sagst du, du hättest sie zur Begleichung an deine Firma weitergeleitet. Und wenn du das lange Spiel spielen willst, dann zögerst du die erste Rechnung hinaus, begleichst sie, dann aber keine weitere mehr.
Und wenn du dann den Eindruck hast, nicht länger willkommen zu sein, dann packst du einen kleinen Koffer, schiebst dem Portier zwanzig oder fünfzig Piepen zu und sagst ihm, du hättest dringende Geschäfte außerhalb und bist womöglich über Nacht fort. Gehört er zu jener Sorte Portier, dann zwinkerst du ihm zu und sagst, du hättest eine Verpflichtung einer Dame gegenüber – ach, und ob er bitte darauf achten könne, dass deine Suite ordentlich verschlossen ist, weil du alle Wertsachen dort gelassen hättest? –, aber erst nachdem du dich vergewissert hast, dass alles Wertvolle, was du hast, wenn du überhaupt etwas hast, sich in dem kleinen Koffer befindet. Und als weitere Tarnung lässt du deine Golfschäger beim Portier, nur zur Sicherheit, aber nur im äußersten Notfall, denn du liebst Golf.
Doch die Razzia im Dolder zu nachtschlafender Stunde verriet Ronnie, dass das Spiel aus war. Und heutzutage? Vergiss es. Sie kennen die Nummer deiner Kreditkarte, und sie wissen, auf welche Schule deine Kinder gehen.
Hätte Ronnie mit seinen ausgewiesenen Täuschungskünsten einen guten Spion abgegeben? Nun, wenn er andere täuschte, dann täuschte er auch sich selbst, doch das disqualifiziert ihn noch nicht für den Job. Doch wenn er ein Geheimnis hütete – ein eigenes oder das eines anderen –, dann war er damit zutiefst unglücklich, bis er es mit jemandem teilen konnte, und das hätte ein gewisses Problem dargestellt.
Showbusiness? Schließlich hatte er es gut hingekriegt, so zu tun, als würde er mich und die Paramount Studios vertreten, und sich in dieser Funktion ein großes Berliner Studio angeschaut. Warum sich damit begnügen? Schließlich neigt Hollywood aus altbekannter Gewohnheit dazu, Betrüger an die Brust zu drücken, wie wir alle wissen.
Schauspieler? Stand er nicht gern vor dem großen Spiegel? Hatte er nicht sein Leben lang vorgegeben, jemand zu sein, der er nicht war?
Aber Ronnie wollte nie ein Star sein. Er wollte Ronnie sein, ein Ein-Mann-Universum.
Autor seiner eigenen Fiktionen? Vergessen Sie’s. Er beneidete mich nicht um meinen literarischen Ruf. Er kontrollierte ihn.
1963. Ich bin gerade zu meinem allerersten Besuch in den Vereinigten Staaten in New York. Der Spion, der aus der Kälte kam steht ganz oben in den Kinocharts. Mein amerikanischer Verleger begleitet mich zu einem Galadiner in den 21 Club. Als der Maître uns an den Tisch führt, sehe ich Ronnie in der Ecke sitzen.
Im Laufe der Jahre sind wir uns fremd geworden. Ich hatte keine Ahnung, dass er in den Staaten ist, doch da sitzt er ein paar Meter von mir entfernt mit einem Brandy Ginger vor sich. Wie um alles in der Welt kann es sein, dass er hier ist? Ganz einfach. Er hat meinen gutherzigen amerikanischen Verleger angerufen und auf die Tränendrüse gedrückt. Dann hat er noch die irische Karte ausgespielt. Ein Blick auf den Namen meines Verlegers verrät Ronnie sofort, dass der irischer Herkunft ist.
Wir bitten Ronnie an unseren Tisch. Demütig nimmt er an und bringt seinen Brandy Ginger mit; nur auf ein Glas, versichert er, dann lässt er uns wieder in Ruhe. Er ist liebenswürdig und stolz und tätschelt meinen Arm, dann sagt er mit Tränen in den Augen, dass er doch kein schlechter Vater gewesen ist, oder, Sohn, wir sind doch immer gut miteinander ausgekommen, nein? Ja, ja, wir sind immer gut miteinander ausgekommen, Dad, einfach bestens.
Jack, mein Verleger, nicht nur Ire, sondern selbst stolzer Vater, sagt, Ronnie, warum trinken Sie das da nicht aus, und wir bestellen uns eine Flasche Champagner. Und genau so geschieht es, Ronnie erhebt sein Glas und trinkt auf unser Buch. Auf unser Buch, wohlgemerkt. Dann sagt Jack, ach was, Ronnie, bleiben Sie doch einfach sitzen und essen Sie mit uns. Ronnie lässt sich breitschlagen und bestellt sich einen ordentlichen Grillteller.
Draußen vor dem Restaurant umarmen wir uns, und ihm kommen die Tränen, wie so oft: Unter Schluchzern beben seine Schultern. Ich weine mit und frage ihn, ob er Geld braucht, doch er antwortet nein, alles gut. Und dann gibt er mir noch einen Rat mit auf den Weg, für den Fall, dass mir der Erfolg unseres Buchs zu Kopf gestiegen sein könnte:
»Du magst ja ein erfolgreicher Schriftsteller sein, Sohn«, sagt er und schluchzt noch immer, »aber du bist keine Prominenz.«
Dann lässt er mich mit dieser völlig unverständlichen Ermahnung zurück und zieht hinaus in die Nacht, ohne mir zu sagen, wohin, was wohl bedeutet, dass er irgendwo eine Geliebte hat, denn die hat er ja fast immer irgendwo.
Monate später kann ich die Einzelheiten dieser Begegnung zusammentragen. Ronnie war tatsächlich auf der Flucht, hatte kein Geld und keine Unterkunft. Allerdings boten die Immobilienmakler in New York bei Erstbezug neuer Mietshäuser einen Monat mietfrei an. Ronnie war unter verschiedenen Namen als Mietnomade unterwegs: ein freier Monat hier, ein freier Monat dort, und bislang hatte ihn noch keiner ertappt, doch gnade ihm Gott, wenn es dazu kam. Mein Geld hatte er wohl nur aus blankem Stolz ausgeschlagen, denn er war verzweifelt und hatte meinen älteren Bruder schon um einen Großteil seiner Ersparnisse gebracht.
Am Tag nach unserem Dinner im 21 Club hatte er den Vertrieb meines amerikanischen Verlags angerufen, sich als mein Vater – und natürlich als engen Freund des Verlegers – vorgestellt, ein paar Hundert Exemplare unseres Buchs bestellt, Rechnung an den Autor, und sie als Visitenkarte mit seinem eigenen Namen signiert.
Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Dutzend dieser Bücher mit der Post erhalten, mit der Bitte des Besitzers, doch neben Ronnies Namen zu signieren. Üblicherweise steht dort: »Signiert vom Vater des Autors«, mit einem besonders großen V. Meine Unterschrift lautet also: »Signiert vom Sohn des Vaters des Autors«, mit einem besonders großen S.
Stellen Sie sich für einen Augenblick vor, wie ich das schon so oft getan habe, Sie wären Ronnie. Sie stehen allein auf den Straßen New Yorks und sind völlig abgebrannt. Sie haben alle angehauen, die Sie anhauen können, haben alle gemolken, die sich noch melken ließen. In England sind Sie zur Fahndung ausgeschrieben, und in New York ebenfalls. Sie trauen sich nicht, Ihren Pass vorzuzeigen, Sie benutzen falsche Namen, um von einer Wohnung zur anderen zu ziehen, die Sie nicht bezahlen können, und alles, was noch zwischen Ihnen und dem Verderben steht, ist Ihr Instinkt und ein Doppelreiher von Berman of Savile Row, den Sie jeden Abend überbügeln. Das ist genau die Art von Zwickmühle, die man in der Spionageschule ausheckt: »Und jetzt wollen wir mal sehen, wie Sie sich herauswinden.«
Bis auf ein, zwei Verfehlungen vielleicht hätte Ronnie diesen Test mit Bravour bestanden.
Den dicken Fang, von dem Ronnie immer geträumt hatte, zog er kurz nach seinem Tod an Land, und zwar in einem dieser verschlafenen Dickens’schen Gerichtssäle, in denen komplizierte Geldgeschichten über eine ewig lange Prozessdauer hinweg verhandelt werden. Der Vorsicht halber nenne ich den betreffenden Londoner Vorort Cudlip; gut möglich, dass dieser Rechtsstreit bis zum heutigen Tag andauert, so wie er etwa zwanzig Jahre lang zu Ronnies Lebzeit und noch zwei Jahre darüber hinaus angedauert hat.
Die Fakten des Falls liegen auf der Hand. Ronnie hatte sich mit Cudlips Gemeinderat ins Benehmen gesetzt, vor allem mit dem Bauausschuss. Wie, das kann man sich bildhaft vorstellen. Sie waren Baptisten wie er, Freimaurer wie er, Cricketfreunde oder Snookerspieler wie er. Vielleicht waren sie auch Ehemänner in ihren besten Jahren, die nie in die nächtlichen Freuden des West End eingetaucht waren, bis sie Ronnie kennenlernten. Vielleicht freuten sie sich auch auf ein Stück von dem riesigen Kuchen, den Ronnie ihnen versprochen hatte.
Doch wie auch immer, es war keine Frage, dass alles mit rechten Dingen zugegangen war: Der Gemeinderat von Cudlip hatte einer von Ronnies dreiundachtzig wertlosen Firmen die Erlaubnis erteilt, mitten im Grüngürtel von Cudlip einhundert Häuser in bester Lage zu errichten. Und kaum hatte er den Vertrag in der Tasche, verkaufte Ronnie das Land, das er unter der Maßgabe, dass es niemals bebaut werden dürfe, für einen lächerlichen Betrag erworben hatte, zusammen mit dem Baurecht für eine beträchtliche Summe an ein großes Bauunternehmen. Champagner floss in Strömen, der Hofstaat feierte. Ronnie hatte das Geschäft seines Lebens gemacht. Mein Bruder Tony und ich würden niemals darben müssen.
Und wie so oft in seinem Leben lag Ronnie damit fast richtig, wenn da nicht die Bürger von Cudlip gewesen wären, die, von der lokalen Presse aufgestachelt, einhellig erklärten, dass man schon über ihre Leichen gehen müsse, wenn man gedachte, Häuser oder sonst etwas in ihren kostbaren Grüngürtel zu setzen – denn dort befanden sich das Fußballfeld, die Tennisplätze, der Spielplatz, die Picknickwiese. Und die Bevölkerung ging mit derartiger Leidenschaft zu Werk, dass sie in kürzester Zeit einen Gerichtsbeschluss herbeiführte, so dass Ronnie zwar einen unterschriebenen Vertrag mit der Baugesellschaft in den Händen hielt, aber nicht einen Penny des Kaufpreises sah.
Ronnie war so aufgebracht wie die Bewohner von Cudlip. Genau wie sie hatte er eine solche Niedertracht noch nie erlebt. Es ginge nicht ums Geld, betonte er, sondern ums Prinzip. Er trommelte ein Team aus Anwälten zusammen, die Besten ihres Fachs. Die befanden, dass die Chancen gut stünden, und übernahmen den Fall. Honorar bei Erfolg. Das Land in Cudlip wurde zum Maßstab unseres Glaubens an Ronnie. In den folgenden mehr als zwanzig Jahren war jeder zeitweilige Rückschlag nichts beim Gedanken an den Tag der Abrechnung, der gewiss kommen würde. Ronnie konnte mir aus Dublin schreiben, aus Hongkong oder Penang oder Timbuktu, doch das Mantra mit seinen seltsamen Großbuchstaben änderte sich nie: »Eines Tages, Sohn, Und Mag Es Auch nach Meinem Ableben Sein, Wird das Britische Recht Obsiegen.«
Und tatsächlich, ein paar Monate nach seinem Tod obsiegte tatsächlich das Recht. Ich war nicht dabei, als im Gerichtssaal das Urteil verlesen wurde. Mein Anwalt hatte mir geraten, nicht einen Funken Interesse an Ronnies Erbe zu signalisieren, um nicht auf einem riesigen Schuldenberg sitzenzubleiben. Der Gerichtssaal war brechend voll, so meine Quellen, besonders die Rechtsanwaltsbank. Es gab drei Richter, doch einer sprach für sie alle, und seine Sätze waren derart verschachtelt, dass die anwesenden Laien eine Weile nicht verstanden, worum es eigentlich ging.
Dann sickerten nach und nach die Neuigkeiten durch. Das Gericht hatte für den Kläger entschieden. Für Ronnie. In allen Punkten. Der Jackpot. Kein Wenn und Aber. Kein ›auf der einen Seite‹ und ›auf der anderen Seite‹. Aus dem Grab heraus hatte Ronnie den grandiosen Sieg errungen, von dem er immer vorhergesagt hatte, dass er kommen würde. Der Sieg des Volkes über Knalltüten und Oberspinner, zu lesen als Ungläubige und Eierköpfe, posthume Rechtfertigung all seines Strebens.
Dann wird es still. Mitten in all dem Jubel hat ein Gerichtsdiener erneut um Ruhe im Saal gebeten. Händeschütteln und Schulterklopfen gehen in allgemeines Unbehagen über. Ein Anwalt, der sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet hat, verlangt die Aufmerksamkeit der Lordschaften auf den Richterstühlen. Ich habe ein eigenes, willkürliches Bild von ihm. Er ist aufgedunsen und picklig und redet hochtrabend daher, und seine Perücke ist zu klein für seinen Kopf. Er repräsentiere die Krone, erklärt er den Lordschaften. Genauer gesagt repräsentiert er Ihrer Majestät Finanzamt, welches er als bevorrechtigten Gläubiger in der Angelegenheit bezeichnet, über die die Lordschaften gerade gerichtet haben. Um ganz genau zu sein und die kostbare Zeit Ihrer Lordschaften nicht überzustrapazieren, würde er gern, mit allem Respekt, die Eingabe machen, dass die gesamte Summe, die dem Erbe des Klägers zugeschrieben werde, sequestriert werden möge, um einen kleinen Teil jener erheblich größeren Summe zu tilgen, die sich im Laufe einer Vielzahl von Jahren angesammelt hätte und die der Verstorbene Ihrer Majestät Finanzamt schulde.
Ronnie ist tot, und ich bin wieder zu Besuch in Wien, um ein wenig von der Stadtluft zu tanken, während ich ihn in dem teilautobiographischen Roman unterbringe, über den ich endlich frei nachdenken kann. Ich gehe nicht wieder ins Sacher; ich befürchte, dass die Kellner sich noch daran erinnern, wie Ronnie dort zusammenbrach und auf den Tisch knallte und wie ich ihn halb hinaustragen musste. Mein Flug nach Wien-Schwechat kommt verspätet an; die Rezeption in dem kleinen Hotel, das ich aufs Geratewohl gebucht habe, ist von einem älteren Nachtportier besetzt. Er schaut schweigend zu, wie ich das Anmeldeformular ausfülle. Dann lässt er ein weiches, altehrwürdiges Wiener Deutsch hören:
»Ihr Vater war ein großer Mann«, sagt er. »Sie haben ihn schändlich behandelt.«
34
Für Reggie, mit bestem Dank
Man muss wohl schon ungefähr mein Alter haben, um sich noch an Reginald Bosanquet erinnern zu können, den ausschweifend lebenden und trinkenden Nachrichtensprecher mit dem Schalk im Nacken, der die Herzen der Nation im Sturm eroberte und lächerlich jung starb; woran, habe ich nie recht herausgefunden. Reggie war mit mir zusammen in Oxford, und er hatte all das, was ich nicht hatte: ein eigenes Einkommen, einen Sportwagen, schöne Frauen und die damit einhergehende Aura vorzeitigen Erwachsenseins.
Wir mochten einander, aber man kann ja nicht seine ganze Zeit mit einem Mann verbringen, der das Leben führt, von dem man selbst träumt, und der es sich leisten kann, man selbst aber nicht. Außerdem fristete ich in jenen Tagen ein Schattendasein, war ernst und ein wenig geplagt. Reggie war weder das eine noch das andere. Außerdem war ich nicht nur pleite, sondern – mitten in meinem zweiten Collegejahr – ernsthaft zahlungsunfähig, da mein Vater wieder mal eine seiner spektakulären Pleiten hingelegt hatte und sein Scheck für meine Studiengebühren geplatzt war. Und obwohl mein College sich musterhaft langmütig zeigte, sah ich wirklich keine Möglichkeit, wie ich den Rest des Studienjahres in Oxford bleiben könnte.
Doch da hatte ich nicht mit Reggie gerechnet, der eines Tages in mein Zimmer spaziert kam, wohl leicht verkatert, nehme ich an, mir einen Briefumschlag in die Hand drückte und wieder verschwand. Der Umschlag enthielt einen Scheck, von Reggies Treuhänder zu meinen Gunsten ausgestellt, eine Summe, die groß genug war, um meine Schulden zu tilgen und mir weitere sechs Monate an der Universität zu ermöglichen. Das Begleitschreiben stammte ebenfalls von Reggies Treuhänder. Darin stand, dass Reggie ihnen von meinem Unglück berichtet hätte, dass das Geld aus seinem eigenen Vermögen stammen würde und dass ich es nach Belieben zurückzahlen könne, wann immer es mir möglich sei. Es sei Reggies Wunsch, dass ich mich in allen Belangen hinsichtlich der Leihsumme direkt mit dem Treuhänder in Verbindung setzen solle, da seiner Meinung nach Geld und Freundschaft getrennt gehörten.
* Geschrieben 1998 für Victim Support, das britische Äquivalent zum Weißen Ring.
Es dauerte mehrere Jahre, bis ich den ausstehenden Restbetrag endgültig zurückzahlen konnte, dazu noch die Zinsen, die das Geld anderweitig eingebracht hätte. Reggies Treuhänder schickten mir einen höflichen Dankesbrief und sandten den Zinsbetrag zurück. Reggie, so erklärten sie, hielte Zinsen unter den gegebenen Umständen nicht für angebracht.*
35
Marionetten
Der geheimnisvolle Anruf erreichte mich eines frühen Morgens. Am Apparat war Karel Reisz, in der Tschechoslowakei geborener britischer Filmregisseur, der zu jener Zeit bekannt war für Samstagnacht bis Sonntagmorgen. Es ist 1967, und ich versuche gerade mein Bestes, um allein in einem hässlichen Penthouse in Maida Vale zu leben. Reisz und ich haben schon gemeinsam an einem Drehbuch zu meinem Roman Der wachsame Träumer gearbeitet, erfolglos, wie sich herausstellen sollte. Das Buch ist wohl nicht nach jedermanns Geschmack, um es milde auszudrücken. Doch Reisz ruft mich nicht wegen unseres Drehbuchs an, wie ich schon an seiner sonoren, verschwörerisch anmutenden Stimme erkenne.
»David, bist du allein?«
Ja, Karel, sehr sogar.
»Dann könntest du wohl mal so schnell wie möglich bei mir vorbeischauen, das wäre hilfreich.«
Die Familie Reisz wohnte nicht sehr weit entfernt in einem viktorianischen Haus aus roten Ziegeln in Belsize Park. Wahrscheinlich bin ich zu Fuß gegangen. Wenn eine Ehe in die Brüche geht, ist man viel zu Fuß unterwegs. Reisz verriegelte die Tür und führte mich in die große Küche, in der sich das Leben im Hause Reisz abspielte: rings um einen mächtigen runden Kieferntisch, darauf Kekse auf einem Drehteller, Tassen mit Tee und Kaffee überall, kannenweise Fruchtsaft, dazu ein ständig klingelndes Telefon an einer langen Schnur und, wie damals üblich, jede Menge Aschenbecher; all dies für solch überraschende Stammgäste wie Vanessa Redgrave, Simone Signoret und Albert Finney, die hereinschneiten, sich bedienten, ein wenig schwatzten und wieder verschwanden. Ich habe mir immer vorgestellt, dass Reisz’ Eltern wohl ebenfalls so gelebt haben mögen, bevor sie in Auschwitz umgebracht wurden.
Ich setzte mich. Fünf Gesichter starrten mich an: die Schauspielerin Betsy Blair, Reisz’ Frau, die diesmal nicht am Telefon hängt, der Regisseur Lindsay Anderson, der Lockender Lorbeer gedreht hatte, von Reisz produziert. Und zwischen diesen beiden Regisseuren ein lächelnder, nervöser, charismatischer junger Mann von klassisch slawischem Aussehen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte.
»David, das ist Vladimír«, stellte Reisz mir den jungen Mann feierlich vor, woraufhin der aufsprang und mir über den Tisch hinweg kräftig – beinah verzweifelt – die Hand schüttelte.
Hinter diesem überschwänglichen jungen Mann saß eine junge Frau, die eher wie eine Betreuerin, nicht wie eine Geliebte wirkte, wenn man nach der eifrigen Sorge urteilte, mit der sie sich um ihn kümmerte; unter den gegebenen Umständen also eher Agentin oder Casting-Direktorin, denn es war sofort zu erkennen, der junge Mann hatte Präsenz.
»Vladimír ist tschechischer Schauspieler«, erklärte Reisz.
Toll.
»Und er möchte in Großbritannien bleiben.«
Ach wirklich. Ich verstehe – oder etwas in der Art.
Anderson: »Wir dachten, dass Sie mit Ihrem Hintergrund vielleicht die Leute kennen, die sich um so etwas kümmern.«
Allgemeines Schweigen in der Runde. Alle warten, dass ich etwas sage.
»Ein Überläufer also«, sage ich lahm. »Vladimír will überlaufen.«
»Wenn Sie es so nennen wollen«, meint Anderson abschätzig, und wieder herrscht Schweigen.
Offensichtlich hatte Anderson irgendwelche Besitzansprüche an Vladimír, und Reisz, der zweisprachige Landsmann, ist eher Vermittler als treibende Kraft. Die Situation war zutiefst heikel. Ich hatte Anderson höchstens drei Mal getroffen, und wir waren nicht sonderlich gut miteinander ausgekommen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatten wir uns auf dem falschen Fuß erwischt und dann nicht weiterbewegt. Anderson, der aus einer Militärfamilie in Indien stammte, war an einer britischen Privatschule ausgebildet worden (Cheltenham, das er später in seinem Film If … abstrafte) und hatte in Oxford studiert. Während des Krieges hatte er beim militärischen Geheimdienst in Delhi gearbeitet. Das war wohl auch der Grund, nehme ich an, warum er von Anfang an gegen mich eingestellt war. Als erklärter Sozialist, der mit dem Establishment auf dem Kriegsfuß stand, hatte er mir die Rolle eines Hintertreppen-Apparatschiks im Klassenkampf zugewiesen, wogegen ich nicht viel machen konnte.
»Vladimír heißt eigentlich Vladimír Pucholt«, erklärt Reisz. Und als meine Reaktion so gar nicht dem entspricht, was sie alle von mir erwarten – soll heißen, weder japse ich vor Bewunderung, noch rufe ich: »Doch nicht etwa der Vladimír Pucholt« –, springt mir Reisz mit einer Erklärung bei, die die restlichen um den Tisch Versammelten noch ausführen. Vladimír Pucholt, so erfahre ich zu meiner Demütigung, ist ein tschechischer Stern am Bühnen- und Filmhimmel, am besten bekannt für seine Hauptrolle in Miloš Formans Die Liebe einer Blondine, der international erfolgreich war. Forman drehte auch in früheren Filmen mit Vladimír und hat ihn zu seinem Lieblingsschauspieler erkoren.
»Kurz gesagt« – geht Anderson aggressiv dazwischen, so als hätte ich Pucholts Bedeutung in Frage gestellt, weswegen er sich bemüßigt fühlt, mich zu korrigieren –, »jedes Land, das ihn aufnimmt, kann sich verdammt glücklich schätzen. Ich denke doch, dass Sie das Ihren Leuten klarmachen werden.«
Leider habe ich nur keine Leute. Die einzigen Leute von offizieller oder halboffizieller Art, die ich habe, sind meine ehemaligen Kollegen aus der Welt der Spionage. Unter gar keinen Umständen rufe ich einen von denen an, um zu verkünden, dass ich einen möglichen tschechischen Überläufer an der Hand habe. Ich kann mir schon bildhaft vorstellen, mit welchen dienstbeflissenen Fragen sie Pucholt kommen würden: Sind Sie vom tschechischen Geheimdienst beauftragt worden, und wenn ja, könnten wir Sie umdrehen? Oder: Nennen Sie uns weitere tschechische Dissidenten in Ihrem Land, die daran interessiert sein könnten, mit uns zusammenzuarbeiten. Und falls Sie Ihre Absicht nicht schon Ihren zwölf besten Freunden verraten haben, könnten Sie sich wohl überlegen, in die Tschechoslowakei zurückzugehen und für uns so dies und das zu tun?
Doch Pucholt, das spüre ich, hätte mit ihnen kurzen Prozess gemacht. Er ist kein Flüchtling, jedenfalls nicht nach seiner eigenen Auffassung. Er ist ganz legal mit Erlaubnis der tschechischen Behörden nach England gereist. Vor seiner Abreise hat er seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, alle Film- und Theaterverträge erfüllt und darauf geachtet, keine neuen anzunehmen. Er ist schon mal in Großbritannien gewesen, und die tschechischen Behörden haben keinen Grund zu der Annahme, dass er dieses Mal nicht zurückkommen wird.
Nach seiner Ankunft ist er erst mal untergetaucht. Über irgendwelche Umwege hat Lindsay Anderson von seinen Absichten Wind bekommen und Hilfe angeboten. Pucholt und Anderson kannten sich aus Prag und London. Anderson wandte sich an Reisz, und zu dritt heckten sie eine Art Plan aus. Pucholt hatte von Anfang an klargemacht, dass er nicht um politisches Asyl bitten würde. Wenn er das täte, so argumentierte er, würde er nur den Zorn der tschechischen Behörden auf jene lenken, die er zurückgelassen hatte – Freunde, Familie, Lehrer, Kollegen. Vielleicht hatte er sich an Rudolf Nurejew erinnert, den sowjetischen Balletttänzer, dessen Flucht sechs Jahre zuvor als Sieg des Westens gefeiert worden war. Nurejews Freunde und Familienangehörige in Russland waren daraufhin im Nichts verschwunden.
Unter dieser Bedingung setzten Reisz, Anderson und Pucholt ihren Plan um. Keine Fanfaren, keine Sonderbehandlung. Pucholt war einfach nur ein weiterer unzufriedener Osteuropäer von der Straße, der die britischen Behörden um Duldung bat. Anderson und Pucholt gingen zum Innenministerium und reihten sich in die Schlange derer ein, die ihre Visa verlängern lassen wollten. Am Schalter des Beamten schob Pucholt seinen tschechischen Pass durch das kleine Fenster.
»Für wie lange?«, fragte der Beamte mit gezücktem Stempel.
Worauf Anderson, der nie ein Blatt vor den Mund nahm, schon gar nicht im Umgang mit einem Lakaien des verhassten Klassensystems, antwortete: »Für immer.«
Ich sehe deutlich die langwierigen Verhandlungen vor meinem geistigen Auge, die zwischen Pucholt und dem leitenden Beamten des Innenministeriums ablaufen, dem sein Fall vorgelegt worden ist.
Auf der einen Seite haben wir die löbliche Verwirrung eines höheren Beamten, der entschlossen ist, das Richtige für den Antragsteller zu tun, aber auch regelkonform handeln will. Dazu müsste Pucholt nur klipp und klar sagen, dass er strafrechtlich verfolgt werden würde, falls er in seine Heimat zurückkehrt. Sobald er das getan hat, ist alles in Ordnung, Kästchen abgehakt, Visum für unbegrenzte Zeit verlängert, willkommen in Großbritannien, Mr Pucholt.
Auf der anderen Seite haben wir Pucholts löbliche Dickköpfigkeit, und er weigert sich strikt, diese Erklärung abzugeben, weil er dann nämlich politisches Asyl beantragt hätte, was wiederum die Personen in Gefahr bringt, die er eigentlich schützen will. Nein, Sir, ich werde nicht verfolgt, vielen Dank. Ich bin ein bekannter tschechischer Schauspieler, man würde mich mit offenen Armen empfangen. Vielleicht werde ich verwarnt, vielleicht kriege ich zum Schein eine kleine Strafe. Aber ich würde nicht verfolgt werden, und ich beantrage auch kein politisches Asyl, danke.
In dieser verfahrenen Situation steckt tatsächlich so etwas wie eine bitterböse Komödie, denn in Wirklichkeit ist Pucholt daheim in der Tschechoslowakei längst in Ungnade gefallen und darf zwei Jahre lang in keinem Film mitwirken. Er war gebeten worden – besser gesagt, man hatte ihm befohlen –, die Rolle eines tschechischen Jugendsträflings zu übernehmen, der sich nicht mehr in der Lage sieht, sein Leben in der weniger aufgeklärten, bourgeoisen Gesellschaft zu bewältigen, die ihn wieder aufgenommen hat, nachdem ihn seine entschlossenen Lehrer in der Besserungsanstalt für die hohen Prinzipien des Marxismus-Leninismus begeistern konnten.
Pucholt hatte das Drehbuch nicht sonderlich beeindruckt, doch hatte er darum gebeten, ein paar Tage in einer Besserungsanstalt zu verbringen. Hinterher war er sogar noch überzeugter davon, dass das Stück Mist war, und lehnte zum Entsetzen der Sachbearbeiter die Rolle ab. Die Gemüter erhitzten sich, man legte ihm Verträge vor, doch Pucholt gab nicht nach. Das Ende vom Lied war ein zweijähriges Berufsverbot; unter besseren Umständen hätte er dies natürlich wunderbar als Argument dafür verwenden können, dass er in seinem Heimatland Opfer politischer Verfolgung sei.
Eine Woche später wurde Pucholt erneut ins Ministerium vorgeladen, und diesmal informierte ihn der hin- und hergerissene Beamte in bester britischer Kompromissmentalität, dass Pucholt zwar nicht gewaltsam in die Tschechoslowakei zurückgeschickt werden würde, das Land aber innerhalb von zehn Tagen zu verlassen habe.
Deshalb sitzen wir nun also in stummer Sorge rings um Reisz’ Tisch. Die zehn Tage sind vorüber oder werden es bald sein, also, was schlagen Sie vor, was wir tun sollen, David? Kurze Antwort: David hat keine Ahnung, was wir tun sollen; erst recht nicht, nachdem im Laufe der Gespräche am Runden Tisch herauskommt, dass Pucholt nicht nach Großbritannien gekommen ist, um seine steile Schauspielerkarriere zu verfolgen, sondern, so erklärt er mir voller Ernst über die Tischplatte hinweg, »weil ich Arzt werden will, David«.
Er räumt ein, dass es wohl eine Weile dauern wird, bis er Arzt geworden ist. Sieben Jahre, schätzt er. Er kann ein paar grundlegende tschechische Qualifikationen vorweisen, bezweifelt aber, dass sie im Königreich sonderlich viel zählen.
Ich höre ihm zu. Ich erkenne die Leidenschaft in seiner Stimme und die Entschlossenheit auf seinem ausdrucksstarken slawischen Gesicht. Ich versuche mein Bestes, um weise zu wirken, und lächle anerkennend ob dieser noblen Darstellung von Überzeugung.
Aber ich weiß auch etwas über Schauspielerei. Und ich weiß ebenso wie alle anderen an diesem Tisch, dass Schauspieler sich an eine hypothetische Version von sich selbst klammern und sie sein können. Zumindest für die Dauer der Show. Danach ziehen sie weiter und suchen nach der nächsten neuen Person, die sie werden können.
»Also, das finde ich toll, Vladimír«, sage ich und schinde so viel Zeit heraus, wie ich nur kann. »Aber während Sie Ihre medizinische Ausbildung durchlaufen, wollen Sie doch bestimmt mit einem Fuß weiter in der Filmwelt stehen, nein? Ihr Englisch aufpolieren, ein wenig Theater spielen, ab und zu mal eine Filmrolle übernehmen?« Ich werfe einen hilfesuchenden Blick zu den zwei Regisseuren hinüber, doch die springen nicht ein.
Nein, David, erwiderte Vladimír. Er ist schon seit seiner Kindheit Schauspieler. Er ist von einer Rolle zur nächsten gewandert – oft genug Rollen, die ihm egal waren, wie die des Jungen in der Besserungsanstalt –, und jetzt hat er vor, Arzt zu werden, deshalb möchte er in Großbritannien bleiben. Ich schaue mich um. Niemanden am Tisch scheint das zu überraschen. Alle, außer mir, nehmen einfach hin, dass Vladimír Pucholt, Mädchenschwarm auf Bühne und Leinwand, nur Arzt zu werden wünscht. Fragen sie sich ebenfalls, wie ich, ob das die Phantasie eines Schauspielers ist und kein Lebensziel? Ich wüsste es nicht zu sagen.
Aber das macht nichts, denn in der Zwischenzeit habe ich eingewilligt, der Mann zu sein, für den sie mich halten. Ich werde mit meinen Leuten reden, sage ich, obwohl ich gar keine Leute habe. Ich werde die beste Möglichkeit finden, wie wir zu einem erfolgreichen und zügigen Abschluss kommen, wie wir Hintertreppen-Apparatschiks das eben so machen. Ich gehe jetzt nach Hause, aber ich melde mich. Abgang rechts, erhobenen Hauptes.
In dem halben Jahrhundert, das seitdem vergangen ist, habe ich mich hin und wieder gefragt, warum um alles in der Welt ich mich dazu bereit erklärt habe, wo doch Anderson und Reisz als Filmregisseure von Weltklasse viel mehr Leute an der Hand gehabt hätten, viel mehr Freunde in gehobenen Positionen aufweisen konnten als ich, von smarten Anwälten ganz zu schweigen. Reisz, wie ich weiß, stand in geheimer Verbindung mit Lord Goodman, éminence grise und Rechtsberater von Premierminister Harold Wilson. Anderson hatte, bei all seiner sozialistischen Strenge, erstklassige großbürgerliche Referenzen und verfügte, wie Reisz, über enge Verbindungen zur regierenden Labour Party.
Ich glaube, die Antwort darauf lautet, dass es eine Erleichterung für mich war, das Leben eines anderen Menschen in Ordnung zu bringen, wo doch mein eigenes so ein gotterbärmliches Chaos war. Als junger Soldat in Österreich hatte ich Dutzende von Flüchtlingen aus Osteuropa befragt, um der geringen Wahrscheinlichkeit nachzugehen, dass ein paar vielleicht Spione hätten sein könnten. Meines Wissens war das keiner von ihnen, aber ein paar waren Tschechen. Und hier gab es nun endlich einen, für den ich etwas tun konnte.
Ich weiß nicht mehr genau, wo Vladimír die folgenden paar Tage übernachtete, ob bei Reisz oder bei seiner Begleiterin, bei Lindsay Anderson oder gar bei mir. Ich weiß nur noch, dass er tagsüber viele Stunden in meinem hässlichen Penthouse verbrachte, auf und ab schritt oder am großen Panoramafenster stand und hinausschaute.
In der Zwischenzeit ziehe ich alle Strippen, die ich habe, um die Entscheidung des Innenministeriums abzuwenden. Ich rufe meinen warmherzigen britischen Verleger an. Er schlägt vor, dass ich den für Innenpolitik zuständigen Redakteur des Guardian anrufe. Das tue ich. Der Redakteur hat zwar keinen direkten Draht zum Innenminister Roy Jenkins, aber er kennt dessen Frau. Na ja, seine Frau kennt sie. Er wird mit seiner Frau reden und zurückrufen.
Langsam schöpfe ich Hoffnung. Roy Jenkins ist ein mutiger und entschiedener Liberaler. Der Redakteur des Guardian ruft mich zurück. Also, tun Sie Folgendes. Sie schreiben dem Innenminister einen streng offiziellen Brief, keine Lobhudeleien, kein Schmalz. »Lieber Innenminister«. Sie tippen ihn, schildern die Fakten und unterschreiben. Wenn Ihr Mann Arzt werden will, dann schreiben Sie das so, und kein Gesülze von wegen, er sei ein wahres Gottesgeschenk für das National Theatre. Doch jetzt kommt’s. Sie adressieren den Umschlag nicht an Roy Jenkins, sondern an seine Frau, Mrs Jenkins. Sie wird dafür sorgen, dass der Brief morgen früh neben seinem Frühstücksei auf dem Tisch liegt. Und Sie bringen den Brief persönlich vorbei. Heute Abend. Zu folgender Adresse.
Ich kann nicht tippen. Ich habe es noch nie gekonnt. Im Penthouse findet sich zwar eine elektrische Schreibmaschine, aber niemand, der sie bedienen kann. Ich rufe Jane an. Damals näherten Jane und ich uns noch vorsichtig einander an. Heute ist sie meine Frau. Pucholt starrt hinaus auf die Londoner Skyline, ich schreibe einen Brief an den »Lieben Innenminister«, Jane tippt ihn ab. Ich adressiere den Umschlag an Mrs Jenkins, verschließe ihn, und schon machen wir uns auf den Weg nach Notting Hill, oder wo auch immer Mr & Mrs Jenkins wohnen.
Achtundvierzig Stunden später erhält Vladimír Pucholt eine zeitlich unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis für Großbritannien. Keine Abendzeitung berichtet über einen gefeierten tschechischen Filmstar, der in den Westen übergelaufen ist. Er kann sein Medizinstudium so bald und so unauffällig, wie er will, antreten. Diese Neuigkeit erreicht mich, während ich gerade mit meinem Agenten zu Mittag esse. Ich begebe mich ins Penthouse zurück, und Vladimír starrt nicht länger zum Fenster hinaus, sondern steht in Jeans und Turnschuhen auf dem Balkon. Es ist ein warmer, sonniger Nachmittag. Er hat sich aus einem DIN-A4-Blatt von meinem Schreibtisch einen Papierflieger gebastelt. Er beugt sich für meinen Geschmack ein wenig zu weit über die Balkonbrüstung, wartet auf die richtige Brise, holt aus und schaut zu, wie der Flieger über die Dächer von London davontrudelt. Bis zu dem Zeitpunkt, erklärte er mir später, habe er nicht fliegen können. Doch jetzt hatte er ja die Aufenthaltserlaubnis, und es sei alles in Ordnung.
Das hier ist keine Geschichte über meinen grenzenlosen Edelmut. Hier geht es um Vladimírs Leistung, der einer von Torontos am höchsten geschätzten und engagiertesten Kinderärzten wurde.
Wie auch immer – und bis zum heutigen Tag weiß ich eigentlich immer noch nicht, wie –, jedenfalls war ich zuständig dafür, Vladimír sein Medizinstudium in Großbritannien zu bezahlen. Selbst damals schien das für mich eine ganz natürliche Angelegenheit zu sein. Ich war am Höhepunkt meiner Erwerbskraft angelangt, Vladimír stand am Tiefpunkt seiner eigenen. Wegen meines Angebots, ihn zu unterstützen, musste ich nicht das Geringste entbehren. Meiner Familie und mir fiel das nicht eine Sekunde schwer. Vladimírs finanzielle Bedürfnisse waren fürchterlich bescheiden, doch er wollte es unbedingt dabei belassen. Seine Entschlossenheit, jeden einzelnen Penny so schnell zurückzuzahlen wie nur möglich, war extrem. Um uns beiden peinliche Diskussionen zu ersparen, überließ ich es meinem Steuerberater, die Zahlen mit ihm durchzugehen: soundso viel für den Lebensunterhalt, soundso viel für das Studium, soundso viel für Fahrtkosten, Miete und so fort. Die Verhandlungen verliefen gegensinnig. Ich drängte Vladimír, mehr Geld anzunehmen, Vladimír wollte weniger.
Seine erste Tätigkeit als Mediziner war eine Laborassistenz in London. Von dort ging es weiter in ein Lehrkrankenhaus in Sheffield. In penibel formulierten Briefen in lyrischem, immer besser werdendem Englisch pries er die Wunder der Medizin, der Chirurgie, der Heilung und des menschlichen Körpers als Werke der Schöpfung. Er spezialisierte sich auf Kinderheilkunde und neonatologische Intensivmedizin. Mit unerschrockenem Enthusiasmus schreibt er noch heute über die Tausenden von Kindern und Babys, die er behandelt hat.
Mit großer Demut und auch ein wenig peinlich berührt habe ich immer verfolgt, mit welch geringem Opfer meinerseits und welch großem Gewinn für andere ich die Rolle des Engels spielen konnte. Noch peinlicher war es allerdings, dass ich fast bis zum Abschluss von Pucholts Studium nie so ganz überzeugt war, dass er es schaffen würde.
Es ist 2007, vierzig Jahre nachdem Vladimír seinen Papierflieger auf dem Balkon des Penthouse startete, das ich schon lange hinter mir gelassen habe. Die halbe Zeit lebe ich in Cornwall, die andere Hälfte verbringe ich in Hamburg und schreibe einen Roman mit dem Titel Marionetten. Darin geht es um einen jungen Asylsuchenden, aber nicht aus der damaligen Tschechoslowakei, sondern aus dem heutigen Tschetschenien. Er ist nur zur Hälfte slawisch, die andere Hälfte geht auf tschetschenische Wurzeln zurück. Er heißt Issa, das bedeutet Jesus, und er ist Moslem, nicht Christ. Er hat nur das eine Ziel, er will studieren und ein guter Arzt werden und die Leiden der Menschen in seiner Heimat lindern, vor allem die der Kinder.
Während er im obersten Stockwerk eines alten Hafenspeichers in Hamburg eingesperrt ist und die Spione um seine Zukunft streiten, bastelt er Papierflugzeuge aus einer alten Rolle Makulaturpapier und lässt sie in die Freiheit davongleiten.
Früher, als ich es jemals für möglich gehalten hätte, zahlte Vladimír jeden Penny zurück, den ich ihm je geliehen hatte. Was er nicht wusste – und ich auch nicht, bis ich Marionetten schrieb –, er hatte mir zudem das einmalige Geschenk einer fiktiven Gestalt gemacht.
36
Das letzte offizielle Geheimnis
Als ich noch ein junger, sorgloser Spion war, da war es ganz normal zu glauben, dass die größten Geheimnisse der Nation in einem leicht angeschlagenen grünen Safe der Marke Chubb aufbewahrt wurden, am Ausgang eines Labyrinths aus schummrigen Fluren im obersten Stock des Gebäudes 54 Broadway, gegenüber der U-Bahn-Station St. James’ Park, im Privatbüro des Generaldirektors des Geheimdienstes.
Broadway, wie wir das Gebäude nannten, war alt und staubig und, was das Weltbild des Dienstes anging, eigentlich ungeeignet. Von den drei ratternden Fahrstühlen war einer für den Chef reserviert, und er brachte ihn in seinem eigenen gemächlichen Tempo in die heiligen Höhen des obersten Stockwerks. Nur ein paar Auserwählte verfügten über einen Schlüssel. Wir Sterbliche stiegen eine schmale Holztreppe zum Chef hinauf, wobei wir von einem Kugelspiegel überwacht wurden, um dann bei unserer Ankunft auf dem obersten Absatz von einem Hauswart empfangen zu werden, der mit eiserner Miene auf einem Küchenstuhl saß.
Ich glaube, vor allem wir jungen Anfänger liebten das Gebäude sehr: wegen des ewigen Dämmerlichts, wegen des Geruchs nach den Kriegen, in denen wir nicht gekämpft hatten, und den Ränkespielen, von denen wir nur träumen konnten; wegen der winzigen Bar, die man nur auf Einladung betreten durfte und in der die Altgedienten verstummten, wenn wir eintraten; und wegen der dunklen, staubigen Bibliothek voller Spionageliteratur, über die ein älterer Bibliothekar mit wallendem weißen Haar herrschte, der als junger Spion mit den Bolschewiken durch die Straßen von Sankt Petersburg gerannt war und seine Geheimbotschaften aus einem Keller neben dem Winterpalast gesendet hatte. Die beiden Verfilmungen von Der Spion, der aus der Kälte kam und die BBC-Version von Dame, König, As, Spion fangen etwas von dieser Atmosphäre ein. Doch nichts von alledem kam an das Geheimnis des alten Chubbs-Safes heran.
Das Privatbüro des Generaldirektors war ein Dachbodenzimmer mit mehreren Lagen schmutzigen Geflechts vor den Scheiben, was den verstörenden Eindruck erweckte, man befände sich unter der Erde.
Wenn der Chef meinte, es sei ein sehr förmlicher Umgang angezeigt, dann blieb er hinter seinem leeren Schreibtisch sitzen, bewacht von den Porträts seiner Familie – und zu meinen Zeiten noch ergänzt durch die von Allen Dulles und dem Schah von Persien. War ihm eher nach einer entspannteren Atmosphäre, dann standen dafür die rissigen Ledersessel bereit. Doch wo immer man auch Platz nahm, stets war der grüne Safe im Blick und starrte einen durch den Raum unergründlich an.
Was um alles in der Welt befand sich darin? Ich hatte gehört, dass es Dokumente gab, die so geheim waren, dass sie nur vom Chef persönlich angerührt wurden. Wollte er sie jemand anderem zeigen, musste diese Person erst eine Verpflichtung unterschreiben, die Dokumente dann in Anwesenheit des Chefs lesen und sie wieder zurückgeben.
Doch nun ist der traurige Tag gekommen, an dem der letzte Vorhang für die Broadway Buildings fällt und der Dienst mit all seinem Hab und Gut in neue Räume in Lambeth umzieht. Ist der Safe davon ausgenommen? Werden Kräne, Brechstangen und stumme Männer ihn gewaltsam zur nächsten Etappe seiner langen Lebensreise schaffen?
Nach einer Sitzung auf höchster Ebene wird zögerlich beschlossen, dass der Safe, so ehrwürdig er auch sein mag, nicht mehr den Ansprüchen unserer modernen Welt entspricht. Vereidigte Beamte werden alles, was sich darin befindet, sichten, genauestens dokumentieren und dem Inhalt jene Bearbeitung zukommen lassen, die dem Grad ihrer Vertraulichkeit entspricht.
Aber wer hat den verfluchten Schlüssel?
Der amtierende Generaldirektor offenbar nicht. Er hat großen Wert darauf gelegt, niemals in den Safe zu schauen oder sich nutzloserweise mit den darin gelagerten Geheimnissen vertraut zu machen. Man kann nicht verraten, was man nicht weiß. Seine noch lebenden Vorgänger werden hinzugezogen. Demselben Prinzip folgend, haben auch sie der Versuchung widerstanden, diesen heiligen Boden zu betreten. Und sie wissen nicht, wo der verfluchte Schlüssel ist. Niemand, nicht in der Registratur, nicht im Sekretariat, nicht in der Abteilung hausinterne Sicherheit, nicht einmal der Hauswart mit der eisernen Miene auf seinem Küchenstuhl, keiner hat den Schlüssel in der Hand gehabt oder auch nur gesehen, keiner weiß, wo er ist oder wer ihn zuletzt gehabt hat. Alles, was man weiß, ist, dass der Safe auf Befehl des hochverehrten, aber pathologisch konspirativen Sir Stewart Menzies eingebaut wurde, Generaldirektor von 1939 bis 1952.
Hat Menzies also den Schlüssel mitgenommen? Ist er mit ihm beerdigt worden? Hat er sein Geheimnis buchstäblich mit ins Grab genommen? Er hätte allen Grund dazu gehabt. Er war einer der Gründerväter von Bletchley Park. Er hat unzählige Privatunterhaltungen mit Winston Churchill geführt. Er hat mit Widerstandsbewegungen in Nazi-Deutschland und mit Admiral Canaris verhandelt, dem wankelmütigen Leiter der Abwehr, des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht. Der Himmel allein wusste, was sich nicht alles in dem grünen Safe befand.
In meinem Roman Ein blendender Spion taucht der Safe in Form eines ramponierten grünen Aktenschranks auf, der Ronnies Alter Ego Rick sein ganzes Leben lang begleitet. Es geht das Gerücht, dass der Schrank die Summe seiner Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft enthält, doch wird der Schrank nie geöffnet.
In der Zwischenzeit läuft die Zeit davon. Jeden Tag wird der neue Mieter seine Rechte in Anspruch nehmen. Eine Entscheidung auf Führungsebene ist dringend vonnöten. Also gut, der Geheimdienst hat im Laufe der Jahre ja schon so einige Schlösser geknackt, es ist nun also an der Zeit, sich ein weiteres vorzunehmen: Holen Sie den Geheimdienstschränker.
Der Schränker versteht sein Geschäft. Geradezu beunruhigend schnell gibt das Schloss nach. Der Schränker öffnet die knarrende Eisentür. Ähnlich wie die Schatzsucher Carter und Mace vor dem offenen Grab Tutanchamuns recken auch hier die Schaulustigen die Hälse, um einen ersten Blick auf die Wunder in dem Safe zu werfen. Doch es gibt keine. Der Safe ist leer und hütet nicht einmal das banalste Geheimnis.
Doch einen Augenblick! Wir haben es hier mit ausgebufften Mitverschwörern zu tun, die sich nicht so leicht reinlegen lassen. Handelt es sich hier vielleicht um eine Attrappe, um eine Finte, um ein falsches Grab, eine Außenmauer sozusagen, die das Innerste schützt? Man verlangt nach einer Brechstange. Vorsichtig wird der Safe von der Wand gestemmt, der höchste anwesende Beamte wirft einen Blick dahinter, gibt einen leisen Aufschrei von sich, greift in den Spalt zwischen Safe und Mauer und zieht eine sehr staubige, sehr dicke, sehr alte graue Hose hervor, an der mit einer Sicherheitsnadel ein Zettel festgepinnt ist. Darauf steht getippt, dass es sich hier um die Hose handelt, die Rudolf Heß, Adolf Hitlers Stellvertreter, trug, als er nach Schottland flog, um mit dem Duke of Hamilton, von dem er irrtümlich annahm, dass er seine faschistischen Ansichten teilen würde, einen Separatfrieden auszuhandeln. Darunter befindet sich eine handschriftliche Notiz in der traditionellen grünen Tinte des Generaldirektors:
Bitte analysieren, gibt uns möglicherweise eine Vorstellung vom Stand der deutschen Textilindustrie.
37
Guter Rat für einen angehenden Schriftsteller
»Bevor ich den Schreibtag beende, achte ich darauf, dass ich noch etwas für den nächsten Tag aufgespart habe. Schlaf wirkt Wunder.«
Graham Greene zum Autor,
Wien, 1965
38
Stephen Spenders Kreditkarte
Ich glaube, es war 1991, als ich zu einem privaten Dinner in Hampstead eingeladen wurde, um Stephen Spender kennenzulernen, Essayist, Dramatiker, Romanautor, desillusionierter Kommunist, zum Ritter geschlagen, ehemaliger Poet Laureate der Library of Congress in Washington – das soll genügen.
Wir waren zu sechst, und Spender hatte das Wort. Mit zweiundachtzig war er noch immer sehr stattlich: weiße Haare, Löwenmähne, lebhaft, voller Witz. Er sprach über die Flüchtigkeit des Ruhms – seines eigenen vorgeblich, doch ich konnte mir den Gedanken nicht verkneifen, dass er mir eine dezente Warnung zukommen ließ – und er sprach über die Notwendigkeit, dass jene, die in den Genuss des Ruhms gekommen waren, es erhobenen Hauptes hinnehmen sollten, wenn sie wieder der Bedeutungslosigkeit anheimfielen. Um das zu veranschaulichen, erzählte er uns noch folgende Anekdote:
Er war gerade von einem Autotrip durch die Vereinigten Staaten von einer Küste zur anderen zurückgekehrt. Als er die Wüste von Nevada durchquerte, stieß er auf eine der seltenen Tankstellen und hielt es für schlau, vollzutanken. Eine handgeschriebene Notiz, die wohl darauf abzielte, Diebe abzuschrecken, wies darauf hin, dass der Tankstellenbesitzer nur Kreditkarten akzeptieren würde.
Spender zückte also seine Kreditkarte. Der Tankstellenbesitzer besah sie sich stumm. Schließlich rückte er mit seinen Bedenken heraus:
»Der einzige Stephen Spender, von dem ich jemals gehört hab, ist ein Dichter«, gab er zu bedenken. »Und der ist tot.«
Wir danken den Rechteinhabern für die Erlaubnis, folgende Aufsätze abzudrucken. Einige davon sind in der Originalausgabe in der Form übernommen, in der sie damals erschienen sind. Die meisten wurden nur in Auszügen verwendet.
10Feldforschung:
›The Constant Muse‹ erschien 2000 erstmals in den USA im New Yorker, 2001 in Großbritannien im Observer und im Guardian.
24Seines Bruders Hüter:
›His Brother’s Keeper‹ erschien 2014 in anderer Form als Nachwort zu A Spy Among Friends von Ben Macintyre, in den USA veröffentlicht von Crown Publishing Group, in Großbritannien von Bloomsbury.
25Quel Panama!:
›Quel Panama!‹ erschien erstmals in den USA in The New York Times, in Großbritannien 1996 im Daily Telegraph.
26Schläfer im eigenen Land:
›Under Deep Cover‹ erschien erstmals in den USA in The New York Times, in Großbritannien 1999 im Guardian.
27Die Jagd auf Warlords:
›Congo Journey‹ erschien erstmals 2006 in den USA in der Nation, in Großbritannien im Sunday Telegraph. Eine andere Übersetzung ins Deutsche erschien 2006 im Stern.
28Richard Burton braucht mich:
›The Spy Who Liked Me‹ erschien erstmals 2013 im New Yorker.
29Alec Guinness:
›Mission into Enemy Territory‹ erschien 1994 erstmals im Daily Telegraph und wurde als Vorwort nachgedruckt in Alec Guinness, My Name Escapes Me: The Diary of a Retiring Actor, Hamish Hamilton 1996. Eine andere deutsche Fassung erschien als Vorwort in Alec Guinness’ Buch Adel verpflichtet. Tagebuch eines noblen Schauspielers, Henschel 1998.
33Der Sohn des Vaters des Autors:
›In Ronnie’s Court‹ erschien 2002 erstmals in den USA im New Yorker, in Großbritannien 2003 im Observer.

Wie hat Ihnen dieses Buch gefallen? Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback! Bitte klicken Sie hier, um mit uns ins Gespräch zu kommen.

Hier klicken, den aktuellen Ullstein Newsletter bestellen und über Neuigkeiten, Veranstaltungen und Aktionen rund um Ihre Lieblingsautoren auf dem Laufenden bleiben.
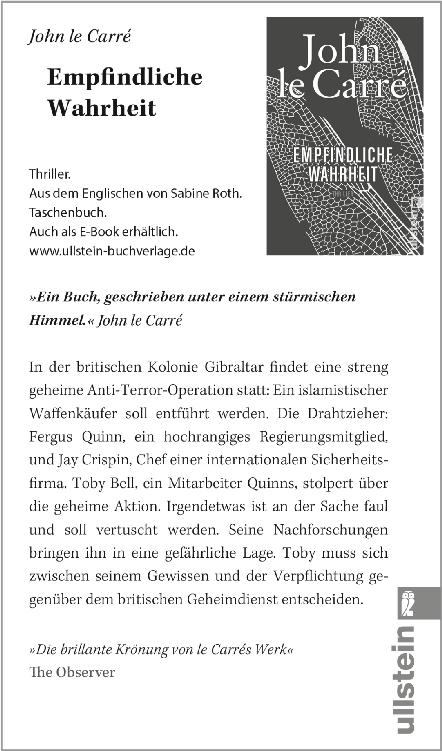
Finde Dein nächstes Lieblingsbuch

Vorablesen.de

Freu Dich auf viele Leseratten in der Community, bewerte und kommentiere die vorgestellten Bücher und gewinne wöchentlich eins von 100 exklusiven Vorab-Exemplaren.